 Abb. 1/1:
Wilhelm Wundt
Abb. 1/1:
Wilhelm Wundt
Vorbemerkung:
Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.
Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.
|
KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE IN 5 TEILEN (mit LINKS ins Internet)
|
Volltextsuche in allen 5 Teilen: |
|
|
Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,
ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at
|
|
I. EINFÜHRUNG IN GEGENSTAND UND ARBEITSWEISE DER PSYCHOLOGIE
Allgemeines ⇘ (Geschichtliches - Definition - Unterschiede zwischen wissenschaftlicher Psychologie und Alltagspsychologie - Fehlerhafte Heuristiken) - Einteilung des Forschungsgebietes der Psychologie ⇘ (Psychische Kräfte - Psychische Funktionen) - Tätigkeitsfelder der Psychologie ⇘ (Allgemeine Psychologie - Differentielle Psychologie - Experimentalpsychologie - Entwicklungspsychologie - Sozialpsychologie - Angewandte Psychologie - Nachbarwissenschaften) - Richtungen und Schulen ⇘ (Strukturalismus - Funktionalismus - Introspektionismus - Behaviourismus - Tiefenpsychologie - Gestaltpsychologie - Kognitive Psychologie - Humanistische Psychologie - Parapsychologie - Biologische Psychologie und Psychopathologie) - Methoden der Psychologie ⇘ (Prinzipielle Unterscheidungen - Statistik - Experiment - Test) - Gehirnabhängigkeit des seelischen Erlebens ⇘ (Beweise - Leib-Seele-Problem) - [Dieses Kapitel ⇘]
II. DIE WAHRNEHMUNG
Allgemeine Begriffe ⇘ (Reizschwellen - Adaptionsniveau - Empfindung - Wahrnehmung) - Reizleitung ⇘ (Erregungsbahn - Sinnes- und Nervenzellen - Ionentheorie der Erregung) - Das Gehirn ⇘ (Allgemeines - Funktionen und Aufbau - Forschungsmethoden - Daten - Hirnhälftentheorien - Aktivierungsniveau - Der Schlaf - Neuere Ergebnisse der Hirnforschung) - Optische Wahrnehmung - Das Auge ⇘ (Sinneszellen - Funktionsweise - Sehstörungen - Farbsehen - Kontrast- und Konstanzphänomene - Optische Täuschung - Tiefensehen - Bewegungssehen) - Akustische Wahrnehmung, Raumlagesinn - Das Ohr ⇘ (Aufbau und Funktion der Ohren - Daten - Hörstörungen - Tonmischung - Hydrodynamische Hörtheorie - Das Ohr als Gleichgewichtsorgan / Vestibularapparat) - Olfaktorische Wahrnehmung - Die Nase ⇘ (Allgemeines - Geruchstheorien - Einzelne Gerüche) - Geschmackswahrnehmung - Die Zunge ⇘ (Funktionsweise und Biologie - Geschmacksrichtungen) - Haptische Wahrnehmung - Die Hautsinne ⇘ (Allgemeines - Rezeptoren) - Die Zeitwahrnehmung ⇘ (Allgemeines - Steuerung - Psychische Präsenzzeit - Circadianer Rhythmus - Moment - Beeinflussung der Zeitwahrnehmung) - Die Gestaltwahrnehmung ⇘ (Gestaltbegriff - Kohärenzfaktoren - Intuition) - Wovon hängt ab, was und wie wir wahrnehmen? ⇘ (Angeborene und erworbene Voraussetzungen - Einstellung und Aufmerksamkeit - Bezugsrahmen - Ausdruck und Eindruck) [Dieses Kapitel ⇘]
III. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
Allgemeines ⇘ (Forschungsgebiet - Entwicklung - Programmierung - Phase - Reifung - Lernen) - Phasen der psychischen Entwicklung ⇘ (Säuglingsalter - Frühkindheit - Kleinkindalter - Phase der Schulfähigkeit - Reife Kindheit - Vorpubertät - Pubertät - Adoleszenz - Frühes Erwachsenenalter - Erwachsenenalter - Alter) - Entwicklungsstörungen - Geistige Behinderung ⇘ (Allgemeines - Einteilung der Behinderungen - Pränatal verursachte Behinderungen - Perinatal verursachte Behinderungen - Postnatal verursachte Behinderungen) [Dieses Kapitel ⇘]
IV. PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Definitionen ⇘ - Einige historische Auffassungen von Pädagogik ⇘ (Sokrates - Platon - Menander - Comenius - Rousseau - Kant - Pestalozzi - Humboldt - Herbart - Fröbrl - Adler - Reformpädagogik - Fremont-Smith - Rogers - Miller - Kernberg - MORE Life Experience Model - Gegenwart) - Bildungsinhalte ⇘ (Allgemeines - Bildungskanon) - Bildungseinrichtungen ⇘ (Institutionen - Organisationsformen) - Erziehungsstile und Erziehungsfehler ⇘ (Kategorisierung einzelner Stile - Andere Kategorisierungsversuche - Erziehungsfehler) - Erziehungsziele ⇘ (Lebensausstattung - Identität - Mündigkeit) [Dieses Kapitel ⇘]
V. INTELLIGENZPSYCHOLOGIE
Intelligenzdefinitionen ⇘ - Der Intelligenzquotient - IQ ⇘ (Definition - Verteilung des IQ - Bezeichnungen der verschiedenen Intelligenzgrade) - Die Anlage-Umwelt-Problematik ⇘ (Grundeinstellungen - Historische Klärungsversuche - Fazit) - Intelligenztests und -konzepte ⇘ (Ältere Tests - Moderne Tests) [Dieses Kapitel ⇘]
VI. DENKPSYCHOLOGIE
Definitionen ⇘ - Funktionen des Denkens ⇘ (Biologische Bedeutung - Verkürzung der Lösungszeit) - Entwicklung des Denkens nach Piaget ⇘ (Äquilibration - Phasen des Denkens im Laufe der Entwicklung) - Erscheinungsformen des Denkens ⇘ (Logisches Schließen und Problemlösen - Kreatives Denken - Wildes Denken - Probabilistisches Denken - Kritisches Denken) - Denken und Sprache, Kommunikation ⇘ (Zusammenhang zwischen Sprache und Denken - Semiotik: Dimensionen des sprachlichen Zeichens - Begriffe - Kommunikationsmodelle und Medientheorien - Defizithypothese) [Dieses Kapitel ⇘]
VII. LERNEN UND GEDÄCHTNIS
Definitionen ⇘ - Lernen im kognitiven Bereich ⇘ (Gedächtnis - Einprägen, Wiedergeben und Vergessen - Praxisanwendung, positive Effekte - Praxisanwendung, negative Effekte - Dem Gedächtnis verwandte Phänomene) - Lernen im vegetativen Bereich ⇘ (Definition - Klassisches Konditionierungsexperiment) - Lernen im Verhaltensbereich ⇘ (Definitionen - Entwicklung des Behaviourismus) - Lernmodelle ⇘ (Neurophysiologisches Modell - Kognitives Lernmodell - Lernmodell nach Pawlow - Lernmodelle des Behaviourismus - Lernen am Modell - Lernen aus Einsicht) [Dieses Kapitel ⇘]
VIII. TIEFENPSYCHOLOGIE UND PSYCHIATRIE
Definitionen ⇘ - Das Unbewusste ⇘ (Definition - Zugangsmöglichkeiten - Abwehrmechanismen) - Süchte, Persönlichkeitsstörungen, Geistes- und Gemütskrankheiten ⇘ (Allgemeines - Abhängigkeiten - Neurosen - Psychosen - Andere Einteilungen) - Therapieformen ⇘ (Definitionen - Geschichtliches - Basisinformationen - Psychodynamisch orientierte Therapieformen - Verhaltenstherapie - Humanistische und kommunikationsorientierte Therapieformen) [Dieses Kapitel ⇘]
IX. DIE PSYCHISCHEN KRÄFTE
Definitionen ⇘ - Triebe und Verhalten ⇘ (Definition - Einteilung der Triebe - Grundbegriffe der Ethologie und menschliche Verhaltensweisen) - Gefühle und Emotionalität ⇘ (Definition - Einteilung der Gefühle - Gefühlsmodi - Gefühlsstörungen, Parathymien) - Interessen und Werte ⇘ (Definition - Interessensbildung- Wertkategorien) - Wille und Motivation ⇘ (Definition - Einteilung und Untersuchung der Motive) [Dieses Kapitel ⇘]
X. SOZIALPSYCHOLOGIE
Definition ⇘ - Erscheinungsformen sozialer Kollektive ⇘ (Menge - Masse - Gruppe - Schicht und andere soziologische Unterteilungen - Institution - Andere Einteilungen) - Soziale Ränge und Mechanismen ⇘ (Ränge - Soziale Effekte) - Methoden der Sozialpsychologie ⇘ (Soziogramm - Feedback - IAT-Test - Cover Story - Andere Methoden) [Dieses Kapitel ⇘]
XI. PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE
Definitionen ⇘ - Typologien ⇘ (Antike - Konstitutionstypologien - Weltanschauungstypologie - Typologie der Kommunikationsmuster - Faktorenanalytische Modelle) [Dieses Kapitel ⇘]
|
KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 1. TEIL (mit LINKS ins Internet)
|
INHALT DES 1. TEILS:
I. EINFÜHRUNG IN GEGENSTAND UND ARBEITSWEISE DER PSYCHOLOGIE
(Allgemeines - Einteilung des Forschungsgebietes der Psychologie
- Tätigkeitsfelder der Psychologie - Richtungen und Schulen - Methoden der Psychologie - Gehirnabhängigkeit des seelischen
Erlebens) ⇘
II. DIE WAHRNEHMUNG (Allgemeine Begriffe - Reizleitung - Das Gehirn - Optische Wahrnehmung - Das Auge - Akustische Wahrnehmung, Raumlagesinn - Das Ohr - Olfaktorische
Wahrnehmung - Die Nase - Geschmackswahrnehmung
- Die Zunge
- Haptische Wahrnehmung - Die Hautsinne - Die
Zeitwahrnehmung - Die Gestaltwahrnehmung - Wovon hängt ab, was und wie wir wahrnehmen?)
⇘
|
|
Für allgemeine Informationen s. a. Einführungsvideo, Psychologie-Datenbanken, Psychologie-Suchmaschinen, Online-Psychologie-Kurse, Psychologische Online Dokumente, Psychologie-Portal, die informativen Psychologie-Arbeitsblätter der Universität Linz, die Homepage des Psychologie-Instituts der Univ. Wien, Stangl-Arbeitsblätter, folgendes Internetfachgebärdenlexikon, die Klassiker der Psychologie und zum Nachschlagen ein Online-Lexikon. Neuere Erkenntnisse der Psychologie werden hier zusammengefasst. Ein Lexikon der Argumente stellt wissenschaftliche Kontroversen dar, Frauen in der Psychologie werden hier porträtiert.
Vgl. a. Videovorlesungen der Yale-Universität mit Transkription und Unterlagen (darunter „Introduction to Psychology“), Psychologie-Video-Portal, den Vortrag „Psychologie für Nichtpsychologen“ von Erich Fromm (s. u.), ein Lexikon der Psychologie und für den Schulbereich Verband der Psychologielehrer .de, ARGE PP Wien, österreichische BundesARGE Pup, PuP-Portal schule.at, Computer-gestützte Experimente für den Psychologieunterricht.
 Abb. 1/1:
Wilhelm Wundt
Abb. 1/1:
Wilhelm Wundt
- Geschichtliches:
Das griechische Wort Psychologie bedeutet wörtlich „Lehre von der
Seele“ (griech. ψυχή = Seele, λόγος = Wort, Lehre). Seit mehr als 3000 Jahren beschäftigt sich die Menschheit
nachweislich mit der
Vorstellung einer vom Körper getrennten Seele (s. a. u.),
Begräbnisrituale lassen einen noch viel früheren Zeitpunkt (lange vor jeder
Verschriftlichung) annehmen. In der Antike hielten Sokrates
(469-399 v. Chr.) bzw. sein Vermittler Platon
(427-347 v. Chr.) die Seele für unsterblich
und geflügelt, sie lenke ihren von einem störrischen und einem gehorsamen Pferd
gezogenen Wagen durch das Himmelsgewölbe und könne in einer Seelenwanderung
menschliche Körper annehmen. Der Begriff
„Psychologie“ wurde aber erst von Philipp
Melanchthon
(eig. Schwartzerdt, 1497-1560) in
seinen Vorlesungen eingeführt und bekannt gemacht, nachdem er bereits 1506 von Marcus
Marulus (eig. Marko
Marulic, 1450-1524) zum ersten Mal
im heutigen Sinn verwendet worden war. Die endgültige Anerkennung erfolgte durch
die
Aufnahme des Lemmas „Psychologie“ in die Encyclopédie durch Denis
Diderot (1713-1784). Noch im
18. Jhdt. gründete (und leitete 10 Jahre lang) Karl
Philipp Moritz
(1756-1793) das vom Empirismus beeinflusste Magazin für Erfahrungsseelenkunde,
das Fakten statt Anekdoten liefern wollte und als erste deutschsprachige
psychologische Zeitschrift gilt, 1786 erschien der erste psychologische Roman (Der
Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich
Schiller, 1759-1805, der
psychologische Einflüsse auf einen Täter darstellt und dessen Tat
nachvollziehbar werden lässt), erste
universitäre Vorlesungen über Psychologie hielt Herbart
(s. u.) 1806 im Rahmen
seines Kant'schen
Philosophie-Lehrstuhls in Königsberg.
Der Beginn der wissenschaftlichen Psychologie wird mit 1879 angesetzt (Eröffnung des ersten Instituts für experimentelle Psychologie mit Labor durch Wilhelm Wundt, 1832-1920, in Leipzig - Leipziger Schule; vgl. seine Autobiographie Erlebtes und Erkanntes bzw. folgende Webseite.) Wundts Definition nach ist Psychologie „die allgemeine Wissenschaft von den Gesetzen des geistigen Lebens“, eine Art empirische Geisteswissenschaft, die er (im Gegensatz zur weiteren Entwicklung) eher an die Physik als an die Biologie angelehnt sah. Die American Psychological Association (APA) wurde 1892 als erste Vereinigung von Psychologie betreibenden Wissenschaftlern von Granville Stanley Hall (1844-1924) gegründet, der einer der ersten Teilnehmer an Wundts Experimenten gewesen war und als erster einen PhD-Titel in Psychologie erwarb. Als Begründer der österreichischen universitären Psychologie gilt Karl Bühler (1879-1963; s. a. u.), der ab 1922 in Wien einen Lehrstuhl für „Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Psychologie und der experimentellen Pädagogik“ innehielt. Der Berufsverband der Forschenden und Lehrenden ÖGP (Österreichische Gesellschaft für Psychologie) wurde erst 1993 gegründet. 1908 meinte Hermann Ebbinghaus (1850-1909; s. u.): „Die Psychologie hat eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Geschichte“.
Immer wieder sah sich die Psychologie als Wissenschaft Vorwürfen ausgesetzt, die z. B. systematische Fehler ihrer Theorienbildung, implizite Ideologielastigkeit oder die Stichhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit ihrer Aussagen betrafen. Karl Kraus (1874-1936) meinte etwa: „Psychologen sind Durchschauer der Leere und Schwindler der Tiefe.“ Humorvoll ein gängiges Vorurteil bedienend, formulierte Egon Friedell (1878-1938; Suizid): „Psychologie ist die Wissenschaft von der Seele dessen, der sie betreibt.“ Dennoch entwickelte sich die Psychologie im 20. und 21. Jhdt. wie kaum eine andere Wissenschaft rasant zu großer Popularität und Wirkmächtigkeit.
- Definition:
Die Psychologie als Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen
sowie seinem Bewusstsein. Sie untersucht
seelische Vorgänge und Zustände, ihre Ursachen und Wirkungen sowie ihre Rolle bei der
Entwicklung der Persönlichkeit und analysiert auf biologischer, psychologischer
und soziokultureller Ebene diesbezügliche Phänomene. (Dies wird
„biopsychosozialer Ansatz“
genannt. - Beispiel: Angstverhalten könnte durch Hirnstrukturen /
Persönlichkeitsmerkmale / Lerneffekte beeinflusst sein). Ziel vieler Sparten der
Psychologie ist es, das Verhalten und Erleben zu beschreiben, zu erklären,
vorherzusagen und zu beeinflussen bzw. zu kontrollieren.
- Unterschiede zwischen
wissenschaftlicher Psychologie und Alltagspsychologie:
Im Unterschied zur Alltagspsychologie
(wie sie vor allem in Zeitschriften, elektronischen Medien, manchen persönlichen
Gesprächen oder gar Horoskopen, unseriösen Therapieangeboten und anderen
pseudowissenschaftlichen Phänomenen erscheint), folgt die wissenschaftliche Psychologie,
deren Ergebnisse plausibel und gegebenenfalls wiederholbar (Replikationskriterium)
sein müssen,
folgenden gängigen
Kriterien:
| ° | systematische und, wo dies möglich und sinnvoll ist, empirische Herangehensweise - statt anekdotischer, assoziativer Vorgehensweise, die auf Einzelbeispiel„nachweis“ beruht |
| ° | Anwendung von offen dargelegten Methoden, die dem Forschungsgegenstand angemessen sind - statt Missachtung von Objektivität, Reliabilität und Validität |
| ° | logische Deduktionen - statt nach dem Induktionsverbot unzulässiger Verallgemeinerungen (die nur als Arbeitshypothesen zulässig sind) |
| ° | intersubjektive Überprüfbarkeit - statt subjektiver Überzeugungen, die nur scheinbar „bestätigt“ werden |
| ° | Beweisführung auf nachvollziehbarer, argumentativer Basis - statt unkritischer Verweise |
| ° | klare, exakt definierte Terminologie und verständliche Sprache - statt schwammiger, sich während der „Argumentation“ verändernder Begriffe |
| ° | klare Fragestellungen, deren Antworten sich (gemäß dem von Karl R. Popper, 1902-1994 - seit 1965 Sir -, geforderten Falsifikationskriterium) der Widerlegung exponieren - statt Vorwegnahme eines bereits „feststehenden“ Ergebnisses |
| ° | sachliche Deskription - statt Verwendung von wertbezogen eingefärbten Phrasen |
| ° | Ermittlung zuverlässiger Korrelationen - statt Gleichsetzung von Koinzidenz und Kausalität |
Ex.: Bertram R. Forer (1914-2000) konfrontierte 1948 zahlreiche Vpn. mit folgendem - immer gleichen, gemäß der Cover Story (s. u.) vorgeblich als Ergebnis eines zuvor an ihnen durchgeführten Persönlichkeitstests entstandenen - Text:
| „Sie brauchen die Zuneigung und Bewunderung anderer, dabei neigen Sie zu Selbstkritik. Zwar hat Ihre Persönlichkeit einige Schwächen, doch können Sie diese im Allgemeinen ausgleichen. Sie haben beträchtliche Fähigkeiten, die brachliegen, statt dass Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen. Äußerlich diszipliniert und kontrolliert, fühlen Sie sich tendenziell innerlich ängstlich und unsicher. Mitunter zweifeln Sie ernstlich an der Richtigkeit Ihres Tuns und Ihrer Entscheidungen. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung, und Sie sind unzufrieden, wenn Sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden. Sie sind stolz auf Ihr unabhängiges Denken und nehmen anderer Leute Aussagen nicht unbewiesen hin. Doch erachten Sie es als unklug, sich anderen zu freimütig zu öffnen. Manchmal verhalten Sie sich extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, manchmal auch introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Einige Ihrer Wünsche scheinen mitunter eher unrealistisch.“ |
Forer erntete aufgrund der Schwammigkeit der verwendeten Begriffe, denen jede exakte Definition fehlt (vor allem der Schluss wirkt fast kabarettistisch) und der Unmöglichkeit, die getroffenen Aussagen zu widerlegen, durchwegs hohe Zustimmungsraten (vgl. a. u. Barnum-Effekt): 85% der Befragten fühlten sich verstanden und gut beschrieben. (Nach demselben Prinzip „funktionieren“ Horoskope.)
- Fehlerhafte Heuristiken:
Aufgabe einer wissenschaftlichen Psychologie ist es, durch die zusätzliche
Erforschung geänderter Ausgangsbedingungen Cum / Post hoc ergo propter
hoc-Argumente, weitere falsche Kausalattribuierungen und Fehlschlüsse sowie die
Überschätzung der Validität eigener Überzeugungen zu
verhindern. (Dieser Abschnitt ist v. a. Daniel Kahneman,
1934-2024, Thinking, fast and slow
2011 bzw. Kahneman u. a., Noise 2021 verpflichtet;
s. a. u.)
Häufig besteht der limitierende Faktor in Bezug auf die Komplexität der
notwendigen Denkvorgänge auch in unserer Gehirnausstattung (dazu
s. u.).
Analoge Beispiele für Fehlschlüsse aus anderen Bereichen: Wenn es regnet, sind die Straßen nass. Sie sind nun nass, also muss es geregnet haben. Oder: Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. Diese Bohnen sind weiß. Also sind sie aus diesem Sack. Oder: Wer eine größere Schuhnummer hat, hat statistisch in Österreich ein höheres Gehalt als Kleinfüßige. (Dies trifft zwar tatsächlich zu - aber nicht, weil der Zusammenhang ein direkter wäre: Beide Variablen sind auf etwas Drittes zurückzuführen, nämlich das Geschlecht. Frauen verdienen im Schnitt weniger und haben auch kleinere Füße.)
Im Alltag treten häufig fehlerhafte Heuristiken (griech. εὑρίσκειν = finden) auf. Darunter versteht man Verfahren und Lösungsfindungsstrategien („Daumenregeln“), die zeitökonomisch adäquate Antworten auf Fragen oder Entscheidungen finden wollen, wie z. B. das Ausschlussverfahren, die Stichprobenauswertung, das Trial-and-error-Verfahren etc., bzw. ganz allgemein Denkweisen im Alltag. Im Unterschied zu Algorithmen (einer bei Problembearbeitungen angewendeten endlichen Abfolge definierter, nachvollziehbarer Schritte, an deren Ende eine Lösung steht; benannt nach أبو جعفر محمد بن موسى خوارزمی / Abu Abdulla Muhammad ibn Musa al-Choresmi, ca. 780-840 aus dem heutigen Usbekistan; z. B. in einem Labyrinth immer an einer Wand entlanggehen, ohne den Hand-Mauer-Kontakt zu verlieren) können sie, müssen aber nicht zum Erfolg führen.
Man kann häufig beobachten, dass Urteile (verstanden als durch den menschlichen Verstand vorgenommene Messungen) alles andere als valide, reliabel und objektiv (zu diesen Begriffen s. u.) sind. Wenn man unverfälschte Ergebnisse bei der Informationsverarbeitung anstrebt (z. B. ähnliche Gerichtsurteile in vergleichbaren Fällen), müssen täuschende Störfaktoren berücksichtigt werden, v. a.
| ° | Bias (Verzerrung, Inkonsistenz): systematische, vorhersagbare Normabweichungen: der Irrtum erfolgt nach einem Muster. Bias bezeichnet einen fehlererzeugenden psychologischen Mechanismus wie auch dessen Ergebnis. Im Unterschied zu Noise, dessen Aufdeckung eine (aufwändige) statistische Denkweise erfordert, lässt sich Bias (anstrengungsloser) kausal erklären und wird deshalb überproportional beachtet. (Beispiele: Das Ergebnis repräsentativer Umfragen könnte aufgrund suggestiver Fragestellungen verzerrt sein, Lehrer könnten Mädchen bei gleicher Leistung besser beurteilen als Buben.) | |||||||||
| ° | Noise (Verrauschung,
Unzuverlässigkeit): der Irrtum
erfolgt in Zufallsstreuung ohne Muster. Noise bedeutet, dass getroffene Urteile
ohne ersichtlichen Grund unerwünscht streuen und auch ganz anders hätten ausfallen können,
obwohl sie gleich sein sollten. Es macht aufgrund dieser unerwünschten
Variabilität bei der Beurteilung desselben Problems den Ausgang
von Entscheidungen oft unvorhersehbar. Jede Urteilsbildung unterliegt - meist
drastisch unterschätzten - Zufallsschwankungen, in der Terminologie Kahnemans
bezeichnet als
System Noise (Überbegriff, der die unerwünschte Streuung durch Abweichung von der im Idealfall
identischen Beurteilung verschiedener Beurteiler in demselben Fall anzeigt; wenn z. B. Psychiater/innen ein und dieselbe
Person unterschiedlich diagnostizieren); untergliedert in
|
Die erste Täuschung besteht bereits darin, dass das Gehirn den enorm vielfältigen Input, der unentwegt einströmt, vereinfacht, um überhaupt erst das Wichtige und Neue bearbeiten zu können, sodass nach Tor Nørretranders (*1955) als Benutzerillusion „unsere Karte von uns selbst und unseren Möglichkeiten, auf die Welt einzuwirken“ entsteht. Was unser Gehirn uns vorspielt, ist nach Daniel Dennett (1942-2024) eine „Metapher für das, was wirklich geschieht“. Bewusstsein sei eine Illusion. In der Servus TV-Sendung Der Pragmaticus vom 4. 9. 2025 wurde gefragt: „Ist unser Gehirn eine schablonensüchtige Fälscherwerkstatt, die uns Halluzinationen vorgaukelt?“ (Zum Folgenden vgl. auch folgende Übersichtsgraphik)
* Beispiele (großteils nach Kahneman):
| ° | Repräsentativitätsheuristik: Wenn wir etwas Neues kennen lernen, suchen wir, vor allem bei Personen, einen Vergleich mit früheren Erfahrungen, die auf die neue Person zu passen scheinen. Wir schließen dann, dass auch andere Eigenschaften desselben Stereotyps auf die Person zutreffen und ersetzen die zielführenderen Wahrscheinlichkeitsüberlegungen (s. a. u. Halo-Effekt). Sport-Scouts wählen z. B. zum Nachteil ihrer Vereine auf dem Transfermarkt Spieler oft aufgrund ihres Aussehens und Körperbaus und nicht wegen ihrer bisher erzielten statistischen Leistungsdaten aus; sie bedienen sich dabei Stereotypen (s. u.). Da diese ja tatsächlich oft zutreffen (junge Männer begehen z. B. tatsächlich häufiger Aggressionsdelikte als alte Frauen, der Umkehrschluss - „wenn viele Gewalttäter Männer unter 40 sind, wird auch dieser Unter-40-Jährige ein Gewalttäter sein“ - ist jedoch unzulässig), wird die Wahrscheinlichkeit von an sich seltenen Ereignissen (solchen mit niedriger Basisrate; s. a. u.) überschätzt, wenn spezifische Informationen dies nahelegen. Deshalb sollte man z. B. eher auf Möglichkeit 2 wetten, wenn man raten soll, ob jemand, den man eine Qualitätszeitung lesen sieht, zu Ende studiert hat (1) oder nicht (2). Selbst wenn alle Universitätsabsolventen Presse oder Standard läsen, gäbe es weit mehr Leser dieser beiden Blätter, die nie eine Universität von innen gesehen bzw. diese vor einer Diplomprüfung verlassen haben. Die Basisrate der Menschen ohne akademischen Studienabschluss ist einfach viel höher. (Eine andere fehlerhafte Anwendung der Repräsentationsheuristik liegt vor, wenn man die typischere Abfolge im Roulette-Spiel rot-rot-schwarz-rot-schwarz-schwarz auch für wahrscheinlicher hält als schwarz-schwarz-schwarz-schwarz-schwarz-schwarz. Da die Kugel nichts von ihrem bisherigen Verlauf weiß, sind beide Varianten genau gleich un/wahrscheinlich. Der Denkfehler besteht darin, dass man „6x schwarz“ mit „nicht 6x schwarz“ vergleicht.) Vgl. dazu auch: |
| ° | Basisratenfehler: Tendenz, den Durchschnittserwartungswert zu ignorieren, nicht angemessen zu beachten oder unbewusst nach oben oder unten zu korrigieren, vor allem dann, wenn zufällig auftretende Umstände einen höheren oder niedrigeren Wert nahelegen (mathematisch nach dem Bayes-Theorem - nach Thomas Bayes, 1701-1761, ausgedrückt: wenn die Bestimmung der bedingten Wahrscheinlichkeit einer statistischen Variable A unter einer Bedingung B ohne Rücksicht auf die Prävalenz, also die A-priori-Wahrscheinlichkeit von A vorgenommen wird). Man unterschätzt z. B. die Anzahl der Regentage im November, wenn gerade eine Schönwetterperiode herrscht (Status quo-Verzerrung), oder die Rate von Akademikern, die Boulevardzeitungen lesen (s. o. bzw. u. für ein anderes Beispiel). Auch die Wahrscheinlichkeit, einen Lotto-6er zu gewinnen (die deutlich geringer ist, als vom Blitz getroffen zu werden; s. hier), steigt nicht an, nur weil man in der Zeitung gerade von einem neuen Millionär gelesen hat. Die Neigung, eine gerade eben vorhandene Situation linear fortzuschreiben, nennt man Straight Line Instinct. Verwandt mit dem Basisratenfehler ist auch die |
| ° | Verfügbarkeitsheuristik: die relative Wichtigkeit oder Häufigkeit von Ereignissen wird zu hoch eingeschätzt, wenn es besonders leicht gelingt, sie - ev. auch situationsbedingt - ins Bewusstsein zu rufen. (Ähnlich funktioniert die zu eingeschränkter Risikointelligenz führende so genannte Truthahn-Illusion gemäß dem Gleichnis vom induktivistischen Truthahn von Bertrand Russell, 1872-1970, nach dem der Vogel immer die Fortschreibung seiner Situation erwartet, weil er an die ihm verfügbare Information, nämlich dass der Bauer ihn täglich füttert, glaubt - der bestehende Trend wird extrapoliert -, bis er zu Thanksgiving doch getötet wird.) Je leichter Beispielfälle erinnert werden können, desto höher wird deren Wahrscheinlichkeit eingeschätzt. So überschätzen die meisten Menschen die Wahrscheinlichkeit eines Mordes, Terroranschlags oder Flugzeugabsturzes, weil Medien überproportional häufig darüber berichten (s. a. u. Ankereffekt). Umgekehrt wird die Anzahl der Suizide (in Österreich ca. dreimal häufiger als Verkehrstote) oder die der (weiblichen) Grundschulabsolventinnen in Ländern mit niedrigen Einkommen (über 60%) drastisch unterschätzt. Ex.: Testpersonen schätzten die Anzahl englischer Wörter, die mit „K“ beginnen, höher ein als die Anzahl englischer Wörter, die ein „K“ als dritten Buchstaben haben. Letztere fallen einem nicht so leicht ein, sind aber doppelt so häufig. (Hat das System 1 - s. u. - zu einer bestimmten Frage keine Beurteilungsgrundlage verfügbar, ersetzt es die Frage unbewusst durch eine andere, deren Antwort leichter zugänglich ist.) |
| ° | Gap Instinct: Bezeichnet die Neigung des Menschen, die Welt aufgrund von Dateninkompetenz in gegensätzliche Entweder-oder-Bereiche einzuteilen (z. B. arme Länder - reiche Länder, gebildete Österreicher/innen - ungebildete Österreicher/innen). Die zahlenmäßige meist größere Zwischengruppe wird vernachlässigt. (Darauf verwies Hans Rosling, 1948-2017, - s. u. - in seinen Forschungen. Vgl. a u.) |
| ° | Proportionality-Bias (Neigung zur Verhältnismäßigkeit): Urteilsverzerrung, die von der unbewussten Erwartung verursacht wird, dass außergewöhnliche Ereignisse auch - im Verhältnis entsprechende - außergewöhnliche Ursachen haben müssen. Dieser Denkfehler erklärt unter anderem die oft erstaunliche Akzeptanz von merkwürdigen Fake Facts und Verschwörungstheorien (zu deren Methoden s. u.) wie z. B. die seit Jahrhunderten auf tragische Weise wirkmächtige antisemitische Verschwörungserzählung - die zusätzlich das Bedürfnis nach Sündenböcken bedient - oder wenn geglaubt wird, dass Bielefeld gar nicht existiere, die Mondlandung 1969 in Filmstudios inszeniert, der 9/11-Einsturz des WTC durch den Mossad bzw. die USA-Regierung selbst, die Corona-Pandemie durch Chemtrails verursacht worden wäre bzw. eine mRNA-Impfung die DNA beeinflusse u. v. a. mehr. (Zu Letzterem vgl. Zitat von Urban Priol, *1961: „Wer glaubt, dass die Impfung die DNA verändert, sollte dies als Chance begreifen“.) Eine sozialpsychologische Erklärung für das Glauben an kontrafaktische Mythen lieferte die Frankfurter Schule in den 1960er-Jahren: Die Ohnmachtserfahrung des von anonymen Verhältnissen bedrängten Subjekts werde dadurch kompensiert, dass schwer greifbare strukturelle Verwerfungen zu konkreter Schuld uminterpretiert würden. In einer kaum noch lesbaren Welt biete sich durch den vermeintlichen Durchblick die Möglichkeit einer Resouveränisierung. |
| Der statistisch viel öfter wirksame allgegenwärtige Zufall bzw. andere, „banalere“ Ursachen werden bei dieser Herangehensweise unterschätzt oder übersehen. Die viel geeignetere Heuristik wäre daher das scholastische Prinzip der Parsimonie (auch bekannt als Rasiermesser des William von Ockham, 1288-1347, oder KISS-Prinzip: Keep it simple and stupid), nach dem immer die einfachste Erklärung mit den wenigsten Zusatzannahmen angewendet werden sollte. | |
| ° | Regressionsfehlschluss: Eine Folge von Ereignissen tendiert on the long run zum Mittelwert (= Regression), Extreme in beide Richtungen werden selten sofort über- bzw. unterboten. Auf ein Lob nach einer extrem guten Leistung folgt beispielsweise meistens eine schwächere Leistung, während auf Kritik nach einer extrem schlechten Leistung meistens eine bessere Leistung folgt. Daraus zu schließen, dass Lob demotiviert und Kritik motiviert, wäre voreilig, da beide Ereignisse auf Grund des oben Gesagten davon unabhängig eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben und daher in jedem Fall erwartbar sind. Schätzungen und Voraussagen berücksichtigen statistische Gegebenheiten meist zu wenig. |
| ° | Confirmation Bias (Bestätigungsfehler; Bezeichnung vom englischen Denkpsychologen und internationalen Fernschachmeister Peter Cathcart Wason, 1924-2003, unter Einfluss des Philosophen Karl R. Popper, 1902-1994; vgl. den Titel des Nachrufs auf diesen von Gerhard Vollmer, *1943: „Wir irren uns empor.“): Er besteht darin, dass man, anstelle eigene Überzeugungen in Frage zu stellen, nach deren Bestätigung sucht („positive Teststrategie“). Ex. von Wason: Studenten sollten die verdeckt auf einer Karte stehende Regel erschließen, die der vorgegebenen Zahlenreihe „2-4-6“ zugrunde liegt. Ihre Vorschläge zur Fortsetzung der Reihe wurden mit „Passt“ oder „Passt nicht“ quittiert. Fast alle Vpn. suchten mit „8-10“ usw. nach der Bestätigung der in ihren Köpfen entstandenen Theorie, dass diese Regel „Zahl plus 2“ heißen würde. Dies entsprach zwar auch der Vorgabe, aber nur zufällig. (Die Regel lautete simpel: „Die nächste Zahl muss größer als die vorangegangene sein.“) Der Versuch, die eigene Theorie zu widerlegen, hätte rascher zum Erfolg geführt als der Versuch, sie zu bestätigen (Perpetual-beta-Denkweise: Urteilsverbesserung durch Selbstkorrektur während des Informationsfortganges). |
| Von Wason stammt auch das Selection Task-Ex.: Vor der Vp. liegen vier Karten mit den Aufschriften „A“, „D“, „4“ und „7“. Jede Karte zeige einen Buchstaben auf der einen und eine Zahl auf der anderen Seite. Es gelte die Regel, dass immer dann, wenn eine Seite der Karte einen Vokal zeige, auf der anderen Seite eine gerade Zahl aufgedruckt sei. Nun wird gefragt, welche Karte(n) man umdrehen müsse, um entscheiden zu können, ob die präsentierten Karten dieser Regel entsprechen. (Richtige Lösung, die nur von 4% erkannt wird: A und 7, da sie die Regel im Falle des Nicht-Eintretens widerlegen würden; zu Wason s. a. u.) | |
| ° | Affektheuristik: Laut dem Risikoforscher Paul Slovic (*1938) besteht eine deutliche Wahrnehmungsverzerrung dann, wenn Emotionen im Spiel sind (also oft). Ergebnis eines Exs.: Befürwortet man z. B. die derzeitige Gesundheitspolitik, hält man bei gleichbleibenden objektiven Gegebenheiten ihre Risken für geringer, ihre Wirksamkeit aber für höher, als wenn man sie ablehnte. Vorlieben und Abneigungen übertönen Argumente. Nutzen und Kosten werden über- oder wechselweise unterschätzt, je nachdem, ob man eine positive oder negative Einstellung zum angesprochenen Thema hat. Auch die Tendenz zur Irrationalität, wie sie sich z. B. beim Festhalten am Nutzen der Homöopathie gegen jede Evidenz (s. u.) zeigt, hat oft starke (in diesem Fall z. B. gegen Vertreter der Schulmedizin manchmal zurecht entwickelte negative) Gefühle zur Grundlage. |
| Aus ähnlichen Gründen (die aber unter Occasion Noise - s. o. - fallen) fällen müde Richter vor ihrer Essenspause bei gleicher Sachlage nachgewiesenermaßen im Durchschnitt strengere Urteile als ausgeruhte und satte (wie 2011 eine israelische Nachuntersuchung von Tausenden Fällen von bedingten Haftentlassungen ergab). Auch ihr Denken wird - genauso wie das von Ärzten, die vormittags weit mehr weiterführende Untersuchungen anordnen als nachmittags - durch Befindlichkeiten, die auf ihre Entscheidungen einwirken, beeinflusst. | |
| ° | Ankereffekt: Momentan vorhandene Umgebungsinformationen, seien sie zufällig oder von einem Versuchsleiter bewusst gesetzt, beeinflussen statistisch signifikant das Einschätzungsvermögen von Versuchspersonen. Beispiel-Ex. von Tversky und Kahneman (s. u.): Versuchspersonen sollen den Prozentsatz afrikanischer Staaten an den UNO-Staaten (in Wirklichkeit 28%) schätzen, nachdem sie ein von den Versuchsleitern manipuliertes Glücksrad gedreht haben, das nur bei 10 oder 65 stehen bleiben konnte, was die Vpn. aber nicht wussten. Die Korrelation (s. u.) der Einschätzung der Versuchspersonen mit einer dieser Zahlen war frappierend: Die Gruppe, die 10 gedreht hatte, schätzte den gefragten Prozentsatz im Durchschnitt weit niedriger, wer 65 gedreht hatte, weit höher ein, als es dem gemittelten Zufall entsprechen würde. Allein an die erste Zahl gedacht zu haben, beeinflusst offensichtlich - bedingt durch eine Art Suggestion und gleichzeitig eine dem Menschen innewohnende Tendenz zur Anpassung - die zweite, obwohl es keinerlei logische Verbindung zwischen ihnen gibt. (Vgl. a. u.) |
| ° | Neigung zu (schein)kausalem Denken, wo statistisches Denken (das einen möglichen Scheinzusammenhang der Kausalität entlarven könnte) oder Zufallsannahmen angebracht wären. Grund: Menschen neigen zu kohärenten Erzählungen zuungunsten von Erklärung durch „Glück“ oder „Pech“ oder „Zufall“. (Vgl. die Suche nach Schuldigen bei Katastrophen auch dann, wenn schicksalhaftes Geschehen vorliegt; auch der Spielerfehlschluss, der z.B. viele Roulettespieler glauben lässt, dass nach 5mal Rot die Wahrscheinlichkeit für Schwarz höher sei als nach 1mal Rot, gehört hierher). Verwandt damit: |
| ° | Tendenz zu assoziativer Kohärenz, die mit den üblichen Normen vereinbar ist, auch wenn sie der Realität nicht entspricht. Ein bekanntes Beispiel ist das Ex. zur Moses-Illusion: Nur wenigen Menschen fällt auf, dass an der Frage „Wie viele Tiere jeder Art nahm Moses mit in seine Arche?“ etwas nicht stimmt, da der verwendete Name nicht weit genug vom gespeicherten Wissen abweicht um nicht vom System 1 „kohärent gemacht“ werden zu können. (Auch das Beispiel der Affektheuristik - s. o. - ließe sich hier einreihen: Unser System 1 richtet sich die Welt zurecht und bügelt Dissonanzen weg, es macht die Welt nach dem Prinzip der kognitiven Leichtigkeit - ungleich kognitive Dissonanz, s. u. - „plausibel“, sodass sie uns mühelos erklärbar erscheint, und ignoriert Wahrscheinlichkeiten und Basisraten.) Kohärente Geschichten über uns selbst und die Welt (die wir unbewusst dauernd erzeugen, um die komplizierte reale Welt zu einer einfacheren subjektiven Welt zu machen) schaffen Selbstvertrauen, das aber - da ein Gefühl - nicht als Entscheidungsgrundlage ausreicht und zur Selbstüberschätzung führt. |
| ° | Tendenz zur Selbstüberschätzung: Menschen neigen zur Überschätzung der Vollständigkeit der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen und unterdrücken unbewusst Zweifel und Ambiguitäten bei der Bildung von Urteilen oder Einschätzungen. (Sie haben einen blind spot in Bezug auf ihre Unzulänglichkeit.) Wir verfahren nach der von Kahneman so genannten WYSIATI-Regel (what you see is all there is) so, als ob wir alles zur Verfügung hätten, was es zum jeweiligen Thema zu wissen gibt. Solange die „erzeugte“ Geschichte kohärent ist, spielen Menge und Qualität der zugrunde liegenden Informationen kaum noch eine Rolle. Deshalb leben wir in der Illusion über die Gültigkeit unserer Prognosen (oder der von Experten) und in der, dass unsere Planungen realistisch (planning fallacy; s. u.), unsere Einschätzungen richtig und wir kompetent seien (illusion of skill). Hingegen wäre das „[...] Diagnosekriterium für Kompetenz [...] die Konsistenz individueller Leistungsunterschiede.“ (Kahneman) |
| Selbstüberschätzung zeigt sich z. B. auch in der Tatsache, dass sich paradoxerweise mehr als 50% der Befragten für überdurchschnittlich gute Autofahrer halten oder 2020/21 virologisch und epidemologisch Ahnungslose während der COVID-Pandemie mit subjektiver Überzeugung „wussten“, welche Maßnahmen sinnvoll und welche falsch seien. Ein ähnliches Phänomen zeigt die Fähigkeit, die eigene Ignoranz zu ignorieren: der populärwissenschaftliche Dunning-Kruger-Effekt: Je inkompetenter eine Person, desto größer ist ihr Selbstbewusstsein, je uninformierter, desto höher die Selbstüberschätzung; nach David Dunning , *1960, und Justin Kruger, *1968?. (In einer experimentellen Befragung glaubten 2024 30% der Probanden - jüngere und männliche bis zu 40%! -, dass sie in einer von ihnen zu bestimmenden Sportart die Qualifikation für die Olympischen Spielen 2028 schaffen könnten.) Vgl. dazu Bertrand Russell, 1872-1970: „The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.“ oder Friedrich Dürrenmatt, 1921-1990: „Der Gläubige glaubt zu wissen, der Wissende weiß, dass er glaubt.“ oder den Liedtext von André Heller, *1947 / Helmut Qualtinger, 1928-1986: „Mia passt nix, was passt / I setz auf Ruin / geg'n mei Ignoranz gibt's ka Medizin.“ | |
| ° | Rosy retrospection: Im Gegensatz zu sonstigen Situationen (s. u.) erscheinen uns im Rückblick (im Übrigen aber auch im Hinblick auf uns selbst oder im Vorausblick bei der Planung von längerfristigen Projekten) die Dinge oft positiver als sie waren (sind). Die negativen Umstände verblassen. (Bspl.: Nach einer anstrengenden Bergtour erinnern wir uns nach Jahren kaum noch an die Qualen, viel eher jedoch an den Gipfelsieg und die schöne Landschaft; auch Fading Affect Bias FAB genannt.) Dieses „Zurechtrücken“ spielt auch eine Rolle bei der |
| ° | Narrative fallacy (narrative Verzerrung): von Nassim Nicholas Taleb (*1960) so bezeichnete Beobachtung, dass fehlerhafte, meist aber auf einfache Weise erklärende und daher unser (nicht nur logisches, sondern vor allem emotionales) Kohärenzbedürfnis (s. a. o.; „everything fits together“) erfüllende Geschichten über unsere Vergangenheit unsere Weltanschauungen und Zukunftserwartungen prägen. Menschen würden laufend fadenscheinige Berichte konstruieren und diese dann für wahr halten. (2019 glaubten z.B. nur 20% aller Deutschen, dass sich unter ihren Vorfahren welche befänden, die in der NS-Zeit schuldig wurden). Schon 1932 hat Frederic C. Bartlett (1886-1969) Erinnerung als Konstruktion betrachtet. (Auch Wahrnehmungen und übermittelte Informationen werden dadurch verzerrt, dass wir sie in narrative Muster, die von Chronologie und Kausalität bestimmt werden, übersetzen, sodass sie durch die Vortäuschung einer Ordnung, die es nicht gibt, für uns zugänglich werden; vgl. a. u. Desinformationseffekt.) - Vgl. auch den damit verwandten |
| ° | Hindsight Bias (Rückschaufehler): Verfälschung der Erinnerung im Laufe der Zeit, s. a. u. Bei Ex-post-Beurteilungen verzerrt sich die ursprüngliche Einschätzung eines Sachverhalts, man hat es „immer schon gewusst“. Vor allem der Outcome Bias ist stark wirksam. (Beispiel-Exe.: Die Erinnerung an eine vor Monaten von einer Person erstellten Wahlprognose wird von dieser ex post an das tatsächliche Ergebnis unbewusst angepasst. / Ärzte oder Politiker beurteilen ihre Entscheidungen nachträglich oft viel zu positiv, wenn das Ergebnis, der „Outcome“ - dies aber womöglich zufällig - positiv war.) |
| ° | Sunk cost fallacy (manchmal Dispositionseffekt genannt): bezeichnet die Neigung, sinnlos weiter in Verlustgeschäfte zu investieren, auch wenn die Variante, die bereits eingesetzten Mittel einfach verloren zu geben und Anderes zu beginnen, on the long run günstiger wäre. (Beispiele: Fortführen von Bauprojekten bei explodierenden Kosten, von zum Scheitern verurteilten Beziehungen, Aufrechterhalten von Arbeitsplätzen, die ohnehin verloren gehen werden etc.) Erklärung: Niemand möchte gerne ein Konto mit einem Minus schließen, auch wenn es ein „mentales Konto“ ist, man glaubt irrationalerweise zu lange an den Erfolg und will die Unausweichlichkeit der Verluste nicht wahrhaben (vgl. u. Prospect Theory). Ähnlich: |
| ° | Planungsfehlschluss: ist die Tendenz, bei größeren Projekten zur Verfügung stehende Daten und Informationen, die problematisch sind, zu ignorieren, unterzugewichten oder falsch einzuschätzen, sodass man in optimistischer Selbstüberschätzung (s. o.) in seiner Planung optimalen Szenarien unrealistisch nahe kommt. (Der Planungsoptimismus erfasst und berücksichtigt die Risiken nicht oder viel zu wenig.) |
| ° | Projektionsverzerrung: Menschen sind - da das bereits Bekannte im Vergleich zu dem noch Unbekannten mental näher liegt - prinzipiell schlecht darin, zukünftige Zustände zu beurteilen. Einerseits unterschätzen sie ihre Fähigkeiten, mit Veränderungen umzugehen, andererseits wird der Status quo Bias wirksam (gemäß dem man sich die Zukunft immer ähnlich - zu ähnlich - wie die Gegenwart vorstellt.) |
Dies alles sind Denkmuster, die nicht für den Gebrauch durch die Vernunft, sondern vor allem, um im praktischen Handeln erfolgreich zu sein, entstanden sind. Daher sind sie uns im Alltagsvollzug meist nicht bewusst und schwer aus- bzw. abzuschalten. Es liegen daher keine verwerflichen, unmoralischen Absichten zugrunde, wenn wir Informationen fehlerhaft verarbeiten (wie dies z. B. bei der Leistungsbeurteilung in der Schule in hohem Ausmaß der Fall ist), sondern unsere angeborenen und im Laufe der Evolution bzw. der Ontogenese ausgearbeiteten Denk- und Entscheidungssysteme. (Allerdings werden diese Phänomene von Dritten oft manipulatorisch ausgenützt; sie sollten schon deshalb viel häufiger bewusst gemacht werden.)
Wird gehandelt, ohne dass eine bewusste Entscheidung getroffen wird, kommen die angeborenen oder im Laufe des Lebens erworbenen „Voreinstellungen“ zum Tragen (Default Effect). Die Bevorzugung des Gegebenen zuungunsten von Optionen der Veränderung nennt man Status quo-Effekt.
Zu Wahrnehmungs- und Testfehlern s. a. u1., zu sozialen Effekten s. u2., zum Denken allgemein s. u3.
* Maßnahmen zur Verhinderung von Urteilsverzerrungen oder -verrauschungen (großteils nach Kahneman u. a.):
| ° | Sensibilität für Fehleranfälligkeit (Verzerrungen, Verrauschungen) von Urteilen wecken, um Verzerrungsblindheit (bias blind spot) zu verhindern |
| ° | Statistische Beurteilungsgrundlagen bewusst machen (statistisch denken: die Basisrate einberechnen, Vorhersagen am durchschnittlichen Ergebnis verankern etc.) |
| ° | Selbstüberschätzung durch Berücksichtigung von Außensichten (z. B. durch den Einsatz von externen Entscheidungsbeobachtern) vermeiden |
| ° | Das Problem nicht isoliert (aber isoliert von äußeren Einflüssen!), sondern als Element einer Referenzklasse ähnlicher Fälle betrachten. Sensitivere (relative) Vergleichsurteile statt (absolute) kategoriale Urteile fällen (z. B. in der Schule Arbeiten vor der Benotung gegeneinander abwägen statt einzeln in eine Skala von 1 bis 5 einordnen, eventuell verbunden mit Forced Ranking: die Notenverteilung steht schon vor der Beurteilung fest; die einzelnen Leistungen werden nur noch in eine relative Rangfolge gebracht und den vorgegebenen Graden zugeordnet. Vorteil: Level Noise wird dadurch vollständig beseitigt. Problem: die ex ante feststehende Verteilung muss nicht der realen Verteilung der Leistungsfähigkeit der Probanden entsprechen, vor allem dann nicht, wenn die geprüfte Gruppe relativ klein ist. Absolute und relative Leistungsfähigkeit können in verschiedenen Gruppen stark differieren.) |
| ° | Bei Verwendung von Skalen nicht zu viele Möglichkeiten anbieten (vgl. Die magische Zahl Sieben, plus oder minus zwei von George Armitage Miller (1920-2012; erschienen 1956; s. a. u.), strikte Leitlinien (Guidelines) beigeben und konkrete Fälle, die den einzelnen Stufen entsprechen, als Anker anbieten. (Leitlinien können Regeln - starr, die Entscheider/innen haben wenig zu tun - und/oder Standards - flexibel, die Entscheider/innen müssen exegetische Arbeit leisten - enthalten.) |
| ° | Aufteilen komplexer Entscheidungen in leichter zu handelnde Unterpunkte (wie z. B. beim Apgar-Test; s. u.). Dies verhindert, dass Einzelaspekte zugunsten eines im Grunde schon erstellten Gesamtbildes unter den Tisch fallen. |
| ° | Rechenschaftspflichten über das Zustandekommen und die Treffgenauigkeit von Urteilen einfordern (auch sich selbst gegenüber) |
| ° | Selektion: Menschen beurteilen lassen, die die dazu nötigen Voraussetzungen bereits bewiesen haben (Intelligenz, Sachkenntnis, Erfahrung etc. und v. a. die Bereitschaft zur aktiven Selbstwiderlegung; die Auswahl urteilsfähiger Personen erwies sich in Studien als eine der wirkmächtigsten Maßnahmen). |
| ° | Aggregation: Statt Einzelmeinungen zu vertrauen, (zusätzlich) Urteile bzw. Einschätzungen von vielen, die diese alleine ohne Austausch getroffen haben, einholen und dann zusammenführen bzw. mitteln (Schwarmintelligenz). Ex.: Viele Menschen sollen die Anzahl zahlloser gleichartiger Münzen, die in einem großen Glas liegen, schätzen: Bildet man den Durchschnitt der erhaltenen Ergebnisse, kommt man der Wahrheit meist näher als die überwiegende Anzahl der Einzelpersonen. Das Aggregieren unabhängig voneinander seperat gewonnener Einzelwerte dividiert die Verrauschung durch die Quadratwurzel der Anzahl der gemittelten Urteile (reduziert also Noise bei 100 Aussagen um 90%). In Bezug auf Urteile ist ja Genauigkeit, nicht der Ausdruck individueller Persönlichkeit gefragt. |
| ° | Bei Beurteilenden einen CRT = Cognitive Reflection Test (s. hier; entwickelt von Shane Frederick, *1968) anwenden, um den erwünschten kognitiven Stil sicherzustellen. CRTs und ähnliche Tests überprüfen, ob Personen zu (anzustrebenden) reflektiven oder zu (unerwünschten) impulsiven Antworten neigen. Wer die Frage, auf welchem Platz man liegt, wenn man während eines Marathonlaufes den Zweiten überholt oder die Fragen s. u. nicht richtig beantworten kann, hat ein mangelhaftes Urteilsvermögen, das womöglich auch sonst nicht kritisch prüft, sondern z. B. dazu neigt, der erstbesten Antwort oder Fake News aufzusitzen. („Bullshit-Empfänglichkeit“; der Ausdruck wurde 1986 im Essay On Bullshiting von Harry Gordon Frankfurt, 1929-2023, geprägt. Er bezeichnet - im Unterschied zu Lügen, die vorsätzlich täuschen wollen - „postfaktische“ Aussagen, für die Wahrheit keine Rolle spielt.) |
| ° | Steuerung (nötigenfalls Bremsung) des Informationsflusses: nur unumgängliche Informationen sollten zur Verfügung gestellt werden, um jede Beeinflussung des Urteils hintanzuhalten. (Die Beurteilung von Schülerarbeiten sollte z. B. im Idealfall ohne Kenntnis der Autorschaft erfolgen.) |
| ° | Voreilige intuitive Schlussfolgerungen (von selbst) aktiv in Frage stellen, Voraussagen und Schätzungen Richtung Mittelwert korrigieren (s. a. o.) |
| ° | Durchführung von Noise Audits (Projektstudien zur Bestandsaufnahme) mit dem Ziel, Bewusstsein für die Fehleranfälligkeit von Entscheidungen zu schaffen, die Art der Streuung offenzulegen und die jeweiligen Noise-Anteile zu identifizieren, die z. B. eine geringe Intra-Rater-Reliabilität nachweisen könnten (wenn ein Beurteiler in derselben Sache bei identischen Beurteilungsgrundlagen mit zeitlichem Abstand zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt). |
| ° | Delphi-Methode: Nach der unbeeinflussten Abgabe eines Urteils wird dieses in einer Runde mit anderen Beurteilenden diskutiert. Nach Anhörung bzw. Formulierung von Argumenten wird individuell neu geurteilt. (Es sind auch mehrere Runden möglich.) |
EINTEILUNG DES FORSCHUNGSGEBIETES DER PSYCHOLOGIE
Die unten stehende Einteilung geht auf den Wiener Psychologen Hubert Rohracher (1903-1972; er unterlag seinem Cousin, dem Salzburger Erzbischof Andreas Rohracher, 1892-1976, im Doktoratswettstreit 2:3) zurück, der das Gesetz der funktionalen Aktivierung formulierte: Die im Hintergrund wirkenden Kräfte setzen jeweils selektiv bestimmte Funktionen in Gang. (Es existieren zahllose weitere Einteilungen, die - wie die meisten Einteilungen - nicht immer die geforderten Kriterien der Ausschließlichkeit und der Vollständigkeit erfüllen.)
- Psychische
Kräfte:
Triebe, Gefühle, Interessen, Wille. Diese auch als
Hintergrundaktivität bezeichneten Impulsgeber setzen die Funktionen in Gang.
- Psychische Funktionen:
Lernen, Gedächtnis, Denken, Wahrnehmung. Sie treten in Erscheinung, wenn
die Kräfte sie aktivieren.
TÄTIGKEITSFELDER DER PSYCHOLOGIE
Im Folgenden werden zahlreiche Anwendungsgebiete psychologischer Forschung erwähnt bzw. beschrieben sowie die Wissenschaft der Psychologie in den Rahmen der angrenzenden Nachbarwissenschaften eingeordnet.
- Allgemeine Psychologie: beschreibt die unabhängig von individuellen Unterschieden bestehenden Gesetzmäßigkeiten im Erleben und Verhalten
- Differenzielle Psychologie: Psychologie der (Einzel)persönlichkeit (s. u.)
-
Experimentalpsychologie:
objektiver, naturwissenschaftlicher Zweig der (allgemeinen) Psychologie, der das
Erleben und Verhalten intersubjektiv überprüfbar beschreiben will (auch Erlebnispsychologie).
Enthält
Teilgebiete wie Neuropsychologie, grundlegende Lernpsychologie etc. Seit Ende
des 20. Jhdts. bekommt die Hirnforschung auf Grundlage der Neurobiologie eine immer größere Bedeutung.
Vgl.
Web-Labor
zur Experimentellen Psychologie
- Entwicklungspsychologie: stellt die psychischen Abläufe zwischen Geburt und Tod dar (s. u.)
- Sozialpsychologie: erfasst den Menschen als Teil und unter Einfluss der Gesellschaft (s. u.)
- Angewandte Psychologie: Die Anwendung der Forschungsergebnisse der Psychologie erfolgt im Alltag in den verschiedensten Kontexten / Bereichen (vgl. B.Ö.P.-Seite). Steht eine an der Nützlichkeit orientierte Diagnose oder Intervention in einem bestimmten Fall im Mittelpunkt, spricht man von Praktischer Psychologie. Sie entwickelt Lösungen für konkrete Fragestellungen.
Beispiele für Anwendungsfelder:
| ° | Klinische Psychologie, Psychotherapie (s. u.) und Krisenintervention (s. u.): Über 40% aller Psychologen arbeiten im medizinischen Umfeld (z. B. Klinisch-psychologische Ambulanz AKH). S. a. u. Psychologische Diagnostik |
| ° | Lehre: Die Unterrichtenden an Schulen und Universitäten stehen zahlenmäßig an 2. Stelle. |
| ° | Kriminalpsychologie: Sie erforscht die Grundlagen und Korrelate devianten Verhaltens, z. B. die „mörderische Trias“, gemäß der sehr viele Gewalttäter schon in ihrer Kindheit und Jugend durch die Kombination der (aller drei!) Verhaltensweisen Bettnässen, Brandstiften und Tierquälerei auffallen bzw. schwer beeinflussbare Hirnveränderungen aufweisen. |
| Besondere (mediale) Aufmerksamkeit erfahren Amokläufer - die der US-Psychologe Peter Langmann (*1960) in psychopathische (meist narzisstisch, sadistisch, aggressiv, mit stabilem Elternhaus), psychotische (meist realitätsfern, halluzinierend, mit stabilem Elternhaus) und traumatisierte (meist mit familiärer Gewalterfahrung und krimineller Vorgeschichte) Täter einteilt, und Attentäter, deren Entwicklung meist fünfstufig verläuft: Einem persönlichen Ausgangserlebnis (z. B. einer Kränkung; s. u.) folgt die Entwicklung eines gedanklichen Handlungsablaufes, die Phase der Planung und Vorbereitung und die Detailplanung (mit eventuellem Expositionstraining, um die Frage, wie weit man an das Opfer herankommt, und das Vorhandensein von Sicherheitsvorkehrungen zu prüfen). Die letzte Phase ist die der Durchführung. | |
| Prinzipiell unterscheidet man 3 Ursachenkomplexe: akute Auslöser wie z. B. Mobbing, die leichte Verfügbarkeit von Waffen und zugrunde liegende psychische Erkrankungen. Treffen alle drei Voraussetzungen gleichzeitig zu, ist die Situation brandgefährlich. „Amok“ in der ursprünglichen - malaiischen - Wortbedeutung bezeichnet laut DSM - s. u. - nur dreiphasige Taten (sozialer Rückzug - eruptive Gewalthandlung - Depression mit Erinnerungslücken, ev. Suizid), die in Furor, Rage und Wut - also nicht geplant, sondern impulsiv - begangen werden. In anderen Fällen sind Begriffe wie „Attentat“, „Massaker“, „School Shooting“ oder, wenn durch radikalisierte Täter Angst und Schrecken, womöglich mit einer politischen Komponente, ausgelöst werden soll, „Terroranschlag“ zutreffender. | |
|
Andere Aufgaben der Kriminalpsychologie: Profiling (Erstellung
eines Persönlichkeitsbildes unbekannter Täter; wird auch von Head Huntern in
der Wirtschaft eingesetzt), Beratung bei Geiselnahmen, Durchführung von
Anti-Gewalt-Trainings, Maßnahmen zur
Deradikalisierung (z. B. durch die Organisation
DERAD) etc. Vgl. z. B. auch Das Erstellen von Täterprofilen bei Serienmorden, Serienmörder - Ursachen und Entwicklung extremer Gewalt, Serial Killers, Schweizer Gesellschaft für Rechtspsychologie |
|
| ° | Forensische Psychologie: Befasst sich mit Diagnose, Behandlung und Unterbringung psychisch kranker Straftäter und inkludiert Gerichtspsychologie (inkl. Gutachtenerstellung), Gefängnispsychologie, Maßnahmenvollzug nach § 21 StGB in forensisch-therapeutischen Zentren für nicht zurechnungsfähige Täter/innen ohne Diskretions- und Dispositionsfähigkeit (s. § 11 StGB) mit schwerwiegenden und überdauernden psychischen Störungen, die ihnen nicht oder nur teilweise erlauben, den Unrechtsgehalt ihrer Delikte erkennen zu können und deren Taten - Ausnahmen ausgenommen - mit einer Strafe von 3 Jahren oder mehr bedroht sind - früher „Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher“ genannt; aus ihnen kann man nur entlassen werden, wenn die Ungefährlichkeit - meist nach erfolgreicher Therapie, manchmal aus Alters- oder Krankheitsgründen - garantiert erscheint. |
|
Besonderes Augenmerk wird auch auf die Folgebetreuung nach der Haftentlassung
gelegt. Organisationen wie z. B. Neustart (s.
hier) bieten Bewährungshilfe mit dem
Ziel, die in Österreich mit ca. einem Drittel hohe Wiederverurteilungsquote zu
senken. Vgl. z. B. Institut für forensische Psychiatrie Berlin, Forensik Wien, Forensik- und Traumadiagnostik-Ambulanz AKH, Forensik Austria |
|
| ° | Industriepsychologie, Betriebspsychologie (Arbeits-, Berufspsychologie): wurde von der Erfinderin des Tretmistkübels Lillian Gilbreth (1878-1972) begründet und studiert das Verhalten des Menschen im Erwerbsumfeld. (Dieses Feld und alle Bereiche, die das Erleben und Verhalten im ökonomischen Kontext untersuchen - wie die drei folgenden - werden auch als Wirtschaftspsychologie bezeichnet.) |
| ° | Organisationspsychologie: wendet sozialpsychologische Erkenntnisse durch Coaches, Unternehmens- bzw. Managementberater/innen etc. auf staatliche oder private Organisationen an |
| ° | Berufsberatung: Sie versucht durch Potentialanalysen, Talentechecks und ähnliche Tests die Eignungen der Klienten mit den Angeboten des Arbeitsmarktes zu synchronisieren. |
| ° | Werbe- und Marktpsychologie: Beschreibt die Methoden persuasiver Kommunikation (s. u.) und entwickelt Werbewirkungsmodelle für die politische Werbung und die Produktwerbung. Eine der ersten diesbezüglichen Theorien (zur Rolle der Emotionen) stammt vom Begründer des Behaviourismus Watson (s. u.). Das altbekannte (1898) - Elmo Lewis (1872-1948) zugeschriebene - AIDA-Modell (Erzeugen von Attention - Interest - Desire - Action) wird von Involvement-Modellen ergänzt. Diese zielen auf Festigung einer Markenbeziehung durch positive Produkterfahrungen der Konsumenten ab. Verhaltenswirkungen einer Kaufentscheidung und Verwendungserfahrungen bewirken nach dieser Theorie eine nachhaltige Kundenbindung. Dauerhafte kognitive und emotionale Gedächtniswirkungen sind hier wichtiger als oberflächliche momentane Wirkungen wie Aufmerksamkeit, die nur am Beginn eines Kaufvorganges motiviert. Die Werbepsychologie weist daher auch auf die Peak-End-Regel hin, nach der das Ende einer Erfahrung - Kauf, Hotelaufenthalt etc. - die Konsumenten stärker beeinflusst als der Beginn oder der Verlauf. |
| Weitere Aspekte: Die Werbepsychologie berät Geschäfte in Bezug auf die Anordnung ihrer Waren in den entsprechenden Bereichen: von oben nach unten unterscheidet man Streckzone, Blickzone, Greifzone und Bückzone (z. B. gemäß einer „Psychologie im Supermarkt“ - s. z. B. hier -, gemäß der man gegen den Uhrzeigersinn geführt wird, da sich die meisten Menschen dann wohler fühlen, und Waren, die ohnehin gekauft werden müssen, eher links unten bzw. hinten platziert werden, um den gesamten Weg abgehen zu müssen) und untersucht anderes mehr. Die Anwendung der Erkenntnisse erfolgt sowohl in der Produktwerbung wie auch in der politischen Werbung. Paradox erscheint das Auswahlparadoxon (Overchoiceeffekt), nach dem zu viele Möglichkeiten die Menschen unglücklich machen. Sie haben dann das Gefühl, sich womöglich für etwas Falsches entschieden und/oder etwas versäumt zu haben und damit Angst vor zukünftigem Bedauern. Ein Ex. von Sheena Iyengar (*1969), einer blinden kanadisch-US-amerikanischen Entscheidungstheoretikerin, und Mark R. Lepper (*1944) wies nach, dass Konsumenten im Supermarkt weniger Marmeladen kaufen, wenn ihnen mehr angeboten werden. (3% bzw. 30% entschieden sich für einen Kauf, wenn 28 bzw. nur 6 Sorten verfügbar waren. Später wurde diese Entscheidungsschwäche menu anxiety genannt: je mehr zur Auswahl steht, desto schwieriger wird die finale Entscheidung.) | |
| In der US-Politik wird auf Grundlage der alten Erkenntnis, dass Branding oft eher zu (Kauf)entscheidungen führt als der objektive Produktvergleich der Konsumenten, bereits Neuromarketing eingesetzt: Passgenaue Werbebotschaften werden als Neurotargeting aufgrund von Datenanalysen erzeugt. (Z. B. wurde im Ex. die Ausstrahlung des Gesichts eines potentiellen Kandidaten vorgetestet, da sich diese für die Wahl als wichtiger erwies als die vertretenen politischen Inhalte. Nach der Abstimmung lebten die Wähler/innen in der Illusion, sich selbst entschieden zu haben. Die Manipulation wurde gar nicht als solche empfunden, die Entscheidung im Nachhinein rationalisiert.) | |
| (Vgl. z. B. auch Einführung in die Werbelehre, Seiten über Werbepsychologie oder Werbewirkungsmodelle, und Marketing-Glossar; zu Überredungsmethoden s. u.) | |
| ° | Medienpsychologie: untersucht die kognitiven, emotionalen und verhaltensmäßigen Wirkungen von Medien auf die Rezipienten. Die Medienwirkung (Veränderungen im Erleben, Denken und Verhalten, speziell unter gezielter Manipulation) ist genauso Thema wie die Mediennutzung. (S. a. u. und vgl. hier) |
| ° | Schulpsychologie, Pädagogische Psychologie und Erziehungsberatung: beschäftigt sich mit Verhaltensauffälligkeiten und allen anderen Problemen im Zusammenhang mit Jugendlichen |
| ° | Lernpsychologie (s. u.) |
| ° | Sportpsychologie: sie schult z. B. den Umgang mit Druck, Belastung und Entspannung, will die Konzentrationsfähigkeit fördern und arbeitet mit mentalem Training (einer systematischen und intensiven „Mentalakrobatik“: Bewegungsabläufe werden unter der Voraussetzung der Vorstellungsfähigkeit, der so genannten Imagery, mit dem Ziel ihrer Verbesserung intensiv ideomotorisch - nicht beobachtend - gedanklich möglichst wirklichkeitsnah durchgegangen, ohne dass die Bewegung selbst ausgeführt wird; erste Ansätze schon vor dem 2. Weltkrieg) u. a. m. |
| ° | Lebensberatung (Tätigkeit als Coach ohne therapeutische Implikation) |
| ° | Verkehrspsychologie: berät in allen Angelegenheiten der Mobilität, versucht Unfälle durch prophylaktische Maßnahmen zu verhindern und den Akteuren bzw. deren Organisationen bei Bedarf Hilfestellungen zu leisten. |
| ° | Religionspsychologie: untersucht Gründe und Erscheinungsformen der Spiritualität individueller Menschen |
| ° | Heerespsychologie (Wehr-, Militärpsychologie): die erste angewandte psychologische Sparte (entstanden im 1. Weltkrieg). Ihre Themen sind die seelischen Belastungen während eines Krieges bzw. die psychischen Eignungskriterien für den Wehrdienst. |
| ° | Völkerpsychologie (Begriff von Wilhelm von Humboldt - s. u. -, betrieben u. a. von Wundt - s. o. - und analytisch von Parin - s. u.): postulierte ursprünglich homogene, auf der gemeinsamen Sprache beruhende psychische Strukturen innerhalb einzelner Ethnien und interessierte sich im weiteren Verlauf unter Verlust ihrer Bezeichnung für sozialanthropologische Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Seelenleben. |
| ° | Tierpsychologie (s. u.) u. a. m. |
- Nachbarwissenschaften:
| ° | Physik: Sie untersucht, ausgehend von den Reizen, die Beschaffenheit der in Frage stehenden materiellen Gegebenheiten und Prozesse. Die Verbindung mit der Psychologie (zuständig für die seelischen Prozesse) heißt (äußere) Psychophysik und wurde 1860 von Gustav Theodor Fechner (1801-1887) als Lehre von den Zusammenhängen zwischen objektiven (die messbare physikalische Intensität betreffenden) und subjektiven (die wahrgenommene Reizstärke betreffenden) Größen, wie z. B. Geldbeträgen und einer subjektiven Nutzeneinschätzung, begründet; s. u. |
| ° | Physiologie: Sie untersucht, ausgehend von der Erregung, die körperlich ablaufenden Vorgänge (die organischen Prozesse) während einer durch Reize ausgelösten Stimulation. Die Verbindung zur Psychologie nennt man Neuropsychologie (auch innere Psychophysik): sie erforscht die biologischen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens). Die Beziehung zwischen physikalischem Reiz und physiologischer Erregung wird von der Neuro- oder Sinnesphysiologie (einem Teilgebiet der Medizin) untersucht. |
| ° | Psychologie: Sie untersucht, ausgehend vom Erleben, welche subjektiven Zustände von Reiz und Erregung ausgelöst werden. |
Nach Stanley Smith Stevens (1906-1973) ergeben sich aus den möglichen drei Konstellationen
3 Problemtypen:
| ° | der der Beziehung zwischen Reiz und Erleben (äußere Psychophysik: untersucht z. B. das Schätzen von Strecken, die in der Vertikalen ca. 7% länger erscheinen als in der Horizontalen) |
| ° | der der Beziehung zwischen Physiologie und Erleben (innere Psychophysik: untersucht z. B. den Zusammenhang zwischen Blutalkoholgehalt und Betrunkenheitsgefühl) |
| ° | der der Beziehung zwischen Erleben und Erleben: untersucht die Zuordnung zweier oder mehrerer subjektiven Variablen, z. B. in einem 1965 durchgeführten Ex. von Gösta Ekman (1920-1971) and Oswald Bratfisch (1940-2018), in dem der Einfluss des Grades emotionaler Anteilnahme an diversen Städten mit der subjektiven Schätzung der Entfernung dieser Städte von der Heimatstadt der Vpn. in Verbindung gebracht wurde; vgl. a. u. unter „social perception“. |
RICHTUNGEN UND SCHULEN
Im Laufe der Geschichte haben sich verschiedene (einander widersprechende,
ergänzende, nicht immer unvereinbare) Grundausrichtungen bzw. methodische
Herangehensweisen an das Forschungsgebiet der Psychologie herausgebildet (und
einander tw. abgelöst). Die ersten beiden erwähnten stehen als Gegensatz am
Beginn der wissenschaftlichen Psychologie Ende des 19. Jahrhunderts.
Vgl. a.
Psychologische Konzeptionen, What
is Psychology? oder
Überblick über die Geschichte der Psychologie (Namedropping)
- Strukturalismus:
Menschliches Erleben und Verhalten resultiert aus der Struktur des aus
verschiedenen Elementen zusammengesetzten Geistes. Dieser systematische
Zusammenhang verhindert ein Betrachten des Untersuchten als isoliertes
Einzelphänomen. (Der Strukturalismus ist die von Wundt,
s. o., vertretene Richtung; sie fragt nach
dem Ist, nicht nach dem Wozu.)
- Funktionalismus:
Die Psyche wird als funktionalistisches System gesehen, das im Dienste von etwas
(z. B. von Bedürfnissen) steht und daher jeweils einen Zweck erfüllt. (Der
Funktionalismus ist in den USA als Gegenbewegung zum Leipziger Strukturalismus
entstanden und wird auch Aktpsychologie genannt, da die Vorgänge im Mittelpunkt
stehen.)
- Introspektionismus:
Aussagen der Menschen über sich selbst und ihr Innenleben werden zugelassen (Erlebnispsychologie;
abgeleitet vom lateinischen Wort für „hineinschauen“). Unter
Introspektion versteht man im engeren Sinne die unmittelbare Erfassung und
Beschreibung des eigenen Erlebens und eigener Bewusstseinsvorgänge, im weiteren Sinne kann die
Selbstbeobachtung als kontrollierte Introspektion durch andere, die systematische
Berichte und sekundär auswertbare Aufzeichnungen verwendet, verstanden werden.
Auch literarische Erlebnisberichte, wie z. B. Ist das ein Mensch von Primo
Levi (1919-Suizid 1987),
weiter leben von Ruth Klüger
(1931-2020), Im Keller von Jan
Philipp Reemtsma,
(*1952; s. a. u.)
oder Knife. Meditations After an Attempted Murder (ersch. 2024) von Salman
Rushdie (*1947) kann (könnte)
man psychologisch auswerten
(wenn sie dies nicht selbst schon tun).
- Behaviourismus:
Selbstaussagen werden nicht zugelassen (bzw. selbst nur als wahrnehmbare
Reaktionen betrachtet). Wichtig ist das Was: Input und Output (nur das
Beobachtbare) werden systematisch, strukturiert und planmäßig fremdbeobachtet
und protokolliert. Unwichtig sind die als unbeantwortbar geltenden Fragen nach
dem Wie und dem Warum. Der Mensch wird als black box, die nach dem
S => R
(= stimulus-reaction)-Prinzip funktioniere, betrachtet. Würde man alle Reize
kennen, könne man alle Reaktionen prognostizieren. Der Behaviourismus
(abgeleitet vom englischen Wort für „Benehmen, Verhalten“) wurde auch „Psychologie ohne Seele“ genannt. (Näheres
s. u.; eine verwandte
deterministische Weltsicht hat 1814 schon Pierre-Simon Marquis
de Laplace,
1749-1827, formuliert: sein fiktiver Dämon könne die Vergangenheit verstehen und
die Zukunft errechnen, wenn alle Initialbedingungen bekannt seien.)
- Tiefenpsychologie:
Dieser von Eugen
Bleuler
(1857-1939) geprägte Begriff bezeichnet vor allem die von Freud (s. u.) geprägte
Psychologie des Unbewussten (nicht von allen anerkannt). Man unterscheidet
aus heutiger Sicht (die Terminologie schwankt):
* Bewusstes (s. a. u.1 und u.2): „Bewusstsein ist das subjektive Erleben unseres Geistes und der Welt“ (David Chalmers, *1966), nach Erwin Schrödinger (1887-1961) „die Gesamtheit aller aktiven Lernprozesse“. Es besteht also in jeder Art individueller Erfahrung und enthält jene Inhalte, die gerade präsent sind, z. B. wahrgenommene Reize oder Vorstellungen, solange sie wichtig bzw. neu genug waren, um die Bewusstseinsschwelle zu überschreiten. (Dies wird innerhalb kürzester Zeit von System 1 - s. u. - entschieden. Die Reaktion darauf nennt man Orientierungsreflex bzw. Orientierungsreaktion; sie ist im EEG - s. u. - an plötzlich auftretender Beta-Aktivität zu erkennen und verschwindet durch Habituation / Gewöhnung an den Reiz wieder. Bei Reizveränderung erfolgt eine Dishabituation.) Die Bezeichnung für den subjektiven Erlebnisgehalt eines (objektiv fassbaren) Reizes ist Quale, Mz. Qualia. (Zum Beispiel ist der Eindruck einer bestimmten Farbe mit mentalen Zuständen assoziiert und „fühlt sich“ nach Thomas Nagel, *1937, „auf eine bestimmte Weise an“; vgl. seinen Aufsatz von 1974: How it is to be a bat.) Bewusstsein ist also ein durch gereizte Neuronen erzeugter Geisteszustand und enthält zwei Aspekte: den psychologischen der Reizverarbeitung im Gehirn (awareness) und den phänomenalen des Selbstbewusstseins und der Qualia. Nach Chalmers superveniert bewusstes Erleben (womöglich als einziges Phänomen) nicht logisch über etwas Anderes, ist also eine emergente Erscheinung. (Existierte diese Supervenienz, müsste sich die Neuronenreizkonfiguration ändern, sobald sich das Bewusstsein ändert.)
Das Bewusstsein kann durch Schlaf, Sedativa und Anästhetika eingeschränkt oder vollständig unterdrückt werden. Zu beachten ist, dass es nicht ganz trivial ist, den Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Kognition neurobiologisch festzulegen (vgl. z. B. u. IAT-Tests). Die Bewusstseinszugänglichkeit eines Reizes nennt man Salienz. Von ihr hängt ab, worauf sich die Aufmerksamkeit richtet. Der US-amerikanische Mitbegründer des philosophischen Pragmatismus William James (1842-1910; Bruder des Schriftstellers Henry James, 1843-1916) prägte den Ausdruck vom „Bewusstseinsstrom“, der sich dauernd ändere und nicht gemessen werden könne. Körper und Geist seien dabei als zusammengehörige Teile eines einheitlichen Organismus zu betrachten (vgl. a. u. Leib-Seele-Problem), „I“ (der eigene Bewusstseinsstrom) und „Me“ (die reflektierbare Identität) werden unterschieden.
* Unbewusstes: Inhalte, die auch theoretisch nicht bewusst werden können, z. B. alles, was außerhalb der Großhirnrinde abläuft (und einige Hirnvorgänge innerhalb des Kortex), alle Prozesse beim Fötus und beim Kleinkind (infantile Amnesie), Wahrnehmungen, die außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus liegen oder stark konsolidierte Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses (s. u.), dessen Details nicht (mehr) bewusst sind (z. B. beim Klavierspielen oder Radfahren).
* Vorbewusstes (manchmal auch „Unterbewusstes“ genannt; s. u.): Langzeitgedächtnisinhalte, die einmal bewusst waren, aktuell zwar „abgerutscht“ sind, theoretisch aber bewusst gemacht werden können; z. B. Verdrängtes; entspricht in Freuds Terminologie dem Unbewussten. (In diesem Zusammenhang: die Intuition „flüstert ein“, das Bauchgefühl (dessen Zentrum die bei Frauen größere und aktivere Insula ist) „drängt“ zu etwas.)
* Mitbewusstes: Inhalte, die ohne Gedächtnisleistung immer verfügbar sind, an die aber gerade nicht gedacht wird (z. B. der eigene Name)
Man nimmt heute an, dass dem Menschen nur weniges von dem bewusst ist, was sein Fühlen, Denken und Handeln lenkt. Sigmund Freud (1856-1939) nannte die Tatsache, dass der Mensch einsehen müsse, nicht Herr im eigenen Bewusstseinshaus zu sein, die „dritte Kränkung“ (s. a. u.) des Menschen (nach der ersten durch Nikolaus Kopernikus, 1473-1543, die ihn aus dem Zentrum der Welt, und der zweiten durch Charles Darwin, 1809-1882, die ihn als Krone der Schöpfung entfernt hatte).
- Gestaltpsychologie:
geht (s. u.) von
der Grundannahme aus, dass ein Ganzes nicht nur aus seinen Teilen erklärt werden
könne.
Ihr entsprang die Feldtheorie (topologische Psychologie, Vektorpsychologie):
Psychische Prozesse, denen Feldprozesse im Gehirn entsprächen, seien
zielgerichtet und eine Funktion des jeweiligen Lebensfeldes, dessen Regionen
unterschiedliche Valenzen mit Aufforderungscharakter enthielten. Das konkrete
Verhalten (Lokomotion) sei vektorpsychologisch als Resultante der anziehenden
bzw. abstoßenden Feldkräfte darstellbar. Personen müssen nicht aufgrund
individueller Unterschiede, sondern im Kontext ihres gesamten Lebens beurteilt
werden.
- Kognitive Psychologie:
versucht seit der „kognitiven Wende“ in den 50er-Jahren (s. u.), als sich der
Fokus der Psychologie vom Verhalten den mentalen Vorgängen zuwandte, in Modellen zu beschreiben,
wie menschliche Informationsverarbeitung funktioniert. Sie ist am Zusammenhang von Wahrnehmung, Lernen und Denken interessiert. (Vgl.
das informative Lernprogramm Einführung in die Kognitive Psychologie)
- Humanistische Psychologie:
will die Selbst- und Sinnverwirklichung fördern, interessiert sich für die in der
Person jeweils vorhandenen Ressourcen (s. u.)
- Parapsychologie:
aufgrund ihrer Nähe zur Esoterik
umstritten;
will (noch) nicht erklärbare „übersinnliche“ bzw. okkulte Phänomene im Bereich
der ASW (Außersinnliche Wahrnehmung; englisch extrasensory
perception ESP) wie Psychokinese
(gedanklicher Einfluss auf Materielles),
Präkognition (Wahrsagen), Clairvoyance (paranormalen Wissenserwerb, Hellsehen)
oder Telepathie (Gedankenübertragung) untersuchen (vgl.
Österreichische Gesellschaft füe
Parapsychologie oder
Parapsychologie). Als Beispiel für Psychologen, die die
empirische Naturwissenschaftlichkeit verlassen, kann Ken
Wilber (*1949) dienen, der Psychologie,
Spiritualität und Religion verbindet und in einer integralen Theorie ein Modell des Menschen als Bestandteil
des Kosmos entwirft.
- Biologische Psychologie und
Psychopathologie:
untersucht den Zusammenhang der Psyche mit ihren körperlichen Grundlage
bzw. krankhafte Abweichungen.
Vor allem seit der rasanten Entwicklung der Neurowissenschaften gegen Ende des
20. Jhts. gewann sie zunehmend an Bedeutung. Sie erklärt das Bewusstsein als Funktion von
Vorgängen im ZNS (s. u.)
und betont die physiologisch-chemischen Prozesse beim Zustandekommen von
Erleben.
METHODEN DER PSYCHOLOGIE
Vgl. Seiten von Werner Stangl (*1947)
- Prinzipielle Unterscheidungen:
| ° | Subjektive Methoden: beruhen auf Selbstbeobachtung, der Wiedergabe von Erlebnissen usw. Nachteile: oft große Anzahl an Vpn. erforderlich; in der Tier- und Kinderpsychologie nur bedingt verwendbar |
| ° | Objektive Methoden: beruhen auf Fremdbeobachtung, sind leichter messbar und intersubjektiv überprüfbar (z. B. Laborbeobachtungen, etwa - s. u. - in der Skinner-Box). Nachteil: manchmal aufwändig |
- Statistik:
* Definitionen: Wichtige Instrumente der
psychologischen Forschung sind die Statistik (Lehre von der Behandlung
quantitativer Informationen) und die Stochastik („Kunst des Vermutens“,
Statistik + Wahrscheinlichkeitstheorie). Man unterscheidet:
| ° | Deskriptivstatistik: sie beschreibt Vorhandenes und stellt in Tabellen und Grafiken Kennzahlen dar (auch empirische Statistik) |
| ° | Inferenzstatistik: sie schließt rebus sic stantibus - vorbehaltlich unvorhersehbarer Entwicklungen - aus den Daten einer Stichprobe auf die Gesamtheit bzw. auf zukünftige Entwicklungen (auch induktive Statistik) |
| ° | Explorationsstatistik: sie versucht, das Bemerkenswerte, Auffällige und Besondere zu erfassen und generiert Hypothesen (auch analytische Statistik) |
* Korrelationskoeffizient: ist das erstmals von Francis Galton (1822-1911; s. u.) verwendete Maß des linearen Zusammenhanges zweier Variabler, der mit klein r bezeichnet wird (und nicht kausal sein muss!). Er bewegt sich von minus 1 (negativer Zusammenhang; in der graphischen Darstellung im Koordinatensystem liegen alle Punkte auf einer Linie, die normal zur Winkelsymmetrale steht) über 0 (kein Zusammenhang; die Punkte sind zufällig angeordnet) bis zu plus 1 (vollständiger Zusammenhang; alle Punkte liegen auf der Winkelsymmetrale). Durch Quadrieren der Zahl hinter dem Komma erhält man den prozentuellen Zusammenhang (r = 1: Zusammenhang ist 100%, r = 0.6: 36%, r = 0.5: 1/4).
Um einen Einzelfaktor nachzuweisen, benötigt man Ceteris-paribus-Bedingungen („unter ansonsten identischen Voraussetzungen“). Zu beachten ist, dass Korrelation keine Garantie für Kausalität bedeutet. (Einerseits könnte ein Henne-Ei-Problem bestehen, andererseits besteht die Möglichkeit, dass beide in Zusammenhang gebrachten Variablen durch einen dritten Faktor beeinflusst werden: z. B. gibt es mehr Fahrradunfälle, wenn die Zahl der Schwimmbadbesuche ansteigt; beides ist auf erhöhte Außentemperaturen und nicht wechselweise aufeinander zurückzuführen.)
Die Berechnung erfolgt zunächst durch Ermittlung des Mittelwerts und der Standardabweichung für jedes Merkmal. Nach der Subtraktion des Mittelwerts von jedem Beobachtungswert wird die Differenz durch die Standardabweichung dividiert. Dadurch normiert man den Wert der Kovarianz (des durchschnittlichen Produkts der Abweichungen beider Merkmale von ihrem Mittelwert) auf den Bereich zwischen minus 1 und plus 1. Korrelation ist also die standardisierte Kovarianz, die das eigentliche Maß für den linearen Zusammenhang zweier Variabler ist.
Im Koordinatensystem lassen sich die einzelnen Fälle graphisch darstellen (1. Variable = x-Achse, 2. Variable = y-Achse). Hier werden die Zusammenhänge zwischen Körpergröße und -gewicht (A; deutlicher Zusammenhang), Schnelligkeit (in einem 10km-Lauf) und Körpergewicht bzw. BMI (B; deutlicher negativer Zusammenhang) und Intelligenz und Körpergewicht (C; kein Zusammenhang, Zufallsverteilung) dargestellt:

Abb. 1/2: Korrelationen (Fallverteilung geschätzt; © Thomas Knob)
* Irrtumswahrscheinlichkeit: Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird mit klein p bezeichnet; sie soll kleiner als ein Signifikanzniveau von 0,05 sein.
* Modalwert, Mittelwert, Median: Um Statistiken richtig interpretieren zu können - also die aus ihnen abgeleiteten Aussagen relevant werden zu lassen - müssen diese drei Maße der zentralen Tendenz auseinandergehalten werden. Am Beispiel einer Liste der ermittelten Intelligenzquotienten von 25 Schülern einer Gymnasialklasse erläutert (s. Linie unten): Der Modalwert ist der am häufigsten auftretende Wert (im Beispiel also 105), der Mittelwert entsteht durch die Division der Addition sämtlicher vorliegender Werte durch die Anzahl der untersuchten Personen (hier 107), der Median ist jener Wert, der das Sample der untersuchten Personen in zwei Hälften teilt (also 104).
| 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 | 116 | 118 | 120 | 130 | 145 |
| |__ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _|__ | ___ | ___ | ___| | ___ | ___ | ___ | |__ | ___ | ___ | ___ | ___ | __| |
Abb. 1/3: Vollständige Stichprobe der ermittelten
Intelligenzquotienten einer Schulklasse (fiktiv)
Die roten Striche zeigen den Median, den Modalwert und den Mittelwert an
(v. l. n. r.).
* Streuung: Nicht jeder Wert produziert brauchbare Aussagen. Der Satz: „Im Durchschnitt hat jeder Mensch 0,5 Y-Chromosomen“ erscheint z. B. genauso sinnlos wie die ebenfalls wahre Aussage: „Die meisten Menschen haben überdurchschnittlich viele Beine“, der Satz „Diese Schulklasse wiegt im Durchschnitt 50,8 kg“ gibt ein völlig falsches Bild, wenn z.B. 12 Kinder 30 kg und die anderen 13 70 kg wiegen. Wichtig ist es daher, auch die Variationsbreite der zur Verfügung stehenden Daten zu berücksichtigen (Streuung, engl. range). Die berechnete Maßzahl für die Streuung der Daten um den Mittelwert nennt man Standardabweichung. (Sie wird von der Varianz - dem Mittelwert der Quadrate minus dem Quadrat des Mittelwerts - abgeleitet, die durch Quadrieren jeder einzelnen Abweichung vom Mittelwert errechnet wird. Die Quadratwurzel des Durchschnitts dieser quadratischen Abweichungen, also der Varianz, ist dann die Standardabweichung.) Der MQF (mittlerer quadratischer Fehler) ist jenes Maß, mit dem die Voraussagegenauigkeit gemessen wird (je kleiner, desto besser).
Wenn Stichproben der Größe nach geordnet sind (wie z. B. u. bei der Intelligenzkurve), dann kann man die Abweichung auch mit dem Interquartilabstand angeben. Er zeigt jenen Bereich an, in dem die mittleren 50% der Daten liegen (im Beispiel irgendwo zwischen 90 und 110).
* Stichproben: Ihre Auswertung dient dazu, auch dann (Vor)aussagen treffen zu können, wenn es unmöglich ist, das Gesamtsample (z. B. alle Wähler einer Nationalratswahl) zu testen oder zu befragen. Stichproben müssen (um die Schwankungsbreite zu minimieren) groß genug und im Hinblick auf die zu untersuchende Bevölkerungsgruppe (oder die Gesamtbevölkerung) repräsentativ (nicht verzerrt) sein. Ist dies nicht der Fall, spricht man von Selection Bias. Anzustreben ist statistische Signifikanz getroffener Aussagen, die überzufällig ist. (Je kleiner die Zahl, desto größer die Schwankungsbreite: Würfelt man mit einem ungezinkten (idealen) Würfel nur 6mal, ist die Wahrscheinlichkeit einer gleichmäßigen Verteilung der 6 möglichen Fälle gering, würfelt man 60 000mal, wird die Abweichung sehr klein sein.) Die Genauigkeit einer Schätzung nimmt mit der Quadratwurzel des Stichprobenumfangs zu. (Die ersten 25 Messungen tragen also genauso viel zur Erkenntnis bei wie die nächsten 75.)
Zur Statistik vgl. folgendes Glossar
- Experiment (Ex.):
Ein Experiment (Ex.) besteht in der
Herstellung und systematischen Variation von Bedingungen, die es ermöglichen, einen Vorgang möglichst
isoliert (ohne Störungen und unter Ceteris-paribus-Bedingungen) und beliebig oft zu beobachten,
wobei das Ergebnis in Zahlen
darstellbar sein soll. Man unterscheidet zwei Stellgrößen: die abhängigen Variablen (die, die man messen möchte) und
die unabhängigen Variablen (die, die man verändert, um deren Einfluss auf die
abhängigen Variablen zu untersuchen). Besteht zwischen ihnen kein
Zusammenhang, spricht man von einer Nullhypothese. (Beispielex:
Es wird die unabhängige Variable Alkoholzufuhr bei Vpn. systematisch verändert,
um die abhängige Variable Konzentrationsfähigkeit bei einer Bildschirmaufgabe zu
messen. Ergebnis: Die Aufgabe gelingt umso schlechter, je mehr Alkohol zugeführt
wurde. Folgeanwendung z. B.: Verbot, Autos unter Alkoholeinfluss zu lenken.)
Man unterscheidet Erlebnisexperimente (z. B. Feststellen der Hörschwellen), Leistungsexperimente (z. B. Wiedergabe erlernter sinnloser Silben), Ausdrucksexperimente (z. B. Messung der Blutdruckveränderung bei intensivem Lernen) und Verhaltensexperimente (z. B. Erfassen der Übersprungshandlungen in frustrierender Situation).
Die in diesem Kompendium verwendeten Abkürzungen lauten: Ex. = Experiment (immer rot hervorgehoben; manchmal auch - nicht ganz korrekt - wegen der Signalwirkung für Untersuchungen oder Befragungen verwendet), Kg. = Kontrollgruppe, Vg. = Versuchsgruppe, Vl. = Versuchsleiter/in, Vp. = Versuchsperson, Proband/in. (Zum Unterschied zu Feldstudien s. u.)
- Test:
Vgl.
Allgemeines
zu Tests und Beschreibung zahlreicher Tests auf der Seite
„Wiener Testsystem“.
Eine Kurzbeschreibung vieler Tests findet sich unter diesem
Link.
* Diagnostisches Verfahren: Jede Testausführung muss
(im Unterschied zu einem Ergebnis eines Experiments, das oft in Zahlen vorliegt) interpretiert werden.
* Standardisierung: Die Eichung des Messinstrumentes
ist (immer wieder)
erforderlich. Das Testergebnis einer Vp. muss in einen geeigneten Bezug zu den
Ergebnisse einer Gesamtpopulation gesetzt werden können.
* Gütekriterien, die erfüllt werden müssen
(u. a. hat sich Lee J. Cronbach,
1916-2001, mit Psychometrie befasst und mit dem Cronbach'schen
Alpha eine Maßzahl für die Verlässlichkeit von Tests entwickelt):
| ° | Validität (Gültigkeit): Der Test soll messen, was er zu messen vorgibt (eine Korrelation von r = 0.5 gilt bereits als gut genug). |
| ° | Reliabilität (Zuverlässigkeit): Der Test soll wiederholungsstabil sein („Korrelation mit sich selbst“, solange sich der Untersuchungsgegenstand nicht verändert hat). Messfehler, die im Test enthalten sind, müssen verhindert werden, dem Messinstrument muss vertraut werden können. |
| ° | Objektivität (Unabhängigkeit): Das Ergebnis eines Tests soll nicht an den zufällig tätigen Tester/innen hängen (bei projektiven Tests schwer zu erfüllen). Weder Durchführung noch Auswertung und Interpretation dürfen von der durchführenden Person abhängig sein. |
Es ist auf einen Blick erkennbar, dass Tests im Schulbereich diese Kriterien nur in den seltensten Fällen erfüllen. (Viele Fachtests überprüfen, z. B. bei einer Mathematikschularbeit, - nicht valide - häufig eher das sinnerfassende Lesen und die Intelligenz als das Wissen in Bezug auf die jeweilige Disziplin, ergeben bei Wiederholung an vergleichbaren Samples - nicht reliabel - völlig andere Werte und sind v. a. in ihrer Auswertung - nicht objektiv - in hohem Ausmaß lehrerabhängig.)
Diese nicht zu rechtfertigende Unschärfe ist einerseits einem imaginären klasseninternen Bezugssystem zuzuschreiben, das Lehrer die Leistungen ihrer Schüler nicht an (durch den jeweiligen Lehrplan bzw. die Leistungsbeurteilungsverordnung) vorgegebenen Maßstäben, sondern relativ zu anderen Schülern derselben Klasse messen lässt, und hängt andererseits am Noise-Phänomen (s. o.), das in (zu) hohem Ausmaß immer dann auftritt, wenn Urteile gefällt werden. Diese streuen in unzumutbarer Weise, wenn sie nicht extern kontrolliert werden (und selbst dann).
Ex.: Ein an zahllose Lehrpersonen mit der Bitte um Beurteilung geschickter identischer Deutschaufsatz erbrachte die gesamte Bandbreite an Schulnoten. (Versieht man den Text mit Zusatzinformationen über den/die Schreiber/in, tritt der Pygmalioneffekt - s. u. - ein. Wird z. B. in einem zweiten Ex. ein identischer Deutschaufsatz mit unterschiedlichen Notizen - einmal des Inhalts, es handle sich um die Arbeit einer sprachbegabten Journalistentochter, und einmal, der Autor sei der Sohn eines ausländischen Hilfsarbeiters - zur Beurteilung übergeben, so weicht das Ergebnis der benotenden, gemäß ihrem Selbstbild unbeeinflussbaren Lehrer/innen statistisch signifikant voneinander ab.)
* Testzweck: Prinzipiell dienen Tests meist zwei Zwecken: selection (Auswahl; z. B. arbeitsplatzbezogene Eignungstest, Maturaprüfungen etc.) und prediction (Vorhersage; z. B. Schulreifetests). Zahlreiche Tests werden zu diagnostischen Zwecken (und damit gleichzeitig auch für die bereits erwähnten Zwecke: Trennung von potentiellen Patienten und Gesunden bzw. Ermöglichen einer Prognose über den Krankheitsverlauf) verwendet.
* Testpsychologie: Die Testpsychologie ist Teil der Differentiellen Psychologie (s. u.). Sie wurde von Francis Galton (1822-1911, s. a. u.; sein 1892 erschienenes Buch Finger Prints war Anstoß zur Einführung dieser Methode bei der englischen Polizei) begründet. Sein Motto war: „Count, whenever you can.“ Man unterscheidet die Fragebogenmethode (s. a. u.) von Projektiven Tests (bei denen Assoziationen zu mehrdeutigen Stimuli gebildet werden müssen).
* Psychologische Diagnostik: Eine der häufigsten Tätigkeiten von Berufspsychologen besteht im Erstellen psychologischer Diagnostik. Darunter versteht man nach Reinhold S. Jäger (*1946) und Franz Petermann (1953-2019) „das systematische Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zu begründen, zu kontrollieren und zu optimieren.“
Bekannte
Tests: Freiburger Persönlichkeitsinventar (ein 1970 an der Universität
Freiburg unter der Leitung von Jochen
Fahrenberg, *1937, entwickelter
Fragebogen mit 138 Items im dichotomischen Antwortformat „stimmt“ oder „stimmt
nicht“),
Rorschach-Test (ein nach Hermann
Rorschach, 1884-1922 benannter
projektiver, ursprünglich aus 10 Karten bestehender Test: symmetrische
Tintenkleckse sollen interpretiert werden; Standardwerk 1960 Rorschach
Psychology von Maria Ovsiankina,
s. u.),
Wartegg-Zeichentest (nach Ehrig
Wartegg, 1897-1983; projektiv:
nicht leere Kästchen sollen zu Bildern ergänzt werden), der 1935 veröffentlichte TAT (Thematischer
Apperzeptionstest von Henry Murray,
1893-1988, und Morgan,
1897-1967: zu mehrdeutigen Bildern sollen Geschichten erzählt werden), der
projektive Welttest von Charlotte
Bühler (1893-1974; ein
diagnostischer und therapeutischer Spielszenentest für Kinder) etc.
Vgl. Beispiele für Online-Tests
* Probleme und Effekte: Im Folgenden werden einige allgemeine Wahrnehmungsfehler
bzw. kognitive Verzerrungen,
die nicht ausschließlich beim
Testen auftreten, und andere Effekte, die im Zusammenhang mit Tests und
Experimenten zu beobachten sind, beschrieben. Prinzipiell ist zu beachten, dass
Personen möglicherweise ein anderes Verhalten als üblich zeigen, wenn sie
wissen, dass sie untersucht werden. (Zu fehlerhaften Heuristiken
s. o., zu sozialen Effekten
s. u.)
| ° | Halo-Effekt (nach Thorndike, 1874-1949; s. u.): Ausdehnung der Bewertung beobachteter Merkmale auf nicht beobachtete: Um ein beobachtbares Merkmal herum wird durch logisch nicht gerechtfertigte Transfers oder Rolleneffekte, die auf Verallgemeinerungen und ev. Vorurteilen (s. u.) beruhen, ein ganzer Hof (analog dem astronomischen Halo) von Eigenschaften hinzugefügt, der die objektive Beurteilung einzelner Eigenschaften beeinflusst, da an sich getrennte Dimensionen gemeinsam beurteilt werden. (Vgl. z. B. Tests in der Schule, Bewerbungsgespräche etc.; Ex.: Hat eine Lehrperson vor der Benotung von einem Schüler einen positiven Eindruck, so fällt ihre Beurteilung im Schnitt günstiger aus, als sie sein sollte. Dieser Eindruck kann künstlich hervorgerufen werden, indem vor der Benotung z. B. eines anonymen Deutschaufsatzes Vorinformationen über den Autor oder die Autorin - „Sohn eines bekannten Schriftstellers“, „Tochter renitenter Eltern“ etc. - gestreut werden.) Ein - wenn auch nur vermeintliches - Merkmal überstrahlt vor allem dann die anderen, wenn es als erstes genannt oder erkannt wurde (= Primacy-Effekt, der - genauso wie der Recency-Effekt - auch in der Werbung ausgenützt wird). Die oft vom Zufall abhängige Abfolge der Kenntnisnahme von Eigenschaften einer Person prägt also unbewusst das Bild, das man von ihr hat. Ein Satz wie „Adolf Hitler (1889-Suizid 1945) liebte Hunde und kleine Kinder“ schockiert daher unabhängig von seinem Wahrheitsgehalt (Beispiel von Kahneman, s. o.). Vgl. auch folgendes 3teilige Video |
| ° | Pygmalion- od. Rosenthaleffekt (nach Robert Rosenthal, 1933-2024, und Lenore Jacobson, 1912-2009): Ein Testergebnis wird durch Vorinformationen des Testers über die Testperson verfälscht. Dies kann auch zu self fulfilling prophecies (Erwartungseffekten; s. a. u.) im Klassenzimmer führen: Ex.: Wird eine Lehrperson darüber informiert, dass aufgrund psychologischer Tests - die in Wirklichkeit nie stattgefunden haben - zu erwarten sei, dass ein Schüler in nächster Zeit große Fortschritte machen würde, so treten diese tatsächlich ein. „Man wird, wie man gesehen wird“. (Vgl. Ovid, 43 v.-17 n. Chr., Metamorphosen, 10. Buch, aber v. a. George Bernard Shaw, 1856-1950, Pygmalion bzw. Alan Jay Lerner, 1918-1986, und Frederick Loewe, 1901-1988, My fair Lady; vgl. a. Video) |
| ° | Andere Attributionsfehler (correspondence biases) aller Art: Attribution bedeutet Zuschreibung (das Nutzen von Informationen zur kausalen Erklärung von Verhaltensweisen von Personen). Die Neigung, die Rolle von dispositionalen Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmalen (bei anderen, nicht uns selbst - hier wird die Selbstwertdienliche Verzerrung wirksam: Schuld sind die Umstände und die anderen!) zuungunsten von situationalen (äußeren, kontextuellen) Faktoren zu überschätzen, wurde von Lee Ross (1942-2021) 1977 als „fundamentaler Attributionsfehler“ bezeichnet (Hintergrund: So lassen sich die Zusammenhänge für uns leichter erklären bzw. erzählen; vgl. a. u.). |
| ° | Mere exposure-Effekt (1968 von Robert B. Zajonc, 1923-2008, entdeckter Darbietungseffekt; s. a. u.): Allein die Wiederholung eines (noch so irrelevanten) Reizes bewirkt ihm gegenüber im Laufe der Zeit eine immer positivere Einstellung. Bekannte Personen werden z. B. im Schnitt milder beurteilt als unbekannte (externe Prüfer sind z. B. im Durchschnitt strenger - aber möglicherweise gerechter - als dem Prüfling bekannte). Erklärung von Zajonc: Jedes Lebewesen sei evolutionär vor Neuem auf der Hut, Bekanntes (wiederholte Reize ohne negative Kopplung) würden zu einem Signal für Sicherheit. Schon 1954 stellte Gordon Allport (1897-1967; s. a. u.) die Kontakthypothese auf: Die Begegnung von heterogenen Gruppen führe zum Abbau von Vorurteilen. (Zu Vorurteilen s. u.) |
| ° | Leniency-Effekt: Sympathische Personen werden in Tests zu milde beurteilt (z. B. in der Schule). |
| ° | Placebo-Effekt: Er tritt ein, wenn bei Einnahme objektiv wirkungsloser Medikamente oder Substanzen nachgewiesenermaßen positive Effekte auftreten (allein die Erwartungshaltung der Vp. zeitigt bereits Auswirkungen). Wortschöpfer war - wie auch bei „Neurose“, s. u. - der schottische Arzt William Cullen (1710-1790). |
| ° | Nocebo-Effekt: Die Erwartung negativer Effekte (z. B. nach Einnahme von Medikamenten oder Impfungen) bewirkt auch ohne Kausalzusammenhang, dass diese wirklich auftreten. |
| ° | Versuchsleiter-Effekt: Wenn das Ergebnis einer Untersuchung unbeabsichtigt (z. B. durch unbewusste Erwartungshaltungen) vom Vl. mitbestimmt wird, spricht man vom Versuchsleiter-Effekt. Gegenmaßnahme: Blind- oder Doppelblindstudie (in denen weder die Vpn. selbst noch der Vl. Kenntnis über die jeweilige Gruppenzugehörigkeit der Probanden - also Kg. oder Vg. - haben) |
| ° | Fragebogenprobleme: Es gilt zu vermeiden, dass - meist unbewusst und nicht aus bewusster Unehrlichkeit - sozial erwünschte Antworten gegeben werden bzw. diese zu detektieren. Ist die Frage als Polaritätsprofil (s. u.) verpackt, tendieren viele Vpn. zum Mittelwert. (Dies kann durch eine gerade Anzahl von Auswahlmöglichkeiten vermieden werden, da man sich nun auf eine Seite schlagen muss. Beispiel: „trifft immer zu - trifft manchmal zu - teils-teils - trifft manchmal nicht zu - trifft nie zu“ versus „trifft immer zu - trifft manchmal zu - trifft manchmal nicht zu - trifft nie zu“) |
- Zahlreiche weitere Verfahren:
wie Gespräche, psychoanalytische Verfahren (s. u.),
bildgebende Verfahren (s. u.),
Polaritätsprofile (graphische Darstellung eines semantischen Differenzials,
das aufgrund von Gegensatzpaaren bzw. der Einordnung einer Eigenschaft in eine
Skala erstellt wird; entwickelt von Charles
Egerton
Osgood,
1916-1991, u. a.), naturalistische Studien (die das Verhalten in der
alltäglichen Lebenswelt untersuchen) etc.
Eine besondere Erwähnung verdienen Feldstudien. Sie unterscheiden sich von Laborexperimenten dadurch, dass natürliche, in der Realität vorgefundene, nicht künstlich erzeugte Bedingungen untersucht werden. Gemeinsam ist ihnen die systematische, wissenschaftliche Auswertung. Zur (oft - v. a. bei Langzeitstudien - sehr aufwändigen) Datenerhebung wird neben der Beobachtung v. a. der Fragebogen (inventory) mit offenen oder Auswahlantworten eingesetzt, in dem unter kontrollierten Bedingungen standardisierte Fragensets ein Forschungs- oder Diagnoseinteresse aufzuschließen versuchen. Im Unterschied zu oberflächlichen psychologischen Zeitschriftentests werden die Phasen der Provokation (der Entwicklung eines Verständnisses für die Frage), der Reflexion (der Entwicklung einer Antwort) und der Deklaration (der eigentliche Beantwortung) berücksichtigt. (Beispiel: Disability Assessment Schedule DAS, deutsch DAS-M für Mannheim; dieses Interview soll die Abweichungen individueller Verhaltensmuster, z. B. bei Schizophrenen - s. u. -, von sozialen Erwartungen einer normgebenden Bezugsgruppe erfassen, oder s. u.)
Zu Methoden der Sozialpsychologie s. u.
GEHIRNABHÄNGIGKEIT DES SEELISCHEN ERLEBENS
Zum Gehirn selbst, das Aristoteles (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.) noch als Kühlsystem für das Blut betrachtete, s. u.
- Beweise:
* Ohnmacht: Bei Bewusstlosigkeit (s. u.) gibt es kein seelisches
Erleben (z. B. fehlt die Erinnerung an die Blinddarmoperation).
* Läsionen: angeborene Anomalien oder erworbene Verletzungen einzelner Zentren im Gehirn (s. u.) führen zu teilweisen (spezifischen) Ausfällen. Eine Verletzung von Temporal- und Parietallappen kann z. B. Prosopagnosie - die Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen - bewirken. (Personen werden dann anhand anderer Merkmale erkannt. Nach eigenen Angaben leidet u. a. der US-amerikanische Schauspieler William Bradley „Brad“ Pitt, *1963, an diesem Phänomen. Im Gegensatz dazu werden Personen, die Gesichter auch unter ungünstigen Umständen sofort erkennen können, Super-Recognizer genannt.) Auch experimentell herbeigeführte Läsionen sind (vor allem bei Tieren) manchmal möglich oder medizinisch nötig.
* Drogen, Hormone (z. B. Alkohol, Psychopharmaka wie Sedativa; s. u.): Mit Hilfe der angeführten Substanzen lässt sich die Bewusstseinslage z. T. drastisch verändern, da sie auf das ZNS (Zentralnervensystem) wirken, dessen Hauptschaltstelle das Gehirn ist.
* Gehirnentwicklung: Im Laufe der ersten Lebensjahre eröffnen sich auf Grund der sich stetig verbessernden Gehirnstrukturen immer mehr psychische Möglichkeiten.
* Korrelate: Das EEG (s. u.) und andere bildgebende Verfahren wie z. B. fMRT (funktionelle Magnetresonanztomographie; s. u.) weisen Veränderungen bei verändertem Erleben nach.
- Leib-Seele-Problem:
Das Leib-Seele-Problem behandelt seit vielen Jahrhunderten das
Verhältnis von Geist und Körper. Wie oben erwähnt (s. o.)
stammt das Wort Psychologie aus dem Griechischen, was häufig mit
Seelenkunde übersetzt wurde. Heute werden statt des religiös konnotierten Begriffs
der (oft als unsterblich gedachten)
„Seele“ meist Termini wie „Ich“, „Bewusstsein“ (s. a. u.), „Geist“
(nach Roth,
s. u., ein funktionaler
Gehirnzustand, der als Bewusstsein zugeschaltet wird), „Psyche“, „Selbst“
(vgl. Sören
Kierkegaard, 1813-1855:
„Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu
sich selbst verhält.“ oder u.
1,
2,
3) o. ä. verwendet (vgl. folgende ARTE-Video-Dokumentation
Das Rätsel unseres Bewusstseins). Die - ursprünglich philosophische - Frage nach der Art des Zusammenhanges zwischen Psyche und Physis
- für die Wissenschaft der Psychologie kann das Leib-Seele-Problem auf ein
Hirn-Seele-Problem reduziert werden - wurde im Laufe
der Geschichte (z. B. schon vom usbekisch-persischen Philosophen und
Universalgelehrten ابن سينا / Avicenna
/ Ibn Sina,
vor 780-1037, der in seinem Gedankenex.
„Fliegender Mann“ - ein durch den Raum fliegender Mann ohne jede Möglichkeit,
die Außenwelt oder sich selbst wahrzunehmen, wäre sich dennoch seiner Existenz
bewusst, was die Unabhängigkeit seines Geistes vom Körper beweise - für den Dualismus
argumentieren wollte) verschieden beantwortet:
* Dualismus: Körper und Seele sind wesensverschieden
und existieren unabhängig vom jeweils anderen nebeneinander. Über etwaige
Beziehungen zwischen beiden Bereichen existieren unterschiedliche Auffassungen.
Einige Ausprägungen:
| ° | Religiöse Vorstellungen: Die immaterielle Seele überlebt den endlichen Körper. (Diese Vorstellung vertritt z. B. auch Platon, 427-347 v. Chr. der den Körper als Wohnstatt der Seele, die ihm Leben einhauche, betrachtet.) |
| ° | Psycho-physische Wechselwirkung, z. B. René Descartes (1596-1650): Er unterscheidet res cogitans (Geist; manchmal als „Gespenst in der Maschine“ bezeichnet) von res extensa (Körper). In ihrer Korrespondenz widersprach Elisabeth von der Pfalz, 1880-1880, mit dem Argument, dass dann ein Interagieren von Geist und Körper unmöglich sei. (Descartes glaubte den Ort des Interagierens in der Zirbeldrüse zwischen den Hemisphären gefunden zu haben.) Die moderne Form dieser Ansicht (nach dem britischen Philosophen Gilbert Ryle, 1900-1976) betrachtet Gehirn und Geist analog zu Hardware und Software: unabhängig voneinander, aber in Wechselwirkung stehend. (Einen ebenso gegenseitigen Zusammenhang von Geist und Körper insinuiert auch der Begriff „psychosomatische Erkrankung“; vgl. Psychosomatik.) |
| ° | Psycho-physischer Parallelismus, z. B. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716; „parallélisme de l’ame et du corps“): Beide Bereiche folgen in einer von Gott prästabilierten Harmonie ohne Beeinflussung des jeweils anderen eigenen Regeln. |
| ° | Erweiterung zur 3-Welt-Theorie von Karl R. Popper: Neben der Welt der physikalischen Gegenstände (Welt 1, zu der auch unser Körper zählt) und der Welt der unserem Bewusstsein entsprungenen Theorien (Welt 2) existiert für den Menschen eine weitere Sphäre (Welt 3), die den materiellen und den mentalen Bereich vereint, indem sie die zur Welt 2 gehörenden Theorien (z. B. in Büchern, auf Festplatten oder anderen Welt 1-Medien) niederlegt und sie damit unabhängig von ihren Autoren macht. |
* Monismus: Körper und Seele sind im Grunde identisch und nur unterschiedliche Erscheinungsformen des jeweils anderen. (Manche philosophischen Strömungen verleugnen dieses Andere: Der Materialismus behauptet, dass alles Existierende, auch der Geist, aufgrund von Materie existiere, der Idealismus behauptet, alles Existierende entspringe einem Geist: z. B. als subjektiver Idealismus - esse est percipi - / Solipsismus dem Geist eines erkennenden Subjekts - für den irischen Bischof und Philosophen George Berkeley, 1885-1753, sind Erscheinung und Wirklichkeit identisch, für den Buddhismus Wirklichkeit und Bewusstseim - oder, wie im Christentum,. als objektiver Idealismus dem Geist Gottes. Auch für den Hinduismus beruhen Geist und Materie auf einer ultimativen Realität: der der „Weltseele“ Brahman.)
Einige Ausprägungen:
| ° | Spiritualismus (Idealismus): Die Materie ist ein Produkt des Geistigen. |
| ° | Materialismus: Das Geistige ist eine Form der Materie (in radikaler Form bereits 1747 von Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751, in L'homme machine artikuliert). |
| ° | Deus sive natura: (Baruch de Spinoza, ברוך שפינוזה, eig. Bento de Espinosa, 1632-1677). Geist (Gott) und Materie (Natur) sind ein- und dasselbe; führt zur |
| ° | Identitätstheorie: Sie betrachtet das Problem als Scheinproblem, in Wahrheit seien Leib und Seele dasselbe bzw. zwei Seiten nur einer Medaille. Vertreten z. B. von C. G. Jung (s. a. u.) mit seiner Eine-Welt (unus mundus)-Theorie, nach der hinter Leib/Seele (Geist/Materie) ein letztes gemeinsames Drittes angenommen wird. |
* Die 6 psychoneuralen Grundsysteme: Nach Steven Pinker (*1954) wurde die Mauer zwischen Körper und Geist endgültig durch die kognitiven Neurowissenschaften und die Verhaltensgenetik eingerissen (so wie davor die zwischen Erde und Kosmos durch die Schwerkraftgesetze von Isaac Newton, 1643-1727, oder die zwischen Lebendigem und Totem durch die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler, 1800-1882).
Aus heutiger neurobiologischer Sicht bringt das Gehirn die Seele hervor, die als „Gesamtheit aller bewusst, vorbewusst-intuitiv oder unbewusst ablaufenden kognitiven und emotionalen Zustände, die Einfluss auf unser Verhalten haben“, definiert wird. (Vgl. Buchtitel Wie das Gehirn die Seele macht von Gerhard Roth, 1942-2023, und Nicole Strüber, *1979?, Stuttgart 2014; s. a. u.1 bzw. u.2.) Nach ihr gibt es 6 psychoneurale Grundsysteme, die - alle neuromodulatorisch reguliert bzw. beeinflusst - interferierend unsere Persönlichkeit (die „Seele“) bilden und aufgrund verschiedenster (epi)genetischer Ursachen oder ungünstiger frühkindlicher Erfahrungen (z. B. Lieb- und Anregungslosigkeit; vgl. hier) und vorgeburtlicher ungünstiger Umstände gestört sein können, wenn dadurch z. B. der Nervenwachstumsfaktor BDNF / brain-derived neurotrophic factor (ein Protein aus der Gruppe der Neurotrophine) in seiner Wirkung behindert wird. (Der erste Neurotransmitter - Acetylcholin - wurde 1921 vom deutsch-österreichisch-amerikanischen Pharmakologen Otto Loewi, 1873-1961, in Graz beschrieben und „Vagusstoff“ genannt; Medizin-Nobelpreis 1936 gemeinsam mit Henry Hallett Dale, 1875-1968, für die Entdeckung der chemischen Übertragung der Nervenimpulse.) Neurotransmitter können erregend-exzitatorisch (z. B. Glutamat, Acetylcholin, Adrenalin), modulatorisch (z. B. das „Glückshormon“ Dopamin, Serotonin) oder hemmend-inhibitorisch (z. B. GABA) wirken.
|
Übersicht: Die sechs psychoneuralen Grundsysteme |
||||
| ° | das Stressverarbeitungssystem | „Wie sehr werde ich mit Aufregungen fertig?“ Das für die psychische Gesundheit wichtigste System; regelt die Höhe der Stressresistenz, die Anpassung an Umweltveränderungen, das Verhältnis von Erkundungsverhalten vs. erhöhte Wachsamkeit, die Alarmbereitschaft und emotionales Lernen, das „Aufregen“ und das „Abregen“. Gesteuert von (Nor)adrenalin und Cortisol (s. a. u.). | ||
| ° | das interne Beruhigungssystem | „Wie bedrohlich erlebe ich die Welt, wie sehr fürchte ich Misserfolge, wie sehr suche ich Sicherheit?“ Unterdrückt Handlungsimpulse und im besten Fall Ängstlichkeit, Bedrohtheitsgefühle, reaktive Aggression und Depressivität. Gesteuert von Mangel an endogenen Opiaten, Serotonin (1A-Mangel, 2A-Überschuss), Noradrenalin- und Cortisolüberschuss; hängt mit dem ersten System zusammen | ||
| ° | das Impulshemmungssystem | „Wie sehr werde ich von unmittelbaren Motiven getrieben?“ Entwickelt Toleranzen gegenüber Belohnungsaufschub und anderen Unannehmlichkeiten, unterscheidet Stressoren, auf die reagiert werden muss, von Situationen der Zurückhaltung. Gesteuert von Dopamin, Serotonin 2A, Noradrenalin, die Selbstkontrolle von Glutamat und GABA (Gamma-Aminobuttersäure). | ||
| ° | das interne Bewertungs- und Belohnungssystem | „Wie sehr suche ich die Belohnung, den Erfolg, das Risiko, den Kick?“ Bewertet Ereignisse im Hinblick auf das Erzeugen von Lust / Unlust (Erleben von Befriedigungsgefühlen) und entwickelt Belohnungs- / Bestrafungserwartungen und damit Motivation. Gesteuert von erhöhter Ausschüttung körpereigener Opiate und von Dopamin. | ||
| ° | das Bindungssystem | „Wie wichtig ist mir das Zusammensein mit anderen, die Anerkennung durch sie; wie sehr ziehe ich mich von den anderen zurück, empfinde sie als Bedrohung?“ Bestimmt die Fähigkeit, emotionale und soziale Signale zu erkennen, und damit Empathie, die soziale Motivation und Bindungsfähigkeit. Gesteuert von Oxytocin, endogenen Opiaten, Serotonin 1A bzw. deren Mangel. | ||
| ° | das System des Realitätssinns und der Risikobewertung | „Wie genau kann ich Situationen und Risiken einschätzen, wie sehr vermag ich aus (insbesondere negativen) Konsequenzen meiner Handlungen zu lernen?“ Verantwortet die Fähigkeit zur wirklichkeitsnahen Erfassung einer Situation und zur Abschätzung in ihr enthaltener Risiken und die Fähigkeit zu genereller Aufmerksamkeit und Fokussierung. Gesteuert von Acetylcholin, Glutamat und GABA. | ||
(Vgl. Video-Vortrag von Gerhard Roth; zum Selbst-System s. u.; Video-Vortrag von Wolf Singer, *1943)
Ein psychophysischer Parallelismus bzw. ein interaktiver Dualismus ist mit dem festgestellten zeitlichen Nachlaufen des Bewusstseins (vgl. u. Libet-Ex.) gegenüber unbewussten neuronalen Prozessen (s. a. u.) nicht vereinbar. Vielmehr ergibt sich eine Verursachung des Geistes durch Hirnprozesse (und die Sekretausschüttung einiger Drüsen). Diese schaffen eine Wirklichkeit: die im Gegensatz zur unabhängig vom Bewusstsein existierenden Außenwelt, über die gesicherte Erkenntnisse zu haben nicht möglich scheint, bewusst erfahrene Erlebniswelt, die aus Körper, Umwelt und Geist besteht. Gut oder schlecht funktionierende Rezeptoren für die einzelnen Neuromodulatoren sorgen für Mangel oder Überschuss, wodurch Probleme entstehen können. „Normalität“ wird durch ausgeglichene Entwicklung dieser Systeme erzeugt (also leichte, aber nicht starke Introversion, Extraversion etc.), pathologische Entwicklungen können später höchstens noch durch das Bindungssystem repariert werden. (Neurobiologische Forschungen deuten darauf hin, dass rein kognitive Therapien die in der Kindheit entstandenen fundamentalen Muster nicht mehr verändern können, eine emotionale Beziehung eventuell schon. - S. a. u.)
Das Zusammenspiel von Hirnteilen (s. u.) und Neuromodulatoren am Beispiel des Verliebtseins: Die für Panik und Stress zuständige Amygdala alarmiert und macht partiell blind. Gleichzeitig werden die Belohnungszentren aktiviert und euphorisierende Endorphine (hirneigene Opiate aus dem Hypothalamus) ausgeschüttet. Das Stammhirn produziert das stimmungsaufhellende Serotonin, wodurch eine Art Drogenabhängigkeit nach diesem „Glückscocktail“ erzeugt wird. (Auch der für das Suchtverhalten zuständige, mit Dopaminrezeptoren versehene Nucleus accumbens ist aktiv). Der Hypothalamus schüttet das Stresshormon Cortisol aus. Wir sind also „neurobiologisch süchtig, blind und gestresst“. Hypothalamus und Hypophyse drosseln beim Mann die Testosteronproduktion, bei der Frau wird sie erhöht, wodurch die Partner einander ähnlicher werden. Nach einiger Zeit erfolgt eine Gewöhnung an die bzw. eine Reduktion der Glückshormone und es wird das Bindungshormon Oxytocin gebildet, das von der Hirnanhangdrüse auch beim Orgasmus, der den Dopamin- und danach den Noradrenalinspiegel steigen lässt, oder beim Stillen ausgeschüttet wird. Es erzeugt ein stressloses Bedürfnis nach Nähe und dauerhafter Bindung, wie es für die Versorgung des Nachwuchses wichtig ist. Laut der Anthropologin Helen Fisher (1945-2024) gibt es 4 hormonbezogene Typen verliebter Gehirne: dopamingesteuerte Entdeckertypen und serotoningesteuerten Nestbauer/innen paaren sich vorzugsweise mit Personen desselben Typs, testosterongesteuerte Entscheider/innen dagegen mit östrogengesteuerten Verhandler/innen und umgekehrt. Diese Kriterien der Partnerwahl dringen jedoch nicht in unser Bewusstsein, sie beruhen auf unbewussten Prozessen. (Nach: „Die Macht des Unbewussten“, Teil 2. Dokumentation ORF III). Wie vieles, kann auch dieses Phänomen den Bereich des „Normalen“ (dazu s. u.) verlassen. Ist der Zustand des Verliebtseins krankhaft obsessiv und einseitig, führt dies zu einer ungesunden Fixierung, die andere Lebensbereiche negativ beeinflusst; man spricht dann von Limerenz. (Ursache ist oft ein Aufwachsen ohne sichere Bindung; s. u.)
Vgl. Experiments and Activities, Nervensystem, Sinneswahrnehmungen und Fortbewegung, Video „Netzwerk Nerven“ bzw. Sinne oder Wahrnehmung
ALLGEMEINE BEGRIFFE
Wahrnehmung befähigt uns, Vordergrund von Hintergrund zu unterscheiden, Objekte und ihre Position zu erkennen und dadurch vielfältigen Informationsgewinn auf der Basis physikalischer Reize und physiologischer Voraussetzungen zu erzielen. Dabei erfolgt der Erkenntnisgewinn nach der vom Philosophen Karl R. Popper (1902-1994) so genannten Scheinwerfertheorie (die Aufmerksamkeit wird aktiv auf etwas gerichtet; vgl. den 1. Satz der Metaphysik / τὰ μετὰ τὰ φυσικά des Aristoteles: πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει / Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen) und nicht gemäß der Kübeltheorie (man bekommt passiv etwas hineingeschüttet). Meist unbewusste Filterungsprozesse, die die einströmenden Reize in neue und bekannte bzw. in relevante und irrelevante scheiden, gehen ihr voraus. „Das Gehirn extrahiert die für die Aufgabe wesentlichen Merkmale“ (Manfred Spitzer). Die Selektion der für uns entscheidenden Wahrnehmungsinhalte erfolgt im Alltag meist automatisch ohne Zuschaltung des Bewusstseins.
Wahrnehmung schafft Wirklichkeit. (Vgl. die Aussage des englisch-irischen Philosophen George Berkeley, 1685-1753, „Esse est percipi“, nach der Erscheinung und Wirklichkeit identisch seien.) Prinzipiell gilt, dass wir nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrzunehmen imstande sind. Alles außerhalb der Reizschwellen bzw. alles, wofür wir keine Rezeptoren haben, bleibt uns verborgen. (Einiges davon, z. B. Magnetismus oder Radioaktivität, lässt sich mit Hilfsmitteln - „künstlichen Sinnesorganen“ wie z. B. Geigerzählern - nachweisen.) Trotzdem strömen auf den Menschen immer noch pro Sekunde geschätzte 11,2 Mio. Bit an Informationen ein (darunter 10 Mio. über die optische Wahrnehmung), wobei wir vermutlich nur 50 Bit pro Sekunde bearbeiten können. Nur ein Bruchteil des Inputs gelangt also in unser Bewusstsein (dessen - jedenfalls durch Wahrnehmungen induzierter - Beginnzeitpunkt unklar ist), der größte Teil der Welt bleibt uns verborgen. Wahrnehmung bedeutet also Reduktion, nicht Addition. Sie ist immer eine (unbewusste) Selektion, die - positiv betrachtet - einen Prozess, der durch Information (das Erkennen von Regelmäßigkeiten) und Bildung von Redundanz (Mehrfachabsicherung der Information) Unsicherheiten im Lebensvollzug verringert, darstellt.
Außerdem ist zu beachten, dass wir permanent in der Illusion leben, die Realität wahrzunehmen. In Wahrheit handelt es sich aber immer um deren Verarbeitung durch das Zentralnervensystem, das die Wirklichkeit (re)konstruiert, indem es die empfangenen Stimuli auf Basis des bisher phylogenetisch oder individuell Gelernten interpretiert, sodass ein inneres Modell der Welt entsteht. (Albert Einstein, 1879-1955: „Die Realität ist nur eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige.“) Die „bewusste“ Wahrnehmung der Welt ist also eine Schöpfung unseres Gehirns (wenn man so will, eine virtuelle Realität). Körper und Bewusstsein sind - s. a. o. - untrennbar verbunden. Die prinzipielle Frage lautet, was wir überhaupt meinen, wenn wir von „Realität“ sprechen. Der australischstämmige New Yorker Philosoph David Chalmers (*1966) unterscheidet
5 Aspekte der Realität:
| ° | Realität als Existenz: Real ist, was wirklich existiert (also nicht der Weihnachtsmann). |
| ° | Realität als kausale Kraft: Real ist, was auf Dinge einwirken oder von Dingen beeinflusst werden kann (also nicht das Christkind). |
| ° | Realität als Geistunabhängigkeit: Real ist, was nicht vom Geist irgendeines Menschen abhängt (also nichts, was verschwindet, wenn niemand mehr daran denkt). |
| ° | Realität als Nicht-Illusionäres: Real ist, was so ist, wie es scheint (also nicht die Stimmen, die ein Schizophrener hört). |
| ° | Realität als Echtheit: Realität liegt vor, wenn ein wirkliches X (z. B. Uhr, Hase) wirklich ein X ist (also bei einer echten Rolex, aber nicht beim Osterhasen). |
Nach Chalmers und seinem Simulationsrealismus wären Objekte, die wir wahrnehmen, selbst dann, wenn wir unentscheidbar (ohne, dass wir das wissen oder auch nur wissen können) in einer perfekten, permanenten Computersimulation lebten, real. (Es handelte sich dann eben um von einer höheren Ebene hervorgebrachte Digitalobjekte, z. B. gemäß dem von Gilbert Harman, 1938-2021, entworfenen und vom - ebenfalls amerikanischen Philosophen - Hilary Putnam, 1926-2016, als entweder falsch oder sinnlos kritisierten Gehirn-im-Tank-/brain in a vat-Szenario, in dem die von außen zugeführten Impulse eine simulierte Welt erzeugen, die uns als echte Welt erscheint.) Sollte solches einmal entdeckt werden, wäre diese Erkenntnis nicht erschütternder als die uns ebenfalls schwer zugängliche Vorstellung, dass ein Körper aus Zellen und jede Zelle aus Atomen, die auf Quantenmechanik beruhen, besteht. (Assoziativ könnte man auch darauf hinweisen, dass unser Traum-Ich die dort vorgefundene „Realität“ nicht anzweifelt.) Laut Chalmers müsse man die physische Welt von der virtuellen Welt unterscheiden. Letztere sei vollständig immersiv, interaktiv und computergeneriert. Beide Welten seien aber real.
- Reizschwellen: Sie müssen überschritten werden, damit eine Empfindung zustande kommen kann. Man unterscheidet:
| ° | Modalitätsschwelle: sie benennt, für welche potentiellen Wahrnehmungsfelder reizadäquate Rezeptoren vorhanden sind (also z. B. für Geräusche, aber nicht für Magnetismus). Man unterscheidet Photo-, Chemo-, Mechano- und Thermorezeptoren. |
| ° | Qualitätsschwelle: sie gibt die Untergrenze (Übergang vom Unmerklichen zum Eben-Merklichen) und die Obergrenze (Übergang vom Merklichen zum Nicht-mehr-Merklichen) der physikalischen Bandbreite eines spezifischen wahrnehmbaren Reizes an (z. B. im optischen Bereich 400-760 nM: elektromagnetische Schwingungen in Billionen Herz pro Sekunde) |
| ° | Intensitätsschwelle (absolute Wahrnehmungsschwelle): sie gibt die Mindestgröße bzw. Intensität für die Wahrnehmbarkeit eines Reizes an (z. B. die minimale Lautstärke für ein Hörerlebnis; hier kann der Übergang vom Merklichen zum Nicht-mehr-Merklichen - z. B. bei Schwerhörigkeit - subjektiv unterschiedlich sein). |
| ° | Unterschiedschwelle: sie muss überschritten werden, damit zwei Reize voneinander unterschieden werden können. (= „JND“: just noticeable difference. Rufen z. B. verschiedene Lichtspektren den gleichen Farbeindruck hervor, nennt man das - vgl. u. - Metamerie.) |
Nach dem Weber'schen Gesetz („Delta R durch R ist k“ bzw. „Delta S durch S ist k“, wobei Delta für die JND, R/S für Reiz/Stimulus und k für die Konstante steht; nach Ernst Heinrich Weber, 1795-1878) steht die JND zur absoluten Größe des Standardreizes in einem konstanten Verhältnis. Der relative Unterschied bleibt also (außer im Extrembereich) gleich: die subjektiv empfundene Stärke von Sinneseindrücken (die Empfindungsintensität E) verhält sich, wie Fechner (s. o.) später ableitete (Delta E ist k mal Delta R durch R), proportional zum Logarithmus der objektiven Intensität des physikalischen Reizes. (Nach Integrierung erlaubt diese Formel, für jede Reizgröße die entsprechende Empfindungsstärke zu berechnen. Wenn also die Verzehnfachung einer objektiven Größe eine Steigerung der subjektiven Größe um z. B. vier Einheiten bewirkt, so sind bei einer weiteren Verzehnfachung wieder vier Einheiten zu erwarten. Die Beziehung zwischen Reiz- / Stimulusgröße und Empfindungsstärke / Reaktion ist also logarithmisch in S und linear in R.) Damit war bewiesen, dass psychologische Phänomene quantifiziert werden können.
Ein später entstandenes Modell zur Empfindlichkeitsmessung der Reizwahrnehmung ist die 1966 aus der Radartechnik entlehnte Signalentdeckungstheorie (signal detection theory) von John A. Swets (1928-2016) u. a., die Entscheidungsprozesse in die Psychophysik miteinbezieht. Die Berücksichtigung sensorischer Prozesse und motivationaler Faktoren ermöglicht die Einschätzung von - eventuell manipulierten - falschen Alarmen auf präsentierte Reize. Die beiden entscheidenden Parameter werden in der Terminologie dieser Theorie Sensitivität (Wahrscheinlichkeit, dass eine subjektive Wahrnehmung bei einer bestimmten Vpn. durch eine bestimmte Reizstärke ausgelöst wird oder nicht ausgelöst wird) und Antworttendenz (Wahrscheinlichkeit, mit der eine Vpn. bei Unsicherheit das Vorhandensein eines Signals vermutet oder nicht vermutet) genannt.
Ex.: Spielt man Probanden Geräuschproben vor, die z. T. nur Rauschen enthalten, z. T. einen kaum wahrnehmbaren Ton, sind die Leistungen der Vpn. (sie sollen einen Ton als Signal entdecken oder nicht entdecken) nicht nur von ihrer Detektionsfähigkeit oder davon abhängig, wie deutlich sich der Ton vom Rauschen unterscheidet, sondern werden auch von Faktoren wie z. B. Motivation, Vigilanz / Müdigkeit, Ablenkung, Information darüber, wie viel Prozent der Proben Töne enthalten usw. beeinflusst. Im Ex. könnte also eine Vpn. etwa dann falsch positive Antworten geben, wenn der Vl. jedes Mal dafür eine positive Rückmeldung gibt. (Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können bei der Einschätzung von Diagnosen aller Art helfen.)
- Adaptionsniveau: So nennt man das subjektive Bezugssystem zur Einordnung von Reizen (als z. B. stark / schwach etc.). Der Bezugsreiz, der dabei zum „Maßstab“ wird, heißt Ankerreiz. (Auch Nutzeneinschätzungen sind referenzabhängig. Wer gerade viel Geld verloren hat, wird sich über dieselbe Summe weniger freuen als jemand, der dazugewonnen hat; s. a. u.)
- Empfindung: Eine nicht weiter auflösbare psychische Erscheinung, die durch das Eintreffen eines (Sinnes)reizes (Stimulus) auf einen Rezeptor hervorgerufen wird, nennt man Empfindung (Sensation).
- Wahrnehmung: Wahrnehmung (Perzeption) definiert sich durch die Summe von Empfindung plus Erfahrung. Für Aristoteles stellt sie den Beginn des Wissens dar. Den Einfluss von Wissen und bereits Erlebtem auf die Wahrnehmung nennt man kognitive Penetration.
Vgl. die ausführliche SfN-Broschüre und Neuronale Netze
Die Leitungen - im zentralen Nervensystem ZNS bzw. dem peripheren System PNS - bilden eines von zwei wichtigen Informationssystemen des menschlichen Körpers. Insgesamt stehen allein etwa 2,5 Mio. ins Gehirn führende Fasern zur Verfügung, sodass dessen Verarbeitungskapazität mit ca. 100 MB pro Sekunde angenommen wird. Diesem Input stehen etwa 50 MB Output in Richtung der Effektorgane gegenüber, die über ca. 1,5 Mio. Nervenfasern abgehen. Neben der Input- und der Outputebene existieren Zwischenschichtneuronen (hidden layers), die durch Generalisierungen eine Ökonomisierung des Verarbeitungsvorganges ermöglichen. Zwar kann ein einzelnes Neuron „nur“ bis zu 300 Impulsen pro Sekunde bewältigen (im Unterschied zu den Milliarden Impulsen einer Computer-CPU), dies wird jedoch durch die hohe Anzahl der Nervenzellen wettgemacht. (Das zweite System - „wireless“ - ist das Hormon-/Botenstoffsystem, das über Drüsenausschüttung funktioniert, wobei ein Hormon - z. B. das von der Hirnanhangdrüse ausgeschüttete ACTH - ein anderes - z. B. das von der Zona fasciculata der Nebennierenrinde gebildete Cortisol - evozieren kann. Die Hypophyse selbst wird vom Hypothalamus durch das Corticotropin-Releasing-Hormon CRH angeregt. Im Unterschied zu Neuromodulatoren, die an Synapsen wirksam werden, arbeiten Hormone in der Blutbahn. - Vgl. a. o. „Neuromodulatoren“ u. u. „Stress“.)
ZNS und PNS bestehen aus einem cerebrospinalen Somatischen Nervensystem (das eine bewusste Reaktion ermöglicht) und einem autonomen (willentlich nicht direkt beeinflussbaren) Vegetativen Nervensystem. Letzteres gliedert sich in ein Parasympathisches System („Erholungsnerven“), ein Sympathisches System („Leistungsnerven“) und ein intramurales Enterisches System („Darmgehirn“).
- Erregungsbahn:
Der Weg eines Impulses nach der Erregung eines
Sinnesorgans lässt sich folgendermaßen Beschreiben: Reiz => Rezeptor => Nervenbahn => Gehirn (= afferente Bahn:
sie leitet Reize, auf Zellebene über die Dendriten, zu) =>
Verrechnung und Verarbeitung => Ausarbeitung einer Reaktion => Nervenbahn =>
Vollzugsorgane (Muskeln) (= efferente Bahn: sie leitet Erregungen,
auf Zellebene über die Neuriten, weiter) => Reaktion (vgl.
hier
Sketch von Otto Waalkes, *1948, ab 1:34).
Man unterscheidet adäquate Reize (solche, die oberhalb der Reizschwelle am entsprechenden Organ eine Reaktion auslösen) von inadäquaten Reizen (solche, die eine Fremdreaktion auslösen können, so wie z. B. der mechanische Druck auf das an sich für Lichtreize gedachte Auge eine Sehreaktion bewirken kann). Rezeptoren gliedern sich in Photorezeptoren (Licht, Sehen), Mechanorezeptoren (Druck, Schall, Spüren, Hören), Chemorezeptoren (Glukose, pH-Wert, Geschmack, Geruch) und Thermorezeptoren (Außen-, Körpertemperatur, Spüren). Sie können (bis auf die Photorezeptoren) neben äußeren auch uinnere Reize detektieren.
Alle eintreffenden Reize (also Energieveränderungen in den Zellen) werden zunächst 200-300ms unbewusst verarbeitet, bevor sie (wenn sie nicht subliminal, also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben) die Bewusstseinsschwelle überschreiten (primäre Unbewusstheit; dass Subzeption - also unbewusste „Wahrnehmung“ - wirksam werden kann, konnte bis heute nicht bewiesen werden). Die Verbindungen der Sinnes- bzw. Nervenzellen nennt man (s. a. u.) Synapsen. (Der Begriff stammt vom Begründer des Spezialfachs Neurologie Charles Scott Sherrington, 1857-1952, Medizin-Nobelpreis 1932. Als Begründer der modernen Neurowissenschaften gilt Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934. Er erhielt gemeinsam mit Camillo Golgi, 1843-1926, der entdeckt hatte, dass Neuronen miteinander auf elektrochemischem Weg kommunizieren, für die Arbeiten über die Struktur des Nervensystems 2006 den Medizin-Nobelpreis.)
- Sinnes- und Nervenzellen:
* Sinneszellen (Rezeptoren) finden sich auf (in) den
Sinnesorganen: Augen, Nase, Mund, Ohren, Haut. Sie sind den Nervenzellen (oft
über eigene Schaltzellen) vorgeschaltet.
Sinneszellen bilden die Voraussetzung für jedes Erleben (vgl. Radioaktivität,
Magnetismus: keine Sinneszellen - keine physiologische
Wahrnehmungsmöglichkeit!). Sie wandeln Reize in nervöse Erregung um.
* Nervenzellen (Neuronen) bilden sich in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, wobei nur diejenigen überleben, die sich mit anderen vernetzen. Es handelt sich um Zellen, die durch eine bestimmte Synapsenstärke etwas repräsentieren. Sie bestehen aus der Inputseite, wie sie der US-amerikanische Mediziner David Bodian, 1910-1992, der sich auch um die Entwicklung der Polioimpfung verdient gemacht hat, bezeichnet hat (Dendriten, Zellkörper / Perikarion, das den Zellkern mit der Erbinformation DNA enthält) und der Outputseite (Neuriten mit den von Markscheiden umhüllten Axonen). Die Myelinisierung der entsprechenden Zellabschnitte besteht in einer Ummantelung mit isolierenden Gliazellen, die die Reizweiterleitungsgeschwindigkeit entscheidend auf bis zu 110 m/sec erhöhen können (je dicker die Schicht desto schneller die Leitung), die jedoch immer wieder Stellen freilassen, die nach Louis-Antoine Ranvier, 1835-1922, als Ranvier'sche Schnürringe bezeichnet werden. (Bei der Erkrankung Multiple Sklerose wird diese Ummantelung vom eigenen Immunsystem angegriffen; es erfolgt schubweise eine Demyelinisierung, die schwere Bewegungsstörungen zur Folge hat.)
Die Neuronen enden exzitatorisch (fördernd) oder inhibitorisch (hemmend) an den Synapsen (1 Neuron im Gehirn hat bis zu 10 000 Synapsen, das ergibt allein dort etwa 1 Million Milliarden Nervenverbindungen). Regeneration von Nervenzellen im Gehirn ist meist unmöglich (s. u.), Funktionsübernahme manchmal schon. Die Zahl aller Sinnes- und Nervenzellen - sie sind durch Schaltzellen mit den Rezeptoren verbunden und können als Nuclei (im ZNS) oder Ganglien (im PNS) Verdickungen bilden - ist also (im Gegensatz zu ihrer Konfiguration) vermutlich großteils von Geburt an festgelegt (s. a. hier).
|
 |
Abb. 1/4: Nervenzelle (aus dem nicht mehr aktiven Web-Seminar Wie passt das Gehirn in den Kopf?)
Eine besondere Aufmerksamkeit erfuhren nach ihrer 1992 in einem Fall von Serendipität (s. u.) zufällig erfolgten Entdeckung an Affen die für die Möglichkeit zu Resonanz und Empathie zuständigen und vermutlich an der Entstehung der menschlichen Sprache beteiligten Spiegelneuronen (deren System bei Männern weniger aktiv und kleiner als bei Frauen ausgeprägt ist). In Folge-Ex.en von Giacomo O. Rizzolati (*1937) u. a. bestätigte sich, dass bestimmte Neuronen des (prä)motorischen Kortex sowohl feuern, wenn selbst eine bestimmte Bewegung gemacht wird, wie auch, wenn jemand bei der gleichen Bewegung beobachtet wird (s. a. u.).
* Synapsen (engl. auch gap junctions) befinden sich an den Endverzweigungen einer Nervenzelle (pro Neuron Tausende) und stellen die Verbindung zur nächsten Zelle her. Die Breite des synaptischen Spalts (synaptic cleft) beträgt etwa 200 Å. Über diese Distanz werden die Neurotransmitter, die in den Endknöpfchen in Vesikeln (Bläschen) vorrätig sind, „hinübergeschossen“. Ein Nervenimpuls alleine wäre in seiner Wirkung zu gering, erst die zeitliche und räumliche Summation bewirkt Entscheidendes. Synapsen können - abhängig vom Botenstoff - inhibitorisch (hemmend, mit e-negativer Potentialänderung; der Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure GABA wird ausgeschüttet) oder exzitatorisch (fördernd, mit e-positiver Potentialänderung; der Neurotransmitter Glutamat wird ausgeschüttet) wirken. Erregungs- und Hemmungsgradient stehen miteinander im Wechselspiel.
Entscheidend ist die Tatsache, dass Synapsen die ein- bzw. durchgehenden Signale gewichten. Sie reagieren auf Erfahrungen, indem sie ihre Stärke verändern, wenn domänenspezifische Impulse häufig drüberlaufen (vgl. u. Neuroplastizität). Nach einem Beispiel von Spitzer müsse man sich dies ähnlich den Spuren im Schnee rund um eine Punschhütte im Winter vorstellen, die an deren Zugängen und zwischen Hütte und WC stärker ausgeprägt sein werden als sonst auf der Wiese rundherum. (Zur Synapsenzahl im Gehirn s. u.)
- Ionentheorie der Erregung:
Die Reizweiterleitung ins Gehirn erfolgt saltatorisch (hüpfend) von
einem Ranvier'schen Schnürring
(einer nicht isolierten - s. o. -
Axonstelle) zum nächsten. Endstellen der Leitung sind die kortikale Detektoren,
die nicht in einer Punkt für Punkt-Zuordnung, sondern auf bestimmte Reizmuster
reagieren. Die grundlegende Entdeckung, dass elektrische Impulse
physiologisch eine Rolle spielen, stammt von Luigi
Galvanis (1737-1798) berühmten
Froschschenkelexperimenten. Der deutsche Physiologe Julius
Bernstein (1839-1917; vgl.
Bernstein-Zentren) postulierte 1868 zum ersten Mal die Hypothese, dass über
die Membrane der Neuronen positive Ionen Zugang ins Zellinnere hätten, die
negativ geladenen Teilchen dagegen in der extrazellulären Flüssigkeit blieben
und dabei nicht nur eine elektrische, sondern auch eine stoffliche Veränderung
vorgehe. Diese Potentialdifferenzen zwischen Zellinnenraum und flüssigem Äußeren
ließen 1952 Alan Lloyd
Hodgkin
(1914-1998) und Andrew Fielding
Huxley
(1917-2012) die Ionentheorie der Erregung (Nobelpreis 1963 gemeinsam mit John
Carew Eccles,
s. u.) entwickeln, die den in Frage stehenden Vorgang
folgendermaßen beschreibt:
* Depolarisation der Zellmembran: Ausgangswert (wenn kein Reiz eintrifft) sind -70 mV Ruhepotential an der Membran (außen positive Natrium- und negative Chlorionen, innen negative organische Stoffe und positive Kaliumionen, die nach außen streben; das Zellinnere ist im Vergleich zu seiner Umgebung negativ geladen). Der Beginn der Erregung besteht in einer Öffnung der selektiv permeablen Zellmembran, um die vorher ausgesperrten Natriumionen hereinzulassen.
* Generatorpotential (Rezeptorpotential): bildet sich durch die Depolarisation (Entladung) der Zellmembran, wenn positive Natriumionen einströmen. Dieses Potential bildet sich graduell, seine Größe ist von der Reizstärke abhängig. Es ist daher ein analoges Abbild des Umweltgeschehens.
* Aktionspotential: entsteht am Übergang von Perikarion und Axon (Initialsegment) durch Umwandlung des Generatorpotentials (wenn dieses zu schwach ist, erfolgt lediglich eine „lokale Antwort“ ohne Weiterleitung) in eine weniger störanfällige Form und wird nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz (erforscht von Edgar Adrian, 1889-1977; Medizin-Nobelpreis 1932) zur Synapse geleitet (entweder in voller Stärke oder gar nicht). Seine Häufigkeit (Frequenz) ist von der Reizstärke abhängig und proportional zur Größe des Generatorpotentials, seine Stärke ist immer gleich: etwa +35 mV).
* Natrium-Kalium-Pumpe: stellt die ursprünglichen Ionenverhältnisse wieder her. (Nach wenigen Millisekunden ist eine neue Depolarisation möglich.)
Vgl. interaktive Seite über Nervenleitung, die insgesamt pro Person eine geschätzte Strecke von 100 000 km aufweist.
Die zeitliche Abfolge der elektrischen Impulse zwischen den einzelnen Nervenzellen scheint zeitlich genau abgestimmt zu sein (Spike-Timing) und selbst Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Maximalgeschwindigkeit der elektrischen Impulse zum, vom und im Gehirn wird auf etwa 400 km/h geschätzt. In der Refraktärphase (dem Intervall während und nach einem Nervenimpuls) kann zunächst kein weiterer Impuls ausgelöst werden, danach ist die Reizschwelle kurz höher als normal. Der Zellstoffwechsel verlangsamt sich, wenn die Körpertemperatur sinkt. (Gehirnzellen werden z. B. bei manchen längeren medizinischen Eingriffen oder in komatösen Zuständen nach Reanimationen hypothermisch geschützt. Bestärkt wurde diese Art von Behandlung durch den berühmten Fall der schwedischen Ärztin Anna Bågenholm (*1970), die 1999 nach einem Skiunfall - abgekühlt auf 13,7° C Körpertemperatur - einen dreistündigen klinischen Tod ohne Gehirnschäden überlebte und fünf Monate später ihren Beruf wieder aufnehmen konnte. Vgl. hier)
„... καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ; ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην;“
„...ob es wohl das Blut ist, wodurch wir denken, oder die Luft oder das Feuer? Oder keines von diesen, sondern das Gehirn bringt uns alle Wahrnehmungen hervor, die des Hörens und Sehens und Riechens, und aus diesen entsteht dann Gedächtnis und Vorstellung, und aus Erinnerung und Vorstellung, wenn sie zur Ruhe kommen, entstehe dann auf diese Weise Erkenntnis?“
(Sokrates / Σωκράτης, 469-399 v. Chr. - s. u. - laut Platon / Πλάτων; 428/7-348/7 v. Chr. - s. u. - im Dialog Phaidon / Φαίδων, in dem dieser - Phaídon / Φαίδων von Elis, um 417 v. Chr. bis 4. Jhdt. v. Chr. - als Erzähler auftritt)
Für zusätzliche Informationen vgl. 3D-Gehirn, die umfassende SfN-Broschüre, https://www.dasgehirn.info („Der Kosmos im Kopf“ mit 3D-Animation), den Bayern-Alpha Videokurs „Geist und Gehirn“ (143 Folgen à 15min) von Prof. Manfred Spitzer, *1958, ein NuoViso Talk-Interview mit Spitzer über das Gehirn im Allgemeinen und die Beeinflussung seiner Entwicklung durch elektronische Medien im Besonderen, Neurobiologie (Kurs mit Links), die Darstellungen in Kenhub, den Gehirnatlas der Harvard University und vor allem The DANA Site for Brain Information. Vielfältige Informationen auch in W. Stangls Arbeitsblättern (s. im untersten Seitenbereich unter „Netzwerk Gehirn“), auf der BBC-Brainmap Science - The human body oder dasgehirn.info. Aktuelle bzw. populäre „Fragen an das Gehirn“ werden hier beantwortet. Vgl. auch neuroscript.com oder folgende Video-Erklärungen von Spitzer.
- Allgemeines:
Der Zusammenhang zwischen Gehirn, Geist, Ich-Bewusstsein etc.
war schon früh Gegenstand vielfältiger Spekulationen und Untersuchungen. Die
alten Griechen glaubten, die Persönlichkeit anhand der Physiognomie, des
Körperbaus oder der Gangart beurteilen zu können (vgl. a. u.). Eine
erste Übersicht über Gehirn und Nervensystem bot 1663 der Erfinder des Begriffs
„Neurologie“, Thomas Willis
(1621-1675). Schon Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) thematisierte das harte Problem des Bewusstseins (s. o.):
Man werde bei einer Untersuchung des Gehirns „nichts weiter als einzelne
Teile finden [...], niemals aber etwas, woraus eine Perzeption zu erklären wäre“. Von der ursprünglichen Idee des deutschen Arztes Franz
Gall (1758-1828), durch Phrenologie
(Begriff von Galls Schüler Johann
Gaspar Spurzheim,
1776-1832), aus der
Schädelform Charaktereigenschaften ableiten zu können, aber auch verschiedene
zerebrale Regionen mit unterschiedlicher Funktionalität anzunehmen, blieb höchstens die
heutige Überzeugung,
dass das Gehirn der Sitz der „Seele“ sei und bestimmte Areale unterschiedliche Zuständigkeiten haben, bestehen.
(Im
Science-Museum von Minnesota steht als Kuriosum ein Psychograph-Exemplar
des Phrenologiefans Henry C. Lavery,
1880?-1945?, ein Gerät, mit dem dieser in nur 90 Sekunden auf Grundlage der zu
vermessenden Gehirnstrukturen die Persönlichkeit eines Menschen auslesen und
kategorisieren zu können glaubte.) Thomas
Huxley (1825-1895; Großvater u. a.
des Schriftstellers Aldous Huxley,
1894-1963) verglich das Auftreten von Bewusstseinszuständen mit dem
„Erscheinen des Dschinns nach Aladdins Reiben der Wunderlampe.“
Aus heutiger Sicht stellt das Gehirn ein neuronales Netzwerk dar, das Inputinformationen zu kortikalen „Landkarten“ mit über 700 (einander tw. überlappender) Sektoren verarbeitet. Es entwickelt sich ab der 3. Schwangerschaftswoche (seine Aktivitäten sind aber nicht vor der 20. Woche messbar) und ist die zentrale Schaltstelle unseres gesamten Erlebens und Verhaltens, die nur im Zusammenhang mit der Wirkungsweise von Neuromodulatoren verstanden werden kann. (Bekannt sind über 100 vom Axonendköpfchen freigesetzte Transmittersubstanzen, Hormone etc.: Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Acetylcholin - dem ersten jemals entdeckten Neurotransmitter -, endogene Opioide, also Neuropeptide wie Endorphine, Oxytocin, Vasopressin und Glucocorticoide wie Cortisol.) Die Gesamtheit aller Nervenbahnen auf Zellebene wird als Konnektom bezeichnet, innerhalb dessen die neuronalen Bahnen komplexe Netzwerke bilden. Im Unterschied zum seriell (Schritt für Schritt) vorgehenden Computer wird die Verarbeitung der einströmenden Reize und die Speicherung der daraus folgenden Informationen in unseren Köpfen vom selben System parallel geleistet. Das Gehirn arbeitet nach Spitzer nicht sprachlich-symbolisch-logisch, sondern subsymbolisch (eher auf der Basis einer Vektorrechnung). Der Kortex (cortex cerebri = Großhirnrinde; die äußere Schicht, in der die höchsten Formen neuronaler Verarbeitung stattfinden), der nach manchen - möglicherweise übertriebenen - Schätzungen mit bis zu ca. 30 Mia. Neuronen etwa ein Drittel aller Nervenzellen des menschlichen Gehirns enthält, bildet neuronale Repräsentationen, die auf die von den Rezeptoren empfangenen Eingangssignale reagieren. Das Gehirn selbst hat keine Rezeptoren (auch keine Nozizeptoren; s. u.) und ist daher schmerzunempfindlich. Gehirnoperationen können also bei vollem Bewusstsein durchgeführt werden (und müssen dies tw. auch, um die Folgen eines Eingriffs sofort kontrollieren zu können).
Eine seit einiger Zeit auftauchende ethische Frage ist die nach dem so genannten Neuroenhancement, der künstlichen Steigerung mentaler Fähigkeiten („Gehirndoping“). Darunter werden utopische Gedächtnischips und reale Hirnschrittmacher genauso verstanden wie die tw. bereits verbreiteten NEPs (Neuroenhancement-Präperate). Verwendet werden Energydrinks, Amphetamine, Donepezil (ein Antidementivum), Methylphenidat (ein ADHS-Wirkstoff), Betablocker, Modafinil (ein schlafentzugskompensierendes Aufputschmittel), Smart Pills und andere Substanzen, die Suchtgefahr aufweisen und deren Wirkungen von ihren Nebenwirkungen weit übertroffen werden. (Vgl. a. u. Medikamentensucht; bereits im 19. Jhdt. wurde Doping mit leistungssteigernden Mitteln versucht, z. B. mit dem auch von Päpsten und Königen konsumierten Vin Mariani, einem mit Coca-Extrakten versetzten Wein.)
In diesem Zusammenhang wird philosophisch v. a. die grundsätzliche Problematik der (Selbst)optimierung (analog zur Schönheitschirurgie) bis hin zum Transhumanismus (der Überwindung der natürlichen Gegebenheiten) und seinen Gefahren (z. B. dem möglichen Verschwinden von Varianten, die evolutionär - für das Überleben einer Art auch unter unterschiedlichen Lebensbedingungen - notwendig erscheinen) diskutiert. Ethische Probleme entstehen auch dort, wo Verzerrungen der Selbstwahrnehmung in Kauf genommen werden oder KI-Algorithmen (s. u.) menschliche Entscheidungen ersetzen, wie dies bei manchen BCI-Systemen (s. u.) der Fall ist.
- Funktionen und Aufbau:
Nach Gerhard
Roth
(1942-2023)
umfasst das Gehirn 5 Funktionsbereiche:
| ° | die vegetative Funktion (Lebenserhaltung) |
| ° | die sensorische Funktion (Körperfühlsphäre) |
| ° | die motorische Funktion (Bewegungen) |
| ° | die kognitive Funktion (Informationsverarbeitung) |
| ° | die emotional-motivationale Funktion (Gefühle und Wille) |
Der Einfluss der archaischen, tiefen Hirnteile auf die phylogenetisch neueren, höheren (bottom up) ist - entgegen unserem Selbstbild vom rational gesteuerten Menschen - weit größer ist als umgekehrt (top down; dazu s. a. u.). Nach der Neuroplastizitätshypothese (s. u.) verändert sich das Gehirn durch den Gebrauch. (Zu den Ergebnissen der modernen Neurowissenschaften s. a. o. bzw. u. 1 oder u. 2.)

Abb. 1/5: Darstellung der verschiedenen Gehirnteile - ©WZ Grafik; Bildquelle Wiener Zeitung
Prinzipiell unterscheidet man im Zentralnervensystem ZNS die vier Mal so kräftig durchblutete graue Substanz (Substantia grisea; Nervenzellenkörper = Perikaryen) von der weißen Substanz (Substantia alba; Leitungsbahnen, Nervenfasern). Das Hirn schwimmt in seiner gelartigen Konsistenz in einem Liquorbad. Die Nervi craniales (12 Nervenpaare) verbinden das Gehirn mit den Zielorganen: Nervus olfactorius (Riechen), Nervus opticus (Sehen), Nervus oculomotoricus (Augenbewegung), Nervus trochlearis (Augenrollen), Nervus trigeminus (Gesichtssteuerung, Mittelohrmuskel), Nervus abducens (Augenseitdrehung), Nervus facialis (Mimik, Geschmack, Kopfdrüsen), Nervus vestibulocochlearis (Hören, Gleichgewicht), Nervus glossopharyngeus (Rachen, Geschmack, Ohrspeicheldrüse), Nervus vagus (Rachen und innere Organe; der wichtigste parasympathische Hirnnerv), Nervus accessorius (Muskelsteuerung im Nacken und Schulterbereich) und Nervus hypoglossus (Zungenbewegung). Die Aufgaben des Gehirns, das zusätzlich noch vier mit dem Rückenmarkskanal verbundene und mit Liquor gefüllte Hohlräume, die sogenannten Hirnventrikel, enthält, verteilen sich auf folgende Hirnareale (zum Aufbau s. auch folgende Illustrationen):
* Stammhirn (Medulla oblongata) mit Brücke (Pons; hier gehen alle Verbindungen zum Rückenmark hindurch): der phylogenetisch älteste Part, Teil des autonomen Nervensystems. Es steuert die lebensnotwendigen Vegetativfunktionen. Eine Verletzung ist meist tödlich. Das Areal, in dem die Verbindungen zum Klein- und Zwischenhirn und der 4. Ventrikel liegen, wird auch Rhombencephalon genannt.
* Zwischenhirn (Diencephalon; mit dem Stammhirn über das Mittelhirn / Mesencephalon verbunden. Für die Beschreibung dieses Hirnteils erhielt der Schweizer Walter Rudolf Hess, 1881-1973, 1949 den Medizin-Nobelpreis.) Das Diencephalon enthält den Thalamus (den „Torwächter des Bewusstseins“, der entscheidet, welche Informationen so wichtig bzw. neu sind, dass sie ins Großhirn weitergeleitet werden müssen), die paarig angelegte Amygdala (= Mandelkern, den „Panikschalter“ im Kopf; paarig angelegt), das limbisches System mit der (für das Gedächtnis - vor allem für das Einspeichern neuer Ereignisse - unumgänglichen) paarigen Hirnstruktur des Hippocampus, die (Melantonin produzierende) Zirbeldrüse etc. Es steuert phylogenetisch ältere Phänomene wie Gefühle und Instinkte, die Bewertung des Verhaltens (wiederholen / vermeiden) und das Gedächtnis. (Zu - da im Thalamus das männliche Kopulationsverhalten gesteuert wird, gerade in diesem Bereich auffälligen - Geschlechtsunterschieden zwischen Mann und Frau s. hier.)
| ° | eine vorgeburtlich geprägte, stammhirnnahe, vom (Oxytocin ausschüttenden) Hypothalamaus und der zentralen Amygdala repräsentierte untere limbische Ebene (reguliert angeborene Verhaltensweisen und elementare Affekte wie Flucht und Aggression, bestimmt unser - durch den Gehirnstoffwechsel der Mutter beeinflussbares und kaum zu veränderndes - grundgelegtes Temperament) |
| ° | eine frühkindlich geprägte, von der basolateralen Amygdala und dem mesolimbischen System gebildete mittlere limbische Ebene (verantwortlich für unbewusste emotionale Konditionierungen und Lernvorgänge bzw. Prägungen im Rahmen früher Bindungserfahrungen, Erkennen emotionaler Signale und Belohnungserwartung; sehr schwer veränderbar) |
| ° | eine in Teilen des v. a. orbitofrontalen Kortex verankerte obere limbische Ebene (steuert sozial-emotionale Verhaltens- und Erlebensweisen: bewusste Motive und Gefühle, Impulshemmung, Belohnungsaufschub, Frustrationstoleranz, Abschätzen von Handlungskonsequenzen, Empathie etc, also die sozial relevanten Persönlichkeitsmerkmale; durch neue Erfahrungen veränderbar). |
* Großhirn (Cerebrum, auch Endhirn / Telencephalon): besteht aus zwei durch einen aus etwa 200 Mio. Kommissurenfasern bestehenden Balken (= corpus callosum) verbundenen Hemisphären, die vom Neokortex, der gewunden ist, um die Oberfläche möglichst groß werden zu lassen und unser Bewusstsein (mit)erzeugt, bedeckt werden. Diese Rinde wird in vier Bereiche: Occipitallappen, Parietallappen, Temporallappen und Frontallappen und diese in 52 so genannte Brodmann-Areale (nach Korbinian Brodmann, 1868-1918) eingeteilt. Unter den beiden letztgenannten Lappen liegt verdeckt die Insula. Tiefer liegende, komplex verschaltete Neuronencluster (sie sind u. a. für Bewegungsabläufe zuständig) werden Basalganglien genannt. Auch die strukturierenden Windungen (Gyri) und Furchen (Sulci) haben Namen, z. B. Sulcus centralis (irrtümlich nach Luigi Rolando, 1773-1831, auch fissura Rolandi genannt, obwohl erstmals vom französischen Neuroanatomen Félix Vicq d’Azyr, 1748-1794, beschrieben). Evolutionär zuletzt ausgebaut wurde der präfrontale Kortex, der sich in den mitteldorsalen, den dorsolateralen, den ventrolateralen und den orbitofrontalen Kortex gliedert. Das Großhirn ist nach dem Modulprinzip aufgebaut, wobei ein Modul bis zu 10 000 Neuronen enthalten kann. (Man unterscheidet sieben Schlüsselmodule: visuelles Modul / Aufmerksamkeitsmodul / frontoparietales Kontrollmodul / somatomotorisches Modul / Salienzmodul / Ruhezustandsmodul / limbisches Modul; insgesamt existieren vermutlich wenige Hundert Module).
Als phylogenetisch jüngster Hirnteil überlappt es alle anderen und steuert Sensomotorik und über das pyramidale Bahnsystem Willkürbewegungen, ist der Sitz des Verstandes und enthält das Sprachzentrum (vgl. u. und Tutorial Sprache und Gehirn), das Arbeitsgedächtnis und kognitive Fähigkeiten. Im orbitofrontalen Kortex (einem der evolutionär jüngsten Areale; vorne über der Augenhöhle) werden Bewertungs- und Planungsvorgänge und ethische Einordnungen gesteuert, reflex- und triebhaftes Verhalten wird gehemmt. Hier ist der „Kontext des Handelns“ repräsentiert. Der erste diesbezügliche Nachweis erfolgte durch den historischen Unfall von Phineas Gage, 1823-1860, dem 1848 nach einer Explosion eine Eisenstange hinter dem linken Auge durch den Kopf fuhr und am Scheitel wieder austrat (s. hier). Dabei wurde sein Frontalhirn zerstört, was eine starke Persönlichkeitsveränderung mit dysexekutiven Störungen (s. a. u. ) bei gleichzeitigem Erhalt der intellektuellen Fähigkeiten zur Folge hatte. (Der Zusammenhang wurde damals noch nicht vollinhaltlich erkannt.)
Körperregionen sind sensorisch wie motorisch in unterschiedlich großem Ausmaß (je nach Häufigkeit der Eingangssignale) repräsentiert und verkehrt angeordnet. (Ähnlich Signale liegen nicht weit voneinander entfernt.) Die proportionale Darstellung der Körperteile gemäß den Projektionsfeldern im Gehirn (inzwischen auch dreidimensional verfügbar) ergeben das „Rindenmännchen“. Die erste diesbezügliche Darstellung („Gehirnlandkarte“) stammt vom US-kanadischen Gehirnchirurgen Wilder Penfield (1891-1976; er nannte sie Homunculus; s. Graphik u. - Penfield hat als erster im Ex. bei Vpn. durch elektrische Hirnstimulation Erinnerungen hervorgerufen, die zwingend und unveränderlich erlebt wurden (also nicht nur ein Wiedererinnern, sondern darüber hinaus ein Wiedererleben ermöglichten). Die von ihm und Harris daraus abgeleitete Idee eines Lebensskripts, das wie von einem Tonbandgerät vom Gehirn aufgezeichnet werde, beeinflusste später die TAA; s. u.).
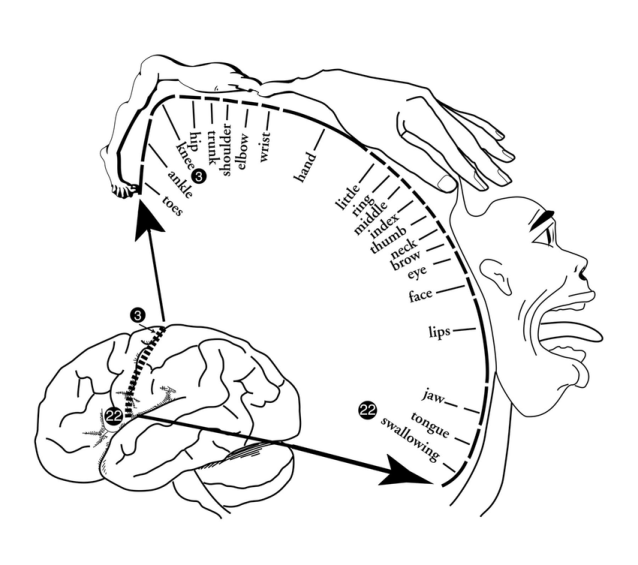
Abb. 1/6: Rindenmännchen (Penfield-Homunculus) - Bildquelle
* Kleinhirn (Cerebellum) mit zwei Hemisphären und Mittelteil („Wurm“, Vermis cerebelli): dieser alte Hirnteil ist für die Bewegungskoordination und das Halten des Gleichgewichts zuständig (und ist neueren Forschungen zufolge auch bei kognitiven Aufgaben beteiligt). Es weist, obwohl seine Masse nur etwa ein Zehntel des Großhirns ausmacht, viermal so viele Nervenzellen auf wie das gesamte restliche Hirn (darunter die als ästhetisch hochwertig geltenden Purkinje-Zellen, benannt nach dem böhmischen Physiologen Jan Evangelista Ritter von Purkyně, 1787-1869).
- Forschungsmethoden:
* Techniken:
Die Erforschung des Gehirns
hatte in früheren Zeiten zunächst das Ziel, eine Funktion-Areal-Zuweisung zu
erstellen. Heute liegt der Fokus auf bildgebenden Verfahren (Neuroimaging)
und Stammzellenforschung zum Verständnis der vielfältigen neurologischen Erkrankungen
(Migräne, Parkinson,
Schizophrenie, Schlaganfälle, Multiple Sklerose MS, Amyotrophe Lateralsklerose
ALS, Epilepsie, Tumore, Alzheimer
etc.; s. tw. u.).
Die Neurowissenschaft (vgl. a.
hier) bedient(e) sich dabei folgender
| ° | Läsionsfolgenanalyse: Durch Beobachtung der Folgen von Hirnverletzungen (früher v. a. an Kriegsinvaliden, später an Unfallopern) lassen sich Rückschlüsse auf Arealfunktionen ziehen. (So wurden z. B. die beiden Sprachzentren - s. u. - entdeckt.) |
| ° | Post mortem-Analyse: stellt während einer Obduktion Gehirnveränderungen fest (heute z. B. bei der Alzheimer-Erkrankung; s. u.) |
| ° | Tierversuche: ermöglichen Rückschlüsse aus der Beobachtung manipulierter Gehirne (v. a. von Mäusen) |
| ° | EEG: die Beobachtung von Aktivitätskorrelaten (Spezialfall SEP; s. u.) |
| ° | Röntgenaufnahmen (konventionell): aufgrund besserer Möglichkeiten (s. diesen Abschnitt) fast schon obsolet geworden (nach Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923; 1901 erster Physiknobelpreisträger) |
| ° | Kortikale Stimulation: Reizung einzelner Gehirnpartien mit Elektroden bei offenem Schädeldach mit dem Ziel, die Folgen zu beobachten; Diese Methode wurde zuerst von Walter Rudolf Hess (s. o.) und Erich von Holst (1908-1962) bei Tieren (vgl. Video von 1962) und 1941 zum ersten Mal von Wilder Penfield (1891-1976) bei Patienten, deren Schädel aus anderen Gründen ohnehin geöffnet werden musste, durchgeführt. |
| ° | Transkranielle Hirnstimulation TMS / Cranial electrotherapy stimulation CES: die moderne Variante der kortikalen Stimulation (das Schädeldach muss nicht aufgeschnitten werden) |
| ° | Medikamentöse Beeinflussung: Beobachtung der Folgen von verabreichten Pharmazeutika |
| ° | Reversible Funktionsblockierung: Einzelne Hirnteile werden temporär außer Kraft gesetzt, die Folgen beobachtet. Mit den Wada-Tests (1949 beschrieben von Juhn Atsushi Wada, 1924-2023: das Narkosemittel Natrium-Amytal wird in die Halsschlagader injiziert) können z. B. ganze Hemisphären blockiert werden, um deren Dominanz zu bestimmen (auch Intracarotid Sodium Amobarbital Procedure ISAP). |
| ° | Durchblutungsanalyse: bildgebendes Verfahren, das die unterschiedliche Hirnaktivitäten verschiedener Areale durch Einspritzen des radioaktiven Isotops Xenon-133 sichtbar macht (1972 vom Dänen Niels Lassen, 1926-1997, dem Schweden David Ingvar, 1924-2000, u. a. entwickelt). Stärker durchblutete und somit aktivere Regionen lassen sich so von schwach durchblutenden, also weniger aktiven, unterscheiden. |
| ° | Computertomograhie CT (von griech. τομή = Schnitt und γράφειν = schreiben; auch Computerized Axial Tomography CAT oder CT-Scan): sehr detailliertes röntgenbasiertes Verfahren, das das Gehirn in Schichten darstellen kann; unabhängig voneinander erfunden von Allan McLeod Cormack (1924-1998) und Godfrey Hounsfield (1919-2004); Medizin-Nobelpreis für beide 1979 |
| ° | MEG: Magnetenzephalographie; zum ersten Mal 1968 vom Physiker David Cohen (*1928) eingesetztes bildgebendes Verfahren ohne Strahlenbelastung, das vom Gehirn generierte magnetische Impulse aufzeichnet |
| ° | Kernspintomographie MRT (oder MRI für Magnetic Resonance Imaging): auf der Kombination von elektromagnetischen Wellen und künstlich erzeugten Magnetfeldern beruhendes bildgebendes Verfahren, das in Echtzeit die Verteilung der Wassermoleküle im Gewebe, dessen Dichte dadurch bestimmt werden kann, ermittelt. Basisannahme: Verstärkte neuronale Aktivität geht mit verstärktem Blutfluss einher. Grundlage für die durch einen Computer erstellten scharfen Schnittbilder ist die magnetische Kernresonanz (nuclear magnetic resonance NMR) der H-Atome im Wasser. |
| (2003 ging für die Entwicklung dieser Technik der Medizin-Nobelpreis an den US-Amerikaner Paul C. Lauterbur, 1929-2007, und den Brite Peter Mansfield, 1933-2017. Bereits 1952 hatten Felix Bloch, 1905-1983, und Edward Mills Purcell, 1912-1997, für die grundlegende Entdeckung der Magnetresonanz den Physik-Nobelpreis erhalten. Die Resonanzmethode zur Aufzeichnung der magnetischen Eigenschaften von Atomkernen entdeckte der altösterreichisch gebürtige US-Amerikaner Isidor Isaac Rabi, 1898-1988; Physik-Nobelpreis 1944.) | |
| ° | Funktionelles Neuroimaging: + Positronenemmissionstomographie PET: erzeugt mittels radioaktiver Substanzen, die beobachtbare Tracer (blutflussabhängige Stoffwechselindikatoren) bilden, Schnittbilder. + Funktionelle Magnetresonanztomographie fMRT: im Unterschied zur herkömmlichen Kernspintomograhie bildet sie das Sauerstoffaufkommen in definierten Hirnteilen während der bei vollem Bewusstsein erfolgenden Bewältigung verschiedener Aufgaben ab und ermöglicht so eine genaue Darstellung der Energieverteilung im Gehirn. fMRT gilt als Revolution in den Methoden der Neurowissenschaft. + Diffusions-Tensor-Magnetresonanztomographie DTI (Diffusion Tensor magnetic resonance Imaging): Sie benutzt die Diffusion von Wassermolekülen im unterschiedlich gearteten Gewebe, um Faserstrukturen darzustellen. |
| ° | Zap-and-zip-Methode: ein von Giulio Tononi (*1960) u. a. entwickeltes neurowissenschaftliches Verfahren, dessen Ergebnis der Perturbational Complexity Index PCI, mit dem verschiedene Bewusstseinszustände aufgrund provozierter Hirnvorgänge errechnet werden können, ist. Der PCI wird dadurch gewonnen, dass mit transkranieller Magnetstimulation elektrophysiologische Aktivitäten im Gehirn evoziert werden, deren Stärke, Dauer und Komplexität nach einer EEG-Analyse durch einen Algorithmus im PCI ausgedrückt werden. Mit diesem errechneten Wert lassen sich zumindest drei Gruppen von Bewusstseinsgraden komfortabel unterscheiden (klinisch wache, sedierte und Komapatienten; s. a. u.1., u.2 und hier). |
| ° | Endoskopie der Liquorräume: Manche flüssigkeitsgefüllten Höhlen des Gehirns können durch Einfuhr von kamerabestückten Endoskopen sichtbar gemacht und tw. auch chirurgisch behandelt werden. |
| ° | Organoid-Erzeugung: Durch die Verwendung pluripotenter Stammzellen, die aus dem eigenen oder einem fremden Organismus gewonnen werden, kann man in der Petrischale (erfunden 1887 von Julius Richard Petri, 1852-1921) „Minigehirne“ (gezüchtete Zellstrukturen) erzeugen und untersuchen. (Durch künstliche Beimengung von bestimmten Genen lassen sich aufgrund der Forschungen von 山中 伸弥 / Shin'ya Yamanaka, *1962; Nobelpreis 2012, Körperzellen in induzierte pluripotente Stammzellen - iPS-Zellen - umprogrammieren.) - Vgl. z. B. hier |
* Projekte: 2013 wurde das Human Brain Project der EU begonnen (s. a. hier; Laufzeit bis 2023 mit Nachfolgeprojekten), das eine Computersimulation des Gehirns und aller seiner Abläufe zum Ziel hat. Es soll - in Berücksichtigung der Tatsache, dass die Funktion von Neuronen durch ihre Konnektivität bestimmt wird - ein Schaltplan eines kompletten Gehirns entstehen. Bei Kosten von 600 Mio € entstanden ca. 3000 Fachpublikationen von mehr als 500 Beteiligten. Ein erster Durchbruch gelang 2020 mit dem Julich-Brain (der bis dahin detailliertesten 3D-Darstellung der enzephalischen Zellularstruktur, entstanden mithilfe des Supercomputing Center in Jülich JSC; s. hier). Die digitale Plattform EBRAINS bündelt Daten aus allen Disziplinen und inkludiert einen zoombaren Human Brain Atlas („Google Maps des menschlichen Gehirns“). Weitere Ziele sind personalisierte Computermodelle von Patientenhirnen und das Messbar-Machen von Bewusstseinsstufen vom wachen Ich zur völligen Bewusstlosigkeit (s. a. o.) durch Forschergruppen in Mailand und Lüttich. (Vgl. folgendes Video aus der Reihe Brain matters)
Fast gleichzeitig gab der 44. US-Präsident Barack Hussein Obama ii (*1961) in den USA den Startschuss zur BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies; auch Brain Activity Map Project), die die diesbezügliche Forschung voranbringen und dabei einen Schwerpunkt auf Methodenentwicklung legen will.
In Österreichs größter epidemologischen Studie P10 (für Paracelsus 10 000 nach dem gleichnamigen in Salzburg verstorbenen Schweizer Arzt; eig. Theophrastus Bombast von Hohenheim, 1493-1541) werden seit 2013 in Salzburg die Alterungsprozesse des Menschen untersucht. Seit 2020 (geplant bis 2027) steht dabei im von Nathan Weisz (*1977?) geleiteten Projekt BrainAge (Integrated Structure-Function Approaches for Quantifying Brain Age; s. hier) die Hirngesundheit im Mittelpunkt. Mit der Verwendung von MEG (s. o.), das über die strukturellen Bestimmungen hinaus funktionelle Einblicke gibt, und anderen bildgebenden Verfahren sollen - unter Überschreitung der Methoden der epigenetischen Uhr (s. u.) - das jeweilige Hirnalter möglichst genau bestimmt und die modifizierenden Einflussfaktoren detektiert werden.
Darüber hinaus besteht seit 2014 (Abschluss der Pilotphase 2018) das Projekt GenomAustria (s. hier), bei dem das Forschungszentrum CeMM und die Wiener Medizinuniversität zusammenarbeiten. 2003 wurde ein Abkommen mit Deutschland geschlossen, das die wechselseitige Nutzung der (freiwillig zur Verfügung gestellten) Daten erlaubt. 2024 entstand durch eine EU-Initiative das Genome of Europe-Projekt, mit dem GenomAustria kooperiert. Die Genomsequenzierungen als Beitrag zur öffentlichen Gesundheit erreichten dadurch einen historischen Höchststand.
- Daten:
(tw. nach John
Carew Eccles, 1903-1997; Nobelpreis 1963,
Spitzer u. a.)
* Fläche der Rinde: ca. 1200 cm² pro Hemisphäre bei 3 mm Dicke
* Gewicht: etwa 2% des Körpergewichts, im Durchschnitt 1245g bei Frauen (mit geringerer Körpermasse!) und 1375g bei Männern (abnehmend ca. ab dem 25. Lebensjahr); ± ca. 0,1 kg (Neandertaler: 1,5 bis 1,6 kg, erste Menschen: 0,6 kg). Nach Kernspintomographieuntersuchungen scheint höhere Gehirnmasse ein (schwaches) Korrelat höherer Intelligenz zu sein. Das höhere Gewicht bei Männern generiert allein aber keine Intelligenzunterschiede. (Laut Spitzer wisse niemand wirklich, was die Männer mit den 4 Mia Extrazellen eigentlich machen.) Möglicherweise haben Männer größere, Frauen jedoch effizientere Gehirne. (Da schwere Frauenhirne schwerer als leichte Männerhirne sind, ließ sich ohne Vorinformationen lange Zeit nicht erkennen, ob ein Gehirn männlich oder weiblich sei. Die britische Neurobiologin Gina Rippon, *1950, meinte, das Gehirn sei „no more gendered than the heart“. Eine 2024 von der Stanford University unter der Leitung von Vinod Menon, *1973?, entwickelte KI - s. u. - konnte jedoch 90% der ihr zur Analyse vorgelegten Hirnscanbilder den Geschlechtern richtig zuordnen.)
Günstig scheint eine Kombination aus hohem absoluten Hirngewicht (wie es z. B große Wale oder Elephanten aufweisen, die aber weniger Neuronen und damit eine geringere Vernetzung aufweisen als der Mensch) und hohem relativen Hirngewicht (z. B. bei Kolibris oder Spitzmäusen) bei gleichzeitig relativ großem Kortex und hoher Anzahl von Zellen und Synapsen zu sein. Der Mensch hat den höchsten Enzephalisationsquotienten (er bezeichnet das Verhältnis von tatsächlichem Hirngewicht und dem Gewicht, das aufgrund des Körpergewichts zu erwarten ist) und zeichnet sich zusätzlich durch eine hohe Berechnungskapazität (s. o.) aufgrund der enormen Neuronen- und Synapsenanzahl seines Gehirns aus.
* Zahl der Zellen: Das gesamte Gehirn weist nach begründeten Schätzungen ca. 86 Mio. Neuronen auf. Auf der ca. 0,25 m² großen und 5 mm dicken Großhirnrinde (K/Cortex) existieren etwa 22,8 Mia Nervenzellen bei Männern, 19,3 Mia bei Frauen (= etwa 1/5 des gesamten Gehirns). Viel mehr (kleinere) Neuronen liegen im Kleinhirn, das 7/8 des gesamten ZNS ausmacht. Jede Nervenzelle hat bis zu 10 000 Kontakte, das ergibt etwa 100 km Leitungen. Neben den Neuronen existiert eine zweite große Gehirnzellengruppe: die Gliazellen (von unterschiedlicher Anzahl, entdeckt von Rudolf Virchow, 1821-1902; von griech. γλία = Leim), die verschiedene Aufgaben erfüllen (Stützfunktion, Versorgungsfunktion und eventuell auch begleitende Informationsverarbeitungsfunktion). Die Länge aller Nervenbahnen im Gehirn, dessen Berechnungskapazität bei Weitem die aller anderen Lebewesen der Erde übertrifft, beträgt ca. 5,8 Mio. km pro Person (= 145facher Erdumfang). Im Laufe des Lebens ist mit einer Abnahme von 10% der Neuronen zu rechnen. (Die Schätzungen gehen auf eine 1997 publizierte Arbeit der Neurostereologen Bente Pakkenberg, 1949-2023, und Hans Jørgen Gundersen, 1943-2021, zurück.)
Entgegen einem jahrzehntelangen Dogma scheint adulte Neurogenese (Neubildung von Neuronen) auch im Erwachsenenalter, z. B. im für das Gedächtnis unumgänglichen Hippocampus und im Riechkolben, unter gewissen Umständen möglich. (Vgl. Artikel auf S. 212 der folgenden Zeitschrift oder das Ex. chinesischer Wissenschaftler an der Universität von Kalifornien unter der Leitung von Xiang-Dong Fu, *1960?, bei dem sich in einem Fall von Serendipität - s. u. - unverhofft Neurone in der Petrischale bildeten, nachdem aus Tumorzellen ein bestimmtes Protein entfernt worden war; s. hier. Dies könnte die Heilungschancen für neurodegenerative Erkrankungen in Zukunft drastisch erhöhen.) Im Großen und Ganzen sind jedoch alle Neuronen bei der Geburt vorhanden. Es wachsen im Laufe der Zeit (z. T. domänenspezifisch) die Dicke der Fasern sowie - vor allem am Beginn des Lebens - die Anzahl der Verknüpfungen.
* Synapsenzahl: nach neueren Schätzungen 1 Million Milliarden (Quelle: Vortrag Wien 20. 4. 2007 Manfred Spitzer, *1958), andere Quantifizierungen sprechen von 100 Billionen neuronalen Verbindungen im Gehirn, also immer noch weit mehr, als die Milchstraße Sterne hat. Die Signalübertragung erfolgt durch Ionenströme elektrisch entlang des Axons (s. o.; neuere Untersuchungen prüfen, ob auch eine mechanische Übertragung durch Druckwellen möglich sein könnte). Innerhalb der ersten 2 Lebensjahre bilden sich fast im Sekundentakt Millionen Synapsen, danach werden die Verbindungen beim Lernen tendenziell nicht mehr, sondern stärker (oder eben nicht) und (wenn sie überflüssig sind) zum Teil bis zur Pubertät aus energieökonomischen Gründen wieder entfernt (cortical thinning). Diese besondere Form der Synapseneliminierung nennt man Pruning („Zurechtstutzen“; sie erfolgt im Schlaf). Verbindungen, die redundant oder nicht mehr funktional sind, werden abgebaut, was zu einer Art Feinabstimmung der synaptischen Verbindungen führt.
* Sauerstoffmanagement: Täglich strömen mehr als 1000 Liter Blut durch das Gehirn, wobei durch Autoregulation trotz unterschiedlicher funktioneller Aktivitäten die Aufrechterhaltung eines konstanten Durchflusses gewährleistet wird. Je kompetenter Benutzer sind, desto weniger Aufwand müssen ihre Gehirne treiben (s. u.). Das (proteinbedürftige) Gehirn neigt prinzipiell zum Energiesparen. Obwohl es jedoch nur ca. 2% des Körpermasse ausmacht, verbraucht es schon im Ruhezustand 20% des Energievorrates (Sauerstoff). Ist das Bewusstsein zugeschaltet (selten! - s. u.), erhöht sich der Aufwand auf 50% und mehr. Den Zustand des problemlosen Zusammenarbeitens aller - in einem Gleichgewicht befindlichen - Hirnteile in stresslosen Situationen nennt man Kohärenzzustand.
* Rechenleistung: Nach von Chalmers - s. o. - (der es für möglich hält, menschliche Gehirne dereinst unter Überwindung der drei potentiellen Hürden Intelligenz, Bewusstsein und Identität auf Computer hochladen zu können) 2022 in seinem Buch Realität+ - Virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie referierten Schätzungen führt ein Gehirn das Äquivalent von 1016 (10 Billiarden) Gleitkommaoperationen pro Sekunde (engl. FLOPS = floating point operations per second) durch.
- Hirnhälftentheorien:
* Allgemeines: Die Hirnhälften steuern die
Körperhälften über Kreuz (= Kontralateralität; nur der Geruchssinn ist ipsilateral) und kommunizieren
miteinander über das Corpus callosum (den Balken, ein
200 Millionen Exemplare starkes Kommissurenfaserbündel, das z. B. bei Vögeln tw. inexistent ist). Eine der beiden Hemisphären (meist die linke) enthält das Hauptsprachzentrum und
ist „dominant“, was meist mit der Lateralität / Händigkeit - s.
Linkshänderseiten - gekoppelt
ist: bei Rechtshändern (ca. 85%)
ist die linke und ganz selten die rechte Hälfte dominant, bei Linkshändern (ca.
15%) die
rechte und manchmal die linke Hälfte; die andere bezeichnet man als
subdominant. (Nicht immer ist die Ausprägung 100%ig, Mischformen sind möglich.
Beim Verschränken der Arme liegt z. B. bei Rechtshändern meist der linke Arm
oben - Umlegen ist schwierig.) Im Prinzip steuert die linke Hemisphäre
das analytische, konvergente Denken und die Zeitwahrnehmung, die rechte das synthetische,
divergente Denken und die Raumvorstellung. (Diese Schematisierung wird nicht
mehr überall zur Gänze geteilt.) Die Entstehung der Händigkeit ist noch nicht
100%ig verstanden. Sie ist jedenfalls zumindest teilweise genetisch bedingt und
ein Phänomen der Spezialisierung.
* Funktionsübernahme: Wie der US-Amerikaner Karl Spencer Lashley (1890-1958) als erster entdeckt hat, kann bis zu einem gewissen Grad eine Hemisphäre, vor allem in der Kindheit, Funktionen der anderen übernehmen, wenn diese zerstört oder entfernt wurde. Amputation einer Hälfte in späterem Alter hat halbseitige Lähmung und entsprechende Ausfälle anderer Funktionen (je nach Dominanz) zur Folge. Amputation beider Hälften reduziert den Menschen zu einem rein vegetativen Dasein. (Das Gehirn ist im Prinzip fast lebenslang dazu in der Lage, eine Umorganisation des Kortex vorzunehmen - etwa, wenn aufgrund getrennter und wiederhergestellter Nervenbahnen Neurepräsentationen vorgenommen werden müssen oder einfach eine neue Sprache erlernt wird. Je älter jedoch ein Gehirn ist, desto weniger leistungsfähig wird es diesbezüglich arbeiten können.)
* Split-brain-Exe von Roger W. Sperry (1913-1994; Medizin-Nobelpreis 1981): Bei Patienten mit einer Callosotomie (= Trennung des Balkens, notwendig in seltenen Fällen gewisser multifokaler therapieresistenter Epilepsieformen) erfolgt eine bewusste Verbindung zur Außenwelt nur über eine, die dominante Hemisphäre. Beide Hirnhälften können also unabhängig voneinander funktionieren, aber jede mit ihrem eigenen Bewusstsein. (Zur Diskussion dieses Sachverhaltes s. hier.) Sperry schickte Informationen (z. B. musste mit der linken Hand, die mit der rechten Hemisphäre verbunden ist, oder mit der rechten Hand, die mit der linken Hemisphäre verbunden ist, ohne Sichtkontakt eine Schere und ein Blatt Papier ertastet werden) in jeweils nur eine Gehirnhälfte (die ja aufgrund des durchtrennten Balkens diese Impulse nicht in die andere weiterleiten konnte) und beobachtete die Reaktionen: Beide Vg. konnten den Auftrag, das Ertastete sinnvoll zu verwenden, erfüllen (sie durchschnitten das Papier), aber nur die, deren dominante Hemisphäre die Informationen bearbeitet hatte, waren in der Lage, darüber Auskunft zu geben, was sie getan hatten. (Bereits im 18. Jhdt. hatte Félix Vicq d’Azyr, s. o., angenommen, dass eine Durchtrennung des Balkens zwei voneinander unabhängige Gehirne erzeugen würde; s. a. hier.)
Ist das Fehlen der Kommissurenfaserverbindungen hingegen angeboren, bildet das Gehirn, wie Fernanda Freire Tovar-Moll (*1976) 2014 in Rio de Janeiro nachgewiesen hat, alternative Verbindungen zwischen linker und rechter Hemisphäre.
|
|
Abb. 1/7: nach http://dieprojektmanager.com/linke-und-rechte-gehirnhaelfte-test/
-
Aktivierungsniveau:
Das EEG und andere Verfahren (s. o.)
belegen, dass das Gehirn auch im Ruhezustand nie völlig inaktiv ist, sondern
verschiedene Bewusstseinszustände aufweisen kann. (Der
Begriff Aktivierungsniveau geht auf Elizabeth
Duffy, 1904-1970, zurück.) Das Default Mode Network
DMN sorgt für eine übergeordnete Überwachung. Zunehmende Aufmerksamkeit (und
damit kürzere Reaktionszeiten) erhöht die Amplitude bestimmter SEP-Komponenten,
v. a. den Beginn der sekundären Potentiale (s. u.).
Man unterscheidet
| ° | Gesteigertes, fokussiertes Bewusstsein (Aufmerksamkeit, die von außen veranlasst oder willentlich gesteuert sein kann; vgl. hier. Voraussetzung ist Salienz, die Bewusstseinszugänglichkeit von Reizen.) |
| ° | Wachheit (Vigilanz; zu ihrer Überprüfung und Schulung wird seit dem 2. Weltkrieg der ursprünglich zweistündige, für Air Force-Piloten entwickelte Cambridge- oder Mackworth Watch Clock-Test - nach Norman H. Mackworth, 1917-2005 - verwendet. Nach ca. 30 min lässt die Aufmerksamkeit meist deutlich nach; online z. B. hier) |
| ° | Reduziertes Bewusstsein (Dösen) |
| ° | Benommenheit (Somnolenz) |
| ° | Tagträumen, „Narrenkastl“ (Trance) |
| ° | Regungslosigkeit (Stupor) |
| ° | Fehlendes Bewusstsein in Form von + Ohnmacht (Synkope): kurz, plötzlich auftretend + Bewusstlosigkeit: länger als ein, zwei Minuten dauernd + Stufen des (Wach)komas mit unklaren Bewusstseinsgraden + Apallisches Syndrom mit Hirnstammreflexen, ev. Tagesrhythmus, aber ohne Umweltinteraktion + Locked-in-Syndrom mit Bewegungsunfähigkeit und nur scheinbarer Bewusstlosigkeit trotz Wachzustands, verursacht meist durch Apoplexien - s. u. - an der Vorderseite des Hirnstammes + Irreversibler Hirntod, der das entscheidende Kriterium für die Todeserklärung darstellt und eventuell der Startschuss für eine Organentnahme sein kann |
Der Bewusstseinsgrad von Patienten nach Kopfverletzungen wird mit der 1974 von Graham Teasdale (*1940) und Bryan Jennett (1926-2008) entwickelten Glasgow-Koma-Skala beurteilt. Dabei werden insgesamt 3 bis 15 Punkte in den Bereichen Augenresponse (bis zu 4), verbale Antworten (bis zu 5) und motorische Antworten (bis zu 6) vergeben. Alles unter 8 gilt als schwere, alles über 12 als leichte Hirnverletzung. (Erfolgt keine Reaktion in einem der drei Bereiche, wird dies mit 1 Punkt bewertet.)
Die häufigsten Ursachen für Bewusstseinsverlust sind Kopfverletzungen, Epilepsie (s. u.), Vergiftungen (s. u.), Gefäßerkrankungen (z. B. Apoplexiae cerebri; s. u.), Infektionen, Raumforderungen durch Kopftumore und Stoffwechselprobleme.
Bewusstsein (s. dazu auch u.1, u.2 und o.; das Wort „Bewusstsein“ wird im heutigen Sinne seit dem 17., 18. Jhdt. analog dem lat. „con scientia“ = „mit Wissen“ verwendet und wurde von C. G. Jung - s. a. u. - 1950 in Die Lebenswende so definiert: „Das Abweichen vom und das Sich-in-Gegensatz-Setzen zum Instinkt schafft Bewusstsein.“) kann heute entgegen einem öfters formulierten „Neuroreduktionismus“ („Geist ist nichts anderes als das Feuern von Neuronen“) als eine emergente (unerwartet hervortretende, nicht direkt ableitbare) Eigenschaft des Gehirns betrachtet werden, die dort mit einer synchronisierten Aktivität von Zellverbänden einherzugehen scheint. Diese im präfrontalen Kortex PFC (der bei Frauen früher fertig ausgebildet und größer ist) vermuteten neuronalen Korrelate entsprechen den für eine spezifische Bewusstseinserfahrung notwendigen minimalen Hirnaktivitäten (NCC-Ansatz - neural correlates of consciousness - von Francis Crick, 1916-2004; Nobelpreis 1962, und Christof Koch, *1956). Crick war 1995 aufgefallen, dass speziell der PFC bei bewusstlosen Personen weniger Aktivität zeigt als bei bewussten. Koch wettete 1998 mit Chalmers - s. o. -, dass innerhalb der nächsten 25 Jahre ein definierbares neuronales Korrelat von Bewusstsein eindeutig identifizierbar sein werde - und verlor 2023 eine Flasche Wein (vgl. hier oder hier). Chalmers hatte die Frage, warum die Reiz- und Informationsverarbeitung von einem erlebten Innenleben begleitet werde, wie also aus elektrochemischen Vorgängen (deren Erforschung das „einfache / leichte Problem des Bewusstseins“, also die Frage, wie das Gehirn Umweltreize verarbeite, beantworte) Denken und Fühlen entstehen könne bzw. warum es überhaupt Qualia gebe, als „hartes (schweres) Problem des Bewusstseins“ bezeichnet. Auch das Problem des Fremdpsychischen (Wie können wir wissen, ob andere Geist haben und wenn ja, wie er beschaffen ist?) lässt sich nicht trivial lösen.
Der portugiesische Neurowissenschaftler António Damásio (*1944; s. a. u.) meint: „Bewusstsein ist ein Geisteszustand, in dem man Kenntnis von der eigenen Existenz und der Existenz einer Umgebung hat.“ Ob jemand bei Bewusstsein ist oder nicht, wird heute neuropsychologisch mit der von Giulio Tononi (*1960) und Marcello Massimini (*1970) entwickelten Zap-and-Zip-Methode entschieden (s. a. o.). Dabei wird im Ex. die Komplexität der Hirnvorgänge mithilfe starker, auf verschiedene Gewebeareale ausgerichteter magnetischer Impulse und des dadurch ausgelösten Neuronenfeuers eingeschätzt und auf Basis dieser Daten auf das Vorhandensein von Bewusstsein rückgeschlossen. Ex.e des britischen Neurowissenschaftlers Anil Kumar Seth (*1972; s. u.) legen nahe, dass bei Bewusstseinsveränderungen (z. B. durch Narkose) nicht einzelne Hirnregionen an- bzw. später wieder angeschaltet werden, sondern dass die funktionelle Konnektivität (die Kommunikation einzelner Hirnteile) ab- und zunimmt.
Die Frage, ob auch Maschinen Bewusstsein haben oder in Zukunft erlangen werden (zumindest sensorische Eindrücke für kognitive Prozesse zur Verfügung stellen bzw. ein komplexes Netzwerk, das in seiner Struktur Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung codiert, bilden werden können), wird von Neurowissenschaftlern unterschiedlich beantwortet. Tierisches Bewusstsein gilt hingegen in Abstufungen als sicher. Jonathan Birch (*1986; vgl. hier) u. a. postulieren fünf mehr oder weniger realisierte
Bewusstseinsdimensionen:
| ° | perzeptive Reichhaltigkeit (die Fähigkeit, viele Details einer Wahrnehmung unterscheiden zu können) |
| ° | evaluative Reichhaltigkeit (die Fähigkeit, positive Verstärker von negativen unterscheiden zu können) |
| ° | Integration (die Fähigkeit, Sinneseindrücke zu einer einheitlichen Wahrnehmung verbinden zu können) |
| ° | zeitliche Stabilität (die Fähigkeit, vergangene Erfahrungen für künftiges Verhalten nutzbar zu machen) |
| ° | das Selbst (die Fähigkeit, in einer Theory of mind - s. u. - Perspektivwechsel vornehmen zu können) |
Zu neueren Bewusstseinstheorien s. u., zu Aufmerksamkeit und Vigilanz vgl. a. folgendes Video, zum Schlaf s. u.
* EEG = Elektroenzephalogramm (ἐγκέφαλος, gr.: Gehirn; eig. das, was „im Kopf“ ist) ermöglicht einen direkten Zugang auf die Aktivierungszustände des Menschen. Es stellt die elektrischen (und durch die Fourier-Analyse - benannt nach Jean Baptiste Joseph Fourier, 1800-1850, - bereinigten) Ableitungen aus dem Gehirn dar. (Schon 1875 leitete Richard Caton, 1842-1926, elektrische Aktivitäten von der Gehirnrinde von Kaninchen und Affen ab, 1924 entwickelte der Jenaer Psychiater und Telepathie-Anhänger Hans Berger, 1768-1830, ein Enkel des Dichters Friedrich Rückert, 1788-1866, das moderne EEG). Die Wellen sind ein Korrelat (eine Begleiterscheinung, im Gegensatz zum Substrat, der Sache selber) des Erregtheitsgrades eines Menschen:
|
Übersicht: EEG-Wellen (Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma) |
| δ-Wellen: | Tiefschlaf, Trance, Koma (0,1-3 Hz, polymorph, große Amplitude) |
↑ ↓ |
langsam, niedrigfrequent schnell, hochfrequent |
| θ-Wellen: | Einschlafen, Wachträumen, Hypnose, Tiefenentspannung (4-7 Hz) | ||
| α-Wellen: | entspannter Wachzustand, nach innen gerichtete Aufmerksamkeit (8-13 Hz, regelmäßig) | ||
| β-Wellen: | nach außen gerichtete Aufmerksamkeit, höhere Aktivität, Hektik, Stress (14-30 Hz) | ||
| γ-Wellen: | intensive Konzentration, Verarbeitung komplexer Information (>30 Hz, bis ca. 70 Hz, kleine Amplitude) |
Alle hirnelektrischen Aktivitäten, die als Reaktion auf ein äußeres
(reizinduziertes) oder inneres Geschehen (z. B. Vorstellungen) auftreten, werden
Synchronaktivität genannt. (Aus der zweiten Möglichkeit entstand die
Idee, dass allein die Imagination einer Bewegung z. B. eine Prothese würde
steuern können.) Das EEG wird im klinischen Bereich vielfach eingesetzt, wo es
z. B. durch die charakteristischerweise bei dieser Erkrankung auftretenden
Spikes and Waves zur Epilepsiediagnostik herangezogen wird. Darüber hinaus
kann das EEG als Aktivitätskorrelat z. B. der Schlafforschung dienen. Ex: Durch
Bio-Feed-Back (immer, wenn α-Wellen
auftreten, ertönt ein Signal) kann Entspannung erreicht werden. Die erst seit
ca. 2015 auf Anstoß von Bradley Voytek
(*1980?; vgl. Video-Kurzvortrag)
näher erforschte, bei genauerer Analyse erkennbare aperiodische Aktivität (rosa
Rauschen, eine Art elektrisches Zittern) gibt möglicherweise Hinweise auf den
Wachheitsgrad von narkotisierten Komapatienten.
Vgl.
What is the
function of the various brainwaves? (Scientific American)
* SEP: 1947 gelang es dem britischen Neurologen George Duncan Dawson (1912–1983) zum ersten Mal, innerhalb des EEG ein sensorisch evoziertes Potential (ein durch eine spezifische Sinneswahrnehmung hervorgerufenes, auch im Schlaf auftretendes qualitäts- und intensitätsabhängiges Potential, das als Synchronaktivität für jede Modalität typisch ist) abzunehmen: Es ermöglicht durch die (nachrichtentechnischen) Methoden der Mittelungstechnik bzw. der Superpositionstechnik den Nachweis einer Sinneswahrnehmung auch ohne Rückmeldung des Probanden (z. B., wenn das Gehör eines Säuglings oder eines aus psychiatrischen Gründen Simulierenden überprüft werden soll). Primär sind diese modalitätsspezifischen Potentiale Ausdruck von Wahrnehmungsvorgängen, sekundär Korrelate kognitiver Prozesse und noch später Korrelate des Verhaltens. Sie bilden nicht die objektive, sondern die erlebte Wirklichkeit ab.
* Moderne bildgebende Verfahren (s. o.) zeigen oft mehr als nur das Aktivierungsniveau an und können z. B. auch bei der Kopfschmerzdiagnose eingesetzt werden. (Zu Kopfschmerzen vgl. hier und die Seiten der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft bzw. der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft)
- Der Schlaf:
Vgl. Schlafmedizin, Schlafforschung
Der Schlaf (immerhin fast ein Drittel unseres Lebens) ist das für uns Menschen
wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm und eine lebensnotwendige
Erholungsphase, in der neurotoxischer „Abfall“ beseitigt wird. Nach der
Hypothese der synaptischen Homöostase von Tononi
(s. o.) und Chiara
Cirelli (*1968?; vgl.
Video) werden im Schlaf die Synapsen
heruntergeregelt, das Dickicht des Nervengeflechts wird gestutzt (vgl.
a. o. „Pruning“). Der Beginn des
Schlafs ist immer mit einem Absinken der Körperkern- und der Gehirntemperatur
verbunden, wodurch die Geschwindigkeit in den Ionenkanälen der Neurone
gedrosselt wird. Man schläft ein, wenn man am schnellsten abkühlt. Die
Vasodilatation (Erweiterung der Blutgefäße) in den Extremitäten unterstützt
die Temperaturabsenkung im Gehirns. Je tiefer der Schlaf, desto langsamer feuern
die Nervenzellen, deren Aktivität sich während dieser Phase synchronisiert.
Im Schlaf sind wir - allerdings in geänderter Bewusstseinslage (meist bewusstlos) - manchmal aktiver als in einigen wachen Abschnitten, der Energieverbrauch des Gehirns ist im Schlaf ca. genauso groß wie im Wachzustand. Eine scharfe Trennung zwischen Schlaf- und Wachzustand ist nicht möglich. (Auch während des Tages existieren Trancezustände, sodass sich eine der im nächsten Abschnitt abgebildeten ähnliche Kurve auch für die Wachzeiten zeichnen ließe; s. a. u.) Mangelnder Schlaf (weniger als ca. 6 bis 7 Stunden) über einen längeren Zeitraum erhöht das Alzheimer-Risiko (s. u.) und führt zu einer Schwächung des Immunsystems, Konzentrationsstörungen, Lernproblemen, Bluthochdruck (damit in der Folge zu Herz-/Kreislaufproblemen und Schlaganfällen) und letztlich zum Zusammenbruch des Körpers, da die notwendige restaurative Funktion unterbunden wird. Die erforderliche Schlafdauer ist genetisch, die reale durch die Lebensumstände beeinflusst. Durchschnittlich schlafen Frauen und junge Menschen mehr als Männer und alte, die allerdings oft untertags den mangelnden Nachtschlaf ausgleichen. Auch jüngere Menschen empfinden kurzfristige Schlafphasen (ca. 10 bis 15 min.; man nennt sie Power Naps) untertags manchmal als angenehm. Zu wenig Schlaf begünstigt u. a. Kurzschlussreaktionen, wie Matthew Walker, *1974, in Ex.en nachgewiesen hat, und erhöht langfristig das Demenzrisiko (s. u.) in späteren Lebensjahren drastisch (bei weniger als sechs Stunden um ca. 30%), da im Schlaf das glymphatische System (2013 entdeckt von Maiken Nedergaard, *1957; s. hier) das Gehirn von toxischen Eiweißen reinigt. Entfallen diese Wartungsaufgaben, reduziert dies letztlich die Restlebenszeit. Wenn darüber hinaus keine Verdauungsaufgaben mehr zu bewältigen sind (da spätabends - und vorzugsweise nach der letzten Mahlzeit 18 Stunden am Stück - nicht mehr gegessen wurde), setzt Autophagie ein, ein Prozess, der beschädigte, tw. potentiell cancerogene Zellteile abbaut. (Über die Bedeutung des Schlafs für Lernvorgänge s. u.)
* Schlafphasen:
| ° | Absinkphase (zunächst überwiegen α-Wellen) und (als Übergang) hypnagoger Zustand |
| ° | Leichtschlafphase, die insgesamt ca. die Hälfte der Schlafzeit ausmacht |
| ° | Tiefschlafphase, die im Laufe der Nacht immer kürzer und weniger tief wird |
| ° | Leichtschlafphase, die insgesamt ca. die Hälfte der Schlafzeit ausmacht |
| ° | (Fast)aufwachphase, die immer länger dauert und knapp vor dem tatsächlichen Erwachen wieder in eine Tiefschlafphase übergeht. |

Abb. 1/8: Quelle: Zeitschrift Format (Nr. 43 / 23.10.2000)
Der Zyklus dieser unterschiedlich tiefen 5 Schlafphasen wird in 8 Stunden etwa 5mal durchlaufen. Nicht unbedingt der „Schlaf vor Mitternacht“, aber der erste Schlaf ist der wichtigste. Die erste Phase ist die tiefste und längste. Dann wird der Schlaf immer flacher. (Ex: Konsequentes Wecken nach etwa 90 min scheint bei manchen Menschen eine entscheidende Verkürzung der Schlafdauer ohne Qualitätsverlust zu ermöglichen, wenn die erste Schlafphase etwa vier Mal pro 24 h genutzt wird.) Gesteuert wird der Schlaf-Wach-Rhythmus - der natürliche Zyklus wäre eigentlich 25 h lang - von den etwa 10 000 Neuronen des Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus über der Sehwegkreuzung, ausführend beteiligt sind alle Zellen des Körpers. Die Hormone Melantonin und Serotonin spielen die entscheidende Rolle; vgl. u.).
Biologischer Sinn des zyklischen Schlafens: Die Aufmerksamkeit und damit die Möglichkeit, eventuelle Gefahren zu bemerken und auf sie zeitnah reagieren zu können, ist nur relativ kurz und nicht mehrere Stunden permanent gestört. (In früheren Jahrtausenden war dies überlebensnotwendig, in der heutigen Zivilisation hat sich die Anzahl Gefahren drastisch reduziert.) Bei manchen Tieren, z. B. Delphinen und Walen, die ja zum Atemholen immer wieder auftauchen müssen, schlafen (wie auch bei manchen Zugvögeln) die beiden Gehirnhälften abwechselnd. („Halbhirnschlaf“; vgl. Scientific American: How do whales and dolphins sleep without drowning?)
* REM: Der REM-Schlaf wurde zum ersten Mal von Eugene Aserinsky (1921-1998) und William Dement (1928-2020; Begründer des ersten Schlaflabors in den USA) entdeckt und beschrieben. In den Leichtschlafphasen (in denen man schwer weckbar ist, obwohl man kurz vor dem Erwachen steht: „Paradoxer Schlaf“), den so genannten REM (= Rapid Eye Movement)-Phasen, die vom Locus coeruleus im unteren Teil der Brücke gesteuert und von einer REM-Schlaf-Atonie (muskuläre Lähmung, die bis in den wachbewussten Zustand auftreten kann und dann Schlafparalyse genannt wird) bei intensiver Gehirnaktivität begleitet werden, hat man lebhafte, oft erinnerbare Träume (deren Ausagieren jedoch aufgrund der von der Paralyse blockierten Muskeln verhindert wird). Sie werden im Laufe der Nacht länger, die erste ist die kürzeste. Wiederholtes Wecken am Beginn der REM-Phasen bedeutet Neurotisierung. Versäumte REM-Phasen können (und sollten) noch einige Tage nachgeholt werden („REM-Rebound“).
REM-Phasen treten auch pränatal auf und machen bei Babys bis zu 8 Schlafstunden aus. Sie konnten mit folgendem Ex. auch bei Tieren nachgewiesen werden: Affen, die darauf konditioniert wurden, bei Ablauf eines Filmes einen Knopf zu drücken, um einen leichten Stromschlag zu verhindern, taten dies auch während des Schlafes - wohl deshalb, da sie ihre Traumbilder analog den Filmsequenzen erlebten. Zumindest bei Säugetieren und Vögeln sind Träume bekannt (s. hier), Reptilien und wirbellose Kraken zeigen zumindest wechselnde Schlafphasen.
* Traum: Unter „Traum“ versteht man eine sinnliche Bewusstseinsform während des Schlafes. Die Definition des Begriffs ist weniger trivial als großteils vermutet. Die Bandbreite reicht von jeder Form mentaler Aktivitäten im Schlaf bis zum Erleben erzählender Bilder. Neben der oft unvermutet hohen Gehirnaktivität im Schlaf existieren aber auch umgekehrt niedrige Bewusstseinsstufen während der Wachperiode („Tagträumen“ als in eine Wachphase eingebettete Schlafphase, die man REM-Intrusion nennt, oder das „Starren ins Narrenkastl“) und Klarträume (luzides Träumen, das während des paradoxen Schlafs auftreten kann), bei denen sich die Träumenden (Oneironauten=Traumreisenden) der Tatsache bewusst ist, dass sie träumen, deren Auftreten und Inhalt man bis zu einem gewissen Grad steuern und die man zur Verbesserung von Bewegungsabläufen nutzen kann. (Die Häufigkeit von Klarträumen lässt sich durch TMS - s. o. - erhöhen.) Geträumt wird zu ca. 80% in den REM-Phasen (s. nächster Abschnitt). Beteiligt ist das im Schlaf nicht vollständig ausgeschaltete unspezifische Nervensystem (ARAS = aufsteigend retikuläres Aktivierungssystem). Man rechnet mit etwa 20% Traumanteilen am Gesamtschlaf (in der Kindheit mehr, im Alter weniger). Ein Großteil der Inhalte fällt auf Grund des während des Schlafes vergleichsweise inaktiven Hippocampus der Traumamnesie zum Opfer. Die Erinnerbarkeit von Träumen hängt von individuellen Faktoren und dem zeitlichen Abstand zum Erwachen ab. (Will man seine Träume notieren, sollte dies unmittelbar nach dem Erwachen geschehen.) Häufig sind Alpträume und Wunschträume. Der Anteil färbiger Träume ist seit 1900 deutlich angestiegen.
Quellen der Trauminhalte: Nachgewiesen
ist der Einfluss äußerer (z. B. Weckerläuten, das
im Traum - meist in illusionärer Verkennung - erscheint) oder innerer Reize (z. B. Hunger) sowie sogenannter Tagesreste
(unverarbeiteter Erlebnisse, die im Traum, z. T. verschlüsselt, wiederkehren).
Vermutlich durch die Inaktivität des präfrontalen Kortex verliert der Träumer
jeden Sinn für Kritik, sodass bizarre, unrealistische Inhalte kein Erstaunen
auslösen. Die Darstellung von logischen Relationen, Kausalbeziehungen und
dialektischen (widersprüchlich) Denkfiguren ist nicht mit der des Wachzustands
gleichzusetzen oder fehlt (wie die Alternative
„Entweder-Oder“)
völlig. Die meisten Träume erscheinen visualisiert, ca. 70%
sind emotionalisiert (davon ²/3 unlustbetont,
möglicherweise, um die Träumenden durch diese Simulation wie eine Impfung - so Delphine
Oudiette, *1984? - besser auf
reale Situationen vorzubereiten: wer mehr negativ träume, leide später real
weniger). Am häufigsten scheinen Angstträume und
Träume von Situationen des Scheiterns zu sein
(vgl. die über über Jahrzehnte hinweg geführten Traumregistrierungen des österreichisch-USamerikanischen
Psychiaters, begnadeten Wienerliedsängers, Aggressions- und Terrorforschers Friedrich Hacker,
1914-1989, - „Kein Massaker ohne Hacker“
-; verstorben während einer ZDF-Fernsehdiskussion). Auch
geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Trauminhalte konnten
nachgewiesen werden; z. B. träumen Frauen etwa gleich häufig von Frauen und
Männern, Männer hingegen überwiegend von Männern.
Weiteres zum Traum:
s. u.
* Schlafkorrelate: Die Schlafüberwachung erfolgt gegebenenfalls in Schlaflabors. Dabei werden in einer Polysomnographie alle sich im Laufe der Nacht verändernden Begleiterscheinungen des Schlafs beobachtet: das EEG (s. o.; zeigt sog. Schlafspindeln), das EMG (Elektromyogramm; bei vielen Menschen tritt am Übergang vom Wach- zum Schlafzustand Myoklonie, also Muskelzucken, auf, selten - und dann pathologisch - von akustischen Halluzination begleitet), das EOG (Elektrookulogramm; weist die REM-Phasen nach), die Atemfrequenz, die Pulsfrequenz, die Sauerstoffsättigung (mittels Pulsoxymeter zeigt sich der prozentuelle Anteil des Hämoglobins am Blut), das EKG, (gibt die Herzfrequenz und andere kardiale Parameter an; in heutiger Form vom Niederländer Willem Einthoven, 1860-1927; Medizin-Nobelpreis 1924, entwickelt) und über Kameras die im Schlaf auftretenden Körperbewegungen und -positionen.
* Schlafanomalien:
| ° | Bruxismus: meist harmloses, oft unter Stress auftretendes Zähneknirschen während des Schlafs |
| ° | Somniloquie: Sprechen im Schlaf; kann als unverständliche Vokalbildung, aber auch differenzierte Rede (oder gar nicht) auftreten. Verneinungen kommen überproportional häufig vor. Auch Dialoge zwischen schlafenden und wachen Personen sind möglich. Meist besteht nach dem Aufwachen keinerlei Erinnerung an die Somniloquie. |
| ° | Somnambulismus (Schlafwandeln, „Mondsüchtigkeit“; vgl. Somnambulismus): tritt meist im ersten Schlafdrittel auf und ist an den Nicht-REM-Schlaf gebunden, da in den REM-Phasen die Skelettmuskulatur erschlafft. |
| ° | Pavor nocturnus: Reines Aufschrecken aus dem Schlaf mit teilweisem Erwachen unter Angstzuständen ohne lebhafte Traumabfolgen, das ebenfalls meist im ersten Schlafdrittel auftritt und nach dem Aufwachen nicht erinnerbar ist. |
| ° | Trypanosomiasis: Afrikanische Schlafkrankheit, die eine durch den Stich einer Tsetsefliege (Glossina morsitans) ausgelöste Infektion zur Grundlage hat, an deren Endstadium Schlafsucht auftritt |
| ° | Narkolepsie: unkontrolliertes Einschlafen trotz ausreichender Nachtruhe, das oft in emotionalen Momenten auftritt und tw. mit Kataplexie (Muskeltonusverlust) einhergeht; eine neurologische Erkrankung, die ca. 1 von 2000 Menschen betrifft (s. a. hier) |
| ° | Schlafparalyse (japan. kanashibari; s. o.) |
| ° | Schlafentzug: Freiwillig oder von außen herbeigeführter Schlafentzug wirkt zunächst euphorisierend, ist jedoch gesundheitsgefärdend (letztlich letal) und wird auch als Foltermethode eingesetzt. Schlafentzug führt durch die Stimmungsschwankungen zu einer Störung des impressiven Wahrnehmungsvermögens (der Fähigkeit, eintreffende Reize nicht nur rein sachlich zu erfassen, sondern auch - z. B. als angenehm oder unangenehm - spüren zu können). |
Insgesamt leiden in Österreich zwischen 5 und 10 % der Bevölkerung an störenden Schlafanomalien (Tendenz steigend). Die allgemeinen Begriffe lauten Insomnie (für Schlaflosigkeit), Hypersomnie (für übermäßige Schläfrigkeit), Parasomnie (für unerwünschte Schlafereignisse). Am häufigsten treten Ein- oder Durchschlafstörungen und Rhythmusstörungen (unerwünschte Schlafzeiten) auf. Die Folgen sind oft Tagesmüdigkeit (bis zu ETS = exzessive Tagesschläfrigkeit), Konzentrationsprobleme und Stimmungsschwankungen.
Vgl. a. Ratgeber DGSM, Patienteninformationen der ÖGSMSF)
- Neuere Ergebnisse der
Hirnforschung (s. a.
o1 oder
o2):
* Allgemeines: Allgemein gilt, „dass das wichtigste Sinnesorgan unser Gedächtnis ist“ (Gerhard Roth, (s. o.).
99% an Inhalten seien dort vorhanden, nur 1% komme neu dazu. Die Hälfte des
Gehirns ist mit dem beschäftigt, was wir sehen, wobei das Gehirn autonom und,
ohne dass wir das bemerken, darüber entscheidet, welche Informationen neu oder wichtig
genug für die Weiterleitung an das Bewusstsein sind (vgl. das 1999 entwickelte
und 2004 mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnete
Ex.
„Selective Attention Test“
von Daniel Simons,
*1969 und Christopher Chabris,
*1966). Zu viele Informationen auf einmal überfordern uns und können
nicht alle bewusst verarbeitet werden. Es kommt zur Inattantional Blindness,
die uns selbst starke Reize nicht verarbeiten lässt, wenn wir uns auf andere
konzentrieren. (Vgl. auch Ex.
F-Test oder
The Colour Changing Card
Trick.)
In der Rangfolge der Sinne dominieren der Tastsinn und der Gleichgewichtssinn
alle anderen Sinne, innerhalb derer sich das Hören dem Sehen unterordnet. Vgl.
Ex. McGurk-Effekt:
visuelle Eindrücke beeinflussen die Wahrnehmung eines akustischen (Sprach)signals
(entdeckt von Harry McGurk;
1936–1998; s. Video).
Das Gehirn steuert die nach dem oben beschriebenen Reizleitungssystem funktionierende
Sinneswahrnehmung (vgl. The Senses)
folgender fünf Sinnesorgane: Auge, Ohr, Nase, Zunge, Haut. Die (wahrscheinlich
erbliche, oft schon in der Kindheit mit einer Prävalenz von ca.1 bis 2%+ auftretende) Fähigkeit, mit mehreren Sinnen
gleichzeitig wahrzunehmen, nennt man
Synästhesie (z. B. Töne zu sehen, Farben zu hören,
Graphem-Farb-, Klang-Geschmack-Synästhesie etc.). Es handelt sich dabei nicht um
Gedankenverbindungen (Assoziationen), sondern um simultane Wahrnehmungen. Bis zu
4% der Bevölkerung sind dazu in der Lage - bei Künstlern vermutlich mehr (z. B.
der Maler Василий Васильевич Кандинский / Wassily
Wassiljewitsch Kandinsky,
1866-1944, oder die Musiker Hans Zimmer,
*1957, und Billie Eilish,
*2001). Eine mögliche Ursache dieses Phänomens könnte in einem inkompletten
Pruning (s. o.) liegen. Es existieren
genetische Gemeinsamkeiten mit Autisten, jedoch keine gleichartigen
Schwierigkeiten im täglichen Lebensvollzug. Im Unterschied zum Stimmenhören von
schizophrenen Personen werden etwaige synästhetisch wahrgenommene Töne immer
„innen“,
vom eigenen Gehirn produziert, erlebt.
(Vgl. Gesellschaft für Synästhesie)
* Gehirnentwicklung: Aufgrund von Hirnscans Tausender Menschen aller Altersstufen, die 2025 an der Universität Cambridge unter der Leitung von Duncan Astle (*1982?; s. a. hier) durchgeführt und nach verschiedensten Kriterien ausgewertet wurden, nimmt man fünf Phasen der Gehirnentwicklung an, die sich im Laufe des Lebens nicht gleichmäßig entwickeln, sondern durch die Beobachtung eines viermaligen Umbaus (turning points; durchschnittlich im 9., 32., 66. und 83. Lebensjahr) klar abgrenzen lassen:
| ° | Childhood: Konsolidierung des kortikalen Netzerkes, graue und weiße Hirnmasse wachsen, Zunhme der Kortexstärke, Stabilisierung der Faltungen |
| ° | Adolescence: Weitere Volumsvergrößerung der weißen Hirnsubstanz, Verfeinerung der Verdrahtung und damit der Organisation des Kommuniktionsnetzwerks, Steigerung der Gehirneffizienz, Zunahme des Risikos für mentale Störungen |
| ° | Adulthood: Erst jetzt - nach dem stärksten topologischen Umbau der gesamten Entwicklung - gilt ein Gehirn als erwachsen; Stabilisierung der Gehirnarchitektur, Erreichen eines Plateaus von Intelligenz und Persönlichkeit, Unterteilungen festigen sich |
| ° | Early Ageing: Langsame Abnahme der Konnektivität, Abbau der Netzwerkdichte |
| ° | Late Aging: Schrumpfung der Substantia alba, Veränderung der globalen Hirnarchitektur zu einer regionalen |
* Selbst-System und freier Wille: Die Verschaltungen im Gehirn werden durch drei prägende Prozesse bestimmt: die Evolution der Gene, die erfahrungsabhängige frühkindliche (Hirn)entwicklung und lebenslange Lernprozesse. Das dabei entstehende „Ich“ (an dem das auf Intuition ausgerichtete System der Spiegelneuronen, s. o., und das kognitiv ausgerichtete Selbst-System - drei im ventromedialen präfrontalen Kortex, im posterioren cingulären Kortex bzw. in der temporo-parietalen Junction mittels fMRT, s. o., lokalisierbare Nervenzellennetzwerke, die als „minimal self“ das aktuelle Selbstgefühl speichern, biographische Aspekte verarbeiten bzw. den Unterschied zwischen Selbst und Nicht-Selbst erfassen - beteiligt sind) bzw. der Begriff „Person“ müssen im Lichte der Erkenntnisse der modernen Neurobiologie neu diskutiert werden (vgl. dazu folgendes Video-Interview mit Wolf Singer bzw. Video-Vortrag „In unserem Kopf geht es anders zu, als es uns scheint“). Auslöser zahlloser Überlegungen war das
Libet-Ex.:
| „Experimente, die als Beweis dafür dienen sollen, dass unser Gehirn
hinter den Kulissen die Führung übernimmt, führte der amerikanische Physiologe Benjamin Libet (1916-2007) in den
1980er Jahren an der University of California in San Francisco durch. Er bat
Versuchspersonen, auf deren Kopf er Elektroden angebracht hatte, zu einem
willkürlich gewählten Zeitpunkt eine Hand zu bewegen. Die von den Elektroden
aufgezeichneten Aktivitätsschwankungen zeigten ein so genanntes
Bereitschaftspotenzial an, das schon rund eine halbe Sekunde vor der
willkürlichen Handbewegung auftrat. Doch den Probanden wurde ihre Absicht, die
Hand zu rühren, laut einer parallel laufenden Zeitmessung erst eine
Viertelsekunde vor der Ausführung bewusst. Daraus schloss Libet,
dass das Gehirn den Entschluss zur Handbewegung bereits gefasst hatte, bevor
dieser ins Bewusstsein trat. Das schien zu besagen: Unbewusste Hirnprozesse
trafen die Entscheidung. Nach neueren Untersuchungen mittels funktioneller
Magnetresonanztomografie (fMRT) beginnt die unbewusste Vorbereitung von
Entscheidungen sogar noch früher. 2013 legte der Neurologe John-Dylan
Haynes
(*1971; vgl. Video-Vorträge) vom
Bernstein Center for Computational Neuroscience in Berlin [auch am Max
Planck-Institut für Kognition
und Neurowissenschaften in Leipzig; benannt nach dem deutschen Physiker Max Planck,
1858-1947; Anm.] Versuchspersonen in einen
fMRT-Scanner und ließ ihnen die freie Wahl, zwei Zahlen entweder zu addieren
oder zu subtrahieren. Aus den neuralen Aktivitätsmustern ließ sich schon
ganze vier Sekunden, bevor den Probanden ihre Entscheidung bewusst wurde,
vorhersagen, welchen Rechenweg sie einschlagen würden.“ (Zitiert nach https://www.spektrum.de/news/wie-frei-ist-der-mensch/1361221; zu diesen Vorgängen vgl. auch folgende Video-Dokumentation. - Zu den technischen Methoden s. o.) |
Dieses berühmt gewordene Ex (die Hirnaktivität sagt bereits Sekunden vor einer bewussten Entscheidung diese Entscheidung vorher; die motorische Handlung wird eingeleitet, bevor sie der Vp. bewusst wird) zog eine bis heute andauernde Diskussion über das Vorhandensein eines freien Willens (in diesem Zusammenhang s. a. u.1 oder u.2) beim Menschen bzw. über den Zusammenhang zwischen freiem Willen und Bewusstsein (s. a. o.) nach sich. Die definitorischen Voraussetzungen einer freien Willenshandlung werden gemeinhin in den drei Prinzipien des Anderskönnens (Vorhandensein von Handlungs- bzw. Entscheidungsalternativen), der Urheberschaft (Abwesenheit entscheidender Außenfaktoren) und der Autonomie (eigener bewusster Absichten) gesehen. (Interessanterweise erlebt man die durch eine elektrische Stimulation am Kortex - also durch das eigene Gehirn - ausgelöste Bewegung einer Hand nicht als selbst verursacht.)
Einerseits meinte man, dass die Verzögerung den freien Willen an sich nicht beeinträchtigen würde, sie verhindere nur sein zeitgleiches Bewusstwerden (und Bewusstsein sei gar kein Konstituens von Freiwilligkeit). Folgeuntersuchungen, die die Entscheidung von einem vorher ausgesandten Reiz abhängig machten, wiesen zudem nach, dass das Bereitschaftspotential schon vor Auftreten dieses Reizes auftrete und daher nicht determinierend wirke. Die Frage sei nicht, ob, sondern wodurch unsere Entscheidungen bestimmt seien. Der Wille sei frei von Zufall und Zwang, aber bedingt durch unsere Erfahrungen.
Gerhard Roth
(s. o.)
hält den freien Willen hingegen für eine „nützliche Illusion“ und Entscheidungen für frei
lediglich in dem Sinne, dass man auch anders hätte handeln
können. Die Frage sei jedoch, ob alle Faktoren ihres Zustandekommens bewusst
gemacht werden können. Auch Wolf
Singer leugnet den freien
Willen, dennoch seien wir Entscheidungskonflikten ausgesetzt. Das Gehirn sei ein
sich selbst organisierendes komplexes System mit hochgradig nichtlinearer
Dynamik, das alle unsere Entscheidungsprozesse - die bewussten, die unsere
„Vernunft“ trifft, und die automatischen, die uns nicht bewusst werden und die
den ersteren widersprechen können - vorbereite. Ähnlich argumentiert Daniel
Merton Wegner
(1948-2013; s. u.),
wenn er aufgrund seiner Exe. (v. a. dem
einem Computerspiel nachempfundenen I Spy-Experiment) meint, dass
eine artifiziell mit Leichtigkeit erzeugbare Kontrollillusion beweise, dass der
freie Wille „der beste Trick des Geistes“ sei. Nicht bewusste Absichten, sondern
Gehirnereignisse seien ursächlich für Entscheidungen. Man halte sie für selbst
verursacht, wenn unmittelbar davor ein mit dem Vorgang konsistenter Gedanke
erlebt werde. António
Damásio
(*1944) behauptet in seiner Hypothese der somatischen Marker, dass
Emotionen (s. u.)
verkörperlicht und so die Grundlage menschlichen Entscheidungsverhaltens bilden
würden. (Die Trennung zwischen Körper und Seele - s. o.
-
bezeichnet er als Descartes'
Irrtum. Stattdessen bestehe ein unauflösbarer Zusammenhang.)
Zu diesem Komplex vgl.
hier
* Bewusstseinstheorien (zum Bewusstsein s. auch o.1 bzw. o.2 und u.): Die Neurowissenschaften verneinen heute die „Lichtschaltertheorie“, dergemäß sich Bewusstsein (eventuell stufenweise) ein- und ausschalten ließe, zugunsten eines Facettenreichtums entsprechender Gehirnzustände und vertreten folgende (hier nach Gehirn&Geist 03_2022, S. 24 und Gehirn&Geist Dossier 05_2023, S. 20f wiedergegebenen), jeweils unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt stellenden
Theorien zum Bewusstsein:
| ° | Global Workspace Theorie GWT (u. a. nach Bernard Baars, *1946): Jene Signale, die vom Thalamus, dem Torhüter des Bewusstseins, als Informationsstrom in verschiedene Hirnareale verteilt werden, stehen als bewusste mentale Inhalte für kognitive Prozesse (z. B. das Gedächtnis) zur Verfügung, wenn diese wie auf eine „aufgeklappte“ Akte (angesiedelt im Stirn- und Scheitellappen) zugreifen. Nicht alle sensorischen Stimuli erzeugen eine „Zündung“ (ignition). Da der Arbeitsraum begrenzt ist, können uns immer nur wenige Dinge gleichzeitig bewusst sein. |
| ° | Aufmerksamkeitsschema-Theorie (nach Michael Graziano, *1967, und Sabine Kastner, *1964): Bewusstsein hat sich im Lauf der Evolution schrittweise entwickelt und erlaubt dadurch, dass das Gehirn (das äußere und innere Signale zusammenspielt) ein Modell der Aufmerksamkeit erzeugt, Gedanken und Absichten anderer zu interpretieren bzw. subjektives Erleben überhaupt. Bei jeder Wahrnehmung spielt sowohl die durch Reize gefütterte exogene Aufmerksamkeit wie auch die von Erwartungen, Bewertungen und Vorerfahrungen gespeiste endogene Aufmerksamkeit mit. |
| ° | Predictive processing (coding)-Theorie (nach dem US-amerikanischen Biochemiker Gerald M. Edelman, 1929-2014; Nobelpreisträger 1972, und seinem neurowissenschaftlich tätigen Landsmann Richard F. Thompson, 1930-2014, u. a.): Bewusste Erfahrungen bestehen in der Diskrepanz zwischen dem sensorischen Input und den vom Gehirn erzeugten Vorhersagen, was es erleben wird. Widersprüche erzeugen Bewusstseinsprozesse, die zu ausgleichenden Neuanpassungen (Updates) führen und unsere bewusste Wahrnehmung bilden. Grundlage von Bewusstsein ist also das (erwartende) Gedächtnis. Die Prozesse bestehen in Vorhersagen und Fehlerkorrekturen. |
| ° | Integrierte Informationsverarbeitungstheorie (IIT; nach Giulio Tononi, *1960, u. a.): Im Unterschied zu unbewussten Vorgängen ist die funktionelle Konnektivität (das Ausmaß an integrierter Information) bei bewussten Zuständen stark erhöht. Die Kommunikation verschiedener Hirnteile, beruhend auf der Signalverknüpfung unterschiedlicher Kanäle, definiert den Grad an Bewusstheit (bestimmbar mit dem quantitativen Wert Φ). Bewusstsein wird mit Erleben gleichgesetzt. Die physische „hot zone“ ist dabei die hintere Hirnrinde. Voraussetzung für Bewusstsein müssen nicht unbedingt biologische Materie und physikalische Prozesse sein, das Potenzial, etwas zu tun, reiche. Die IIT definiert Bestimmungsstücke des Bewusstseins (z. B. Exklusivität - niemals ist mehr als nur ein Inhalt bewusst - oder Integration - Erfahrungen werden als zusammenhängendes Ganzes erlebt) und prüft dann, welche Systeme diese Voraussetzungen erfüllen. |
| ° | Theorie höherer Ordnung: Bewusste Erfahrungen kann nur machen, wer seine geistigen Funktionen mit Hilfe höherer Hirnregionen (z. B. präfrontaler Kortex), die die niedrigeren kontrollieren, als solche zu erkennen vermag. |
| ° | Theorie der lokalen Rekurrenz: Bewusstsein entsteht durch den bidirektionalen Austausch höherer und niedrigerer Hirnteile (feed-foward / feed-back) |
| ° | Self comes to mind-Theorie (nach António Damásio): Bewusstsein entsteht dadurch, dass das Gehirn die Reaktionen des Körpers auf innere oder äußere Reize in Gefühle übersetzt. |
| ° | Sensorimotor-Theorie: Bewusstsein entsteht erst, wenn aktiv gehandelt wird. |
| ° | Higher-Order-Theorie: Bewusstsein erfordert eine höherstufige Kontrolle anderer Gehirnteile. Bewusste Zustände beruhen auf grundlegenden mentalen Zuständen (wie Wahrnehmungen), die reflektiert werden. Der mentale Zustand wird dadurch zu einer higher-order representation / HOR. |
* Denk- und Entscheidungssysteme: Aufgrund der Forschungen von Amos Nathan Tversky, 1937-1996, und Daniel Kahneman (1934-2024, Wirtschaftsnobelpreisträger 2002, Autor von Thinking, fast and slow 2011; vgl. kurze Videoerklärung, längeren Videovortrag ab 6:30 min oder 20 min-Video) und anderer unterscheiden wir heute zwei Denk- bzw. Entscheidungsfindungssysteme (vgl. a. u.1 und u.2): ein schnelles (System 1) und ein langsames (System 2). Unser Gehirn steuert die meisten Vorgänge schnell, automatisch, unbewusst, ohne willentliche Kontrolle und ohne Anstrengung, die nur verspürt wird, wenn wir mit unserem zwar flexibleren, aber langsameren (alles bewusst Wahrgenommene ist mindestens eine Drittelsekunde alt) bewussten, konzentrierten Denken - dem Verstand - agieren, z. B. wenn wir multiplizieren oder eine uns bis dahin unbekannte Gefahr bewältigen müssen. (Dieser Ansatz wird Dual process theory oder populärwissenschaftlich Homer Simpson-System vs. Mr. Spock-System genannt.)
Die allermeisten Alltagsvorgänge werden energiesparend automatisch gesteuert (z. B. Berechnung der Auge-Hand-Koordination beim Fangen eines Balles, Gesichtserkennung, notwendige Bewegungen beim Autofahren etc.), weil sie für das Gehirn weder neu noch wichtig genug sind, um eine Zuschaltung des energieverzehrenden Bewusstseins anzufordern. Selbst wenn sich das Bewusstsein gerade mit anderen Dingen (aus Vergangenheit oder Zukunft) beschäftigt, managt das Unbewusste die (oftmals gefährliche) Gegenwart. Deshalb gibt es in Städten mit vielen Radfahrern prozentuell weniger Radunfälle als in solchen mit wenigen, da in diesen die automatische „Verrechnung“ - der „Autopilot“ - der Autofahrer (noch) nicht so gut funktioniert wie in jenen. System 1 entscheidet auch (und gerade) in wichtigen Angelegenheiten wie der Partnerwahl. (Niemand erstellt eine Plus-/Minusliste aller möglichen Partner/innen und entscheidet dann rational.) Das „Bewusstsein ist wie ein Nachklang, wenn alles schon entschieden ist“ (Allan Snyder, *1942; s. a. u.); er gibt uns die Illusion, involviert gewesen zu sein. Diese unbewussten Entscheidungsprozesse können nicht nachvollzogen werden, auch wenn gegen ihr Ergebnis „angedacht“ werden kann.
* Brain Reading (Gedankenlesen): Der alte Menschheitstraum vom Gedankenlesen wird durch fMRT-Hirnscans Wirklichkeit (wenn auch zunächst nur in vagen Ansätzen). Die Codierung der komplexen, durch Interaktion von Nervenzellen aus verschiedenen Regionen entstandenen Aktivitätsmuster im Gehirn, die beim Denken entstehen, sollen dabei entschlüsselt werden - die Hirnaktivität soll den Gedanken offenbaren. Diese Mustererkennung ist jedoch so komplex, dass zur Zeit nur einfachste Inhalte ausgelesen werden können. Die Auswertung der Tatsache, dass jeder Gedanke ein eigenes Muster hat, wird durch die unermessliche Vielfalt und die stete Dynamik der Hirnaktivitäten nicht nur stark erschwert, sondern meist unmöglich gemacht. In einem Ex. gelang es Haynes (s. a. o.) immerhin, seine Computer so zu trainieren, dass sie erkennen konnten, welches von 10 Bildern eine Vp. gerade ansah (vgl. Fenster ins Gehirn von John-Dylan Haynes, *1971, u. a.; ersch. 2021). Eine Zukunftsvision besteht darin, eine leistungsfähige Hirn-/Computerschnittstelle (Brain-Computer-Interface BCI) zu schaffen, um z. B. Gedanken von Locked-in-Patienten lesen und auf diese Weise mit ihnen kommunizieren zu können. (Die Steuerung mechanischer Prothesen oder von Computern durch Gedanken funktioniert jetzt schon.)
Zur Hirnforschung vgl. auch das „Das Manifest - Elf führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung“ von 2004 (die darin auf S. 5ff für die kommenden zehn Jahre in Aussicht gestellten Zukunftsversprechungen sind allerdings - zumindest in diesem Zeitraum - nicht eingelöst worden), die Video-Dokumentation Wie das Gehirn die Seele macht und das Lexikon der Neurowissenschaften
OPTISCHE WAHRNEHMUNG - DAS AUGE
vgl. Prinzipien der Bildverarbeitung, Österreichische Ophthalmologische Gesellschaft oder ähnliche Seiten
Der Sehsinn ist der für den Menschen wichtigste Fernsinn. Er funktioniert mit einer Auflösung von bis zu 0,2 mm auf 0,3 m im Sternenlicht genauso wie im 1 Mia. mal helleren Sonnenlicht. Wie fast alle sehenden Lebewesen haben wir zwei Augen, die phylogenetisch über die Jahrmillionen hinweg von lichtempfindlichen Sehgruben, die nur eine erhöhte Richtungsselektivität ermöglichten, über Becher- bzw. Grubenaugen und Blasen- (Lochkammer)auge zu einem nach dem Camera-obscura-Prinzip funktionierenden komplizierten Linsenaugen-System mit Photorezeptoren evoluiert worden sind. Das Bild trifft verkehrt auf der Netzhaut, die bei visueller Deprivation irreversibel geschädigt wird, auf und wird im Gehirn „aufgerichtet“. (Das aus zahlreichen Ommatidien - bis zu Zehntausenden Einzelaugen - zusammengesetzte Facettenauge der Insekten beruht auf anderen Prinzipien.)
Als einer der ersten erkannte Leonardo da Vinci (1452-1519) aufgrund seiner Anatomiezeichnungen den Zusammenhang zwischen Auge und Gehirn. Das Verschaltungsprinzip besteht meist in einer Koppelung von Konvergenzschaltung (Neuronenschaltungen projizieren zahllose Nervenzellen auf ein Zielneuron) mit Divergenzschaltung (jedes Neuron dockt über Axonkollaterale an zahllose andere Neurone an; beschrieben vom deutschen Sinnesphysiologen Wolf-Dieter Keidel, 1917-2011).
- Sinneszellen:
Auf der Retina (Netzhaut, Teil des Hirngewebes; vgl.
Aufbau
der Netzhaut) angeordnete Stäbchen (ca. 120 Mio, eher an der
Peripherie, für das Schwarz-Weiß-Sehen in der Dämmerung zuständig, da sie
aufgrund ihrer enormen Empfindlichkeit auch ein einziges Photon (ein
Lichtquant, also eine Art Baustein der elektromagnetischen Strahlung ohne Masse, die als
Welle-Teilchen-Dualismus beschrieben wird) registrieren
können und drei (selten vier)
verschiedene Arten von farbempfindlichen Photonenrezeptoren (Zapfen; ca. 6 Mio., eher im
Zentrum, für das Farbsehen bei gutem Licht), die, 1/1000 mm lang, alle reflektierten
elektromagnetischen Schwingungen zwischen ca. 380-750 nM (Nanometer, =
1 Millionstel Millimeter) als Seheindruck erscheinen lassen und ins Gehirn
weiterleiten. Daraus folgt, dass nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Wellenlängenspektrums
gesehen werden kann. (Für Ultraviolett: <350, Röntgen- und Gammastrahlen, Infrarot, das
als Wärme wahrgenommen werden kann: >750 Bio, Mikrowellen, Radar,
Kurz-, Mittel-, Langwellen fehlt dem Menschen die Möglichkeit zur optischen
Wahrnehmung.) 1 Lichtquant innerhalb des angegebenen Spektrums, der auf wenige Rezeptoren fällt,
reicht allerdings für einen Seheindruck aus.

Abb. 1/9: Copyright ©:
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/12/bs12-39.htm
Absorbiert ein Gegenstand das gesamte Spektrum, erscheint er schwarz (eig.: gar nicht), reflektiert er alle Frequenzen, erscheint er weiß. Die Reize werden über die Sehbahnen, die doppelt kreuzen (innerhalb eines Auges und auf dem Weg ins Gehirn) an das Sehzentrum (zunächst in die primäre Sehrinde) weitergeleitet und dort verarbeitet. In der Fovea centralis (= Zentralgrube, „Gelber Fleck“) liegt die Stelle des schärfsten Sehens. (Die bei Dunkelheit inaktiven Farbzellen sind dort am stärksten vertreten.) Am Blinden Fleck tritt der Sehnerv (nervus opticus; ca. 1 000 000 Nervenfasern) aus, es können dort daher keine Sinneszellen existieren. Dass wir trotzdem immer ein komplettes Bild ohne „Loch“ sehen (auch bei einäugigem Sehen), liegt daran, dass unser Gehirn den fehlenden Reizinput wie ein Computer errechnet.
Der Nachweis des Blinden Flecks erfolgt anatomisch oder durch
folgendes Ex: Man fixiere mit dem rechten Auge das linke (oder umgekehrt)
von zwei ca. 15 cm waagrecht voneinander entfernten, auf ein Blatt Papier
gezeichneten Symbolen und wende den Blick nicht mehr ab. Dann nähere man sich
kontinuierlich dem Papier. Bei einem gewissen Abstand des Auges vom Blatt verschwindet
das rechte Symbol im
Blinden Fleck.
(Vgl. folgende, verschiedenste optische Phänomene demonstrierende Seite.)
|
|
Abb. 1/10: Aufbau des menschlichen Auges:
(aus Das visuelle
System; nicht mehr aktive Seite der Univ. Wuppertal)
- Funktionsweise:
* Adaptation erfolgt durch die Pupille
(„Blende“), die den unterschiedlichen Lichteinfall (also die Helligkeitsanpassung)
regelt.
Ein Ausgleich erfolgt durch automatische stufenlose Öffnung bzw. Schließung.
Eine Pupillenerweiterung (die einen Menschen, ohne dass das dem Betrachter
bewusst wäre, sympathischer erscheinen lässt) ist durch
Tollkirschenextrakt (Belladonna) willkürlich hervorrufbar (was von Augenärzten
und schon vor 2000 Jahren von römischen Kurtisanen ausgenützt wird/wurde). Ex.: Wenn mit einer Taschenlampe in ein Auge geleuchtet
wird, lässt sich die
Veränderung der Pupille während und nach dem Geschehen beobachten. Man
unterscheidet:
| ° | Scotopisches Sehen: Sehen mit (lichtempfindlicheren) Stäbchen in der Dunkelheit |
| ° | Photopisches Sehen: Sehen mit (farbfähigen) Zapfen bei Licht |
* Akkomodation ist das
Scharfstellen der Linse durch Straffung des Ziliarmuskels
(Entfernungsanpassung). Die Veränderung des vorderen Krümmungsradius der Linse
verändert die Brechungskraft. (S. u.
„Altersweitsichtigkeit“).
Im Unterschied zur statischen Refraktion (der Brechkraft des in die Ferne
blickenden Auges) nennt man das Akkomodieren, dessen Breite bis zu 12 Dioptrien
ausmachen kann, dynamische Refraktion.
Das Auflösungsvermögen des menschlichen Auges beträgt bestenfalls 1
Bogenminute (in 5 m Entfernung müssen 2 Punkte mindestens 1,5 mm Abstand haben,
um getrennt wahrgenommen werden zu können).
* Drehung: Die Möglichkeit, die Augäpfel (Bulbi oculi) in ihren Höhlen kontrolliert zu drehen (und damit die Blickrichtung ohne Drehung des Kopfes zu verändern), wird durch die sogenannten extrinsischen Muskeln an ihrer Außenseite ermöglicht (s. a. u.).
- Sehstörungen:
Gemeint sind vor allem diverse Abbildungsmängel (Ametropien im
Gegensatz zu Emmetropien = Normalsichtigkeit), nicht optische
Täuschungen, die weiter unten (s. u,)
besprochen werden.
Vgl. Sehtest I,
Sehtest II, Amsler-Test
(nach Marc Amsler, 1891-1968)
* Blindheit:
| ° | Fehler im Gehirn: Rindenblindheit (manchmal „Seelenblindheit“ genannt) |
| ° | Fehler im Auge (z. B. Schädigungen der Netzhaut oder des Sehnervs) |
* Myopie (Kurzsichtigkeit): Der Schärfepunkt liegt vor Netzhaut (bei zu starker Krümmung); Ausgleich durch Konkavlinse; Messung in Dioptrien (1 Dioptrie = 1/f, f = Brennweite)
* Hyperopie (Weitsichtigkeit): Der Schärfepunkt liegt hinter Netzhaut (bei zu schwacher Krümmung), ein Ausgleich erfolgt durch eine Konvexlinse. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen tritt Weitsichtigkeit oft im Weltall auf. (Die österreichische Ärztin und ESA-Reserveastronautin Carmen Possnig, *1988, die auch die Auswirkungen der antarktischen Nacht auf den Menschen erforscht hat, nimmt als Arbeitshypothese den verlangsamten Blutfluss an.) Nicht zu verwechseln ist die Hyperopie mit der Unfähigkeit, in der Nähe scharfzustellen, der
* Presbyopie („Altersweitsichtigkeit“): Sie entsteht durch die allmähliche Abnahme der Linsenelastizität und in geringerem Ausmaß durch die Erschlaffung des Ziliarmuskel und besteht in einer schon in der Jugend voranschreitenden Akkomodationsschwäche bzw. -unfähigkeit, nicht in einem Abbildungsfehler. Der Schärfepunkt entfernt sich mit dem Alter. (Er liegt im 10. Lebensjahr etwa bei 8 cm, im 50. Lebensjahr im Durchschnitt bei 50 cm oder mehr.)
* Astigmatismus: Linien erscheinen in der Perspektive gebogen, ev. treten Farbveränderungen am Rand auf. Astigmatismus entsteht durch ungleichmäßige Hornhautkrümmung. (Dazu und zur Dioptrik des Auges allgemein forschte Allvar Gullstrand, 1862-1930; Medizin-Nobelpreis 1911, der auch einige ophthalmologische Geräte erfand.)
* Konvergenzstörungen: Stehen aufgrund einer Augenfehlstellung die Sehachsen nicht parallel (Deviation) bzw. lassen sich die Bulbi nicht gleichzeitig drehen, spricht man von Strabismus (= „Silberblick“, Schielen). Fehlausrichtungen werden bei etwa 3% der Kinder beobachtet (infantiler Strabismus), können aber auch als erworbener Strabismus auftreten. Beides ist teilweise behandelbar.
* Nystagmus:
| ° | Physiologischer Nystagmus: unwillkürliche Mikro-Augenbewegungen (ca. 50 in der Sekunde), die dazu dienen, temporäres Erblinden durch Fehlen einer Reizvariation (Fixationsblindheit) zu verhindern (ähnlich dem Verlust der Tastempfindung, wenn die Hand einige Zeit z. B. ruhig im Wasser liegt). Bei manchen Tieren (z. B. Fröschen) ist ein Nystagmus z. T. nicht vorhanden. Dadurch kann eine Bewegung (z.B. der Flug eines Beuteinsekts) vor dem verschwundenen Hintergrund umso deutlicher wahrgenommen werden. (Bei dieser Nystagmus-Variante kann nicht von einer Sehstörung gesprochen werden.) |
| ° | Krankhafter Nystagmus (Bergarbeiternystagmus): entsteht v. a. durch Arbeit unter Tag; Da die Dämmerungssinneszellen (s. o.) an der Peripherie der Netzhaut liegen, muss, wenn nur kleine Netzhautareale gereizt werden, immer leicht neben den wahrzunehmenden Gegenstand gesehen werden (dessen Licht ansonsten auf die „blinden“ Stellen fallen würde - wie auch in der Nacht im Ex. sehr kleine Sternen nicht mehr wahrgenommen werden können, wenn man direkt auf sie blickt, jedoch wieder auftauchen, wenn man das Auge leicht dreht). |
* Farbenblindheit: Tritt als
totale (völlige Unfähigkeit, bunte Farben zu erkennen) oder partielle Farbenblindheit
(meist Grün-, seltener Rot- oder Blaublindheit) auf und wird x-chromosomal
rezessiv
vererbt (s. u.).
Der Sohn eines Farbenblinden kann daher nicht farbenblind sein (außer seine
Mutter ist Konduktorin), ein Mädchen nur dann, wenn der Vater farbenblind und die
Mutter als Konduktorin ihr schadhaftes X vererbt.
Vgl.
Farbsehtest und Seite
Farbenblindheit
- Farbsehen:
Farben und Wahrnehmung
von Peter Stoeckl
5,
6,
7 -
Vgl.
auch Seite der Univ. Mainz
Aufgrund der drei unterschiedlichen Zapfen-Rezeptoren ist der Mensch in der Lage, das Farbspektrum, das sich aus der Zerlegung des Sonnenlichts ergibt, wahrzunehmen (chromatopsy, colour perception). Die in der Außenwelt inexistenten Farben werden durch die Verarbeitung elektromagnetischer Wellen im Gehirn erzeugt bzw. ermittelt. Rufen aus unterschiedlichen Spektralverteilungen zusammengesetzte Lichteindrücke den gleichen Farbeindruck hervor, nennt man das Metamerie. Dies und das Spektrum selbst wurden zum ersten Mal von Isaac Newton, 1618-1700, beschrieben. In den verschiedenen Sprachen haben unterschiedliche Farben eigene Vokabel (im Deutschen z. B. Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Braun - andere Farben werden zugeordnet, z.B. Indigo zu Blau; s. a. u. Alltagssprachlich werden auch „schwarz“ und „weiß“ wie Farbadjektiva verwendet.) Manche „Farben“ sind nicht nur von der Lichtquelle, sondern auch von der Oberflächenbeschaffenheit abhängig (und deshalb auf dem Bildschirm nicht darstellbar; z. B. die metallisch glänzenden Metallisé-Farben wie Silber).
* Subjektives Eigengrau: „Farbe“ beim Schließen der Augen ohne direkten Lichteinfall
* Sieben Spektralfarben: Fällt das Sonnenlicht durch ein Prisma (z. B. im Regenbogen), entstehen durch Zerlegung des Lichts die an sich kontinuierlich verlaufenden Spektralfarben (zur Darstellung s. Abb. 1/9). Die gängigen Bezeichnungen Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (Schwarz und Weiß sind Helligkeitszustände) geben jedoch weniger physikalische Verhältnisse als den Farbeindruck wieder. Farben, deren Mischung Weiß ergibt, lassen sich in einem Kreis darstellen, auf dem die Komplementärfarben (= bunte Farben, deren Mischung eine unbunte „Farbe“, nämlich Weiß, ergibt) gegenüberliegen. Zum Teil sind sie über den Hautsinn auch als Wärme rezipierbar. Im Gelb-Orange-Bereich kann der Mensch besser differenzieren als im Blau-Violett-Bereich. Man unterscheidet drei
* Dimensionen einer Farbe:
| ° | Qualität (Frequenz) |
| ° | Helligkeit (Weiß- bzw. Schwarzanteil) |
| ° | Sättigung (Grauanteil) |
Diese drei Dimensionen und der subjektive Eindruck werden berücksichtigt im leicht geneigten
* Doppelkegelmodell des Marinestabs- und Augenarztes Hans Podestá
(1871-1953), bei dem Gelb etwas höher
als Blau liegt, da es bei gleichem Weißanteil subjektiv heller erscheint
(aufbauend auf einem dreidimensionalen Farbkörper des deutsch-baltischen
Chemikers Friedrich Wilhelm
Ostwald, 1853-1932, Nobelpreis
1909). Prinzipiell
sind um den Basiskreis die Spektralfarben angeordnet. Der Weiß- bzw. Schwarzanteil nimmt
gegen die beiden Spitzen des Doppelkegels hin zu (= die Farben werden heller/dunkler). Der
Grauanteil nimmt gegen den Mittelpunkt / die Mittelachse hin zu: Die Farben
erscheinen am Rand
optimal satt, in der Mitte verwaschen und diffus.
Vgl. Farbmodelle (1.2.7.8)

Abb. 1/11: Podestá'sches Doppelkegelmodell (© Thomas Knob)
* Theorien zum Farbensehen: Aus der Drei-Komponenten-Theorie von Thomas Young (1773-1829) und Hermann von Helmholtz (1821-1894, der als Erster annahm, dass das Gehirn aktiv Hypothesen über die Welt erstellt, jede Wahrnehmung als Prozess unbewusster Rückschlüsse ansah und auch die Geschwindigkeit von Nervenimpulsen gemessen hat) - sie beschreibt „trichromatisches Sehen“ durch Zapfen (wenige „Kurzwellen-“, mehr als 10x so viele „Mittelwellen-“ und noch mehr „Langwellenzapfen“) für rotes (562 Nanometer), grünes (535 Nanometer) und blaues Licht (430 Nanometer) - entstand die Gegenfarbentheorie von Ewald Hering (1834-1918), die mit dem Zustandekommen eines Fernsehbildes verglichen werden kann: aus nur vier Gegenfarbenzellen (rot/grün, blau/gelb) ergibt sich durch On-/Offschaltung (inhibitorische / exzitatorische Weiterleitung) eine Mischung, die uns die unterschiedlichsten Farben erleben lässt. Die Neurophysiologie bestätigte später, dass die drei verschiedenen Zapfentypen im Auge (auf der Rezeptorebene), die jeweils für kurz- (blau), mittel- (grün) und langwellige (rot) Lichtstrahlen sensibel sind, Impulse zur Weiterverarbeitung an die nachgeschalteten neuronalen Farbkanäle leiten (in die neuronale Ebene).
Aufgrund genetischer Veränderungen kann (nur bei Frauen) statt trichromatischem Sehen tetrachromatisches Sehen auftreten. (Tetrachromasie erlaubt - statt „nur“ 10 Million - die Unterscheidung von ca. 100 Millionen unterschiedlicher Farbtöne.) Ebenfalls durch (rezessive) Genveränderungen (fast nur bei Männern, die kein zweites X-Chromosom als Kompensation für ein geschädigtes haben und daher diesen Defekt nicht an ihre Söhne vererben können) entsteht die dichromatische Farbenblindheit (s. o. und u.). Bekannt sind auch ganz normale unterschiedliche Farbwahrnehmungen derselben Reizgrundlage (vgl. Link zu dem bekannten "Kleid im Internet").
* Farbmischung:
| ° | subtraktiv: Malkastenmischung, eher ein Filterverfahren bzw. eine Oberflächenveränderung, eine technische Mischung der Farbspektren abzüglich des absorbierenden Pigment (z. B. blau + gelb = grün) |
| ° | additiv: optische Mischung, Lichtmischung. Auf ein und dieselbe Netzhautstelle treffen simultan mehrere Sektoren des Spektrums, die mittels der Zapfen gemischt werden (z. B. blau + gelb = weiß). Die Mischung zweier Komplementärfarben (oder sämtlicher Komplementärfarben) ergibt immer Weiß. |
Das Auge kann nicht zwischen monochromatischen Farben (z. B. Regenbogengelb mit ca. 580 nM) und durch Mischung entstandenen Farben unterscheiden. Ex.: Bringt man einen Farbkreisel, der alle Spektralfarben (oder zwei Komplementärfarben) in gleichem Verhältnis enthält, in schnelle Drehung, so ergibt sich ein Seheindruck von Weiß (bzw. wegen meist leichter Verschmutzung der Scheibe Grau). Zwei Nicht-Komplementärfarben ergeben additiv die im Spektrum dazwischen liegende Farbe. (Der verstellbare Farbkreisel wurde vom österreichischen Schriftsteller Robert Musil, 1880-1942, entwickelt.)
Vgl. arte-Video Welt der Farben
* Farbkontrast: Beleuchtet man im Ex. einen Gegenstand mit rotem Licht, seinen Schatten aber weiß, so erscheint dieser in der Komplementärfarbe Grün, was ähnlich dem Negativen Nachbild (s. u.) erklärt wird. (Farbiger Schatten; zu Kontrast s. a. u.)
* Psychologische Wirkung: Schon lange ist die
unterschiedliche psychologische Wirkung von Farben auf den Menschen bekannt
(z. B. „beruhigendes Grün“,
„aggressives Rot“ etc.) Farben stehen außerdem oft für abstrakte Begriffe (z. B.: Gelb für
die Eifersucht, Rot für die Liebe, Schwarz für den Tod, Violett für die Vorfreude,
Grün für die Hoffnung etc., etc.) Diese Zuschreibungen sind kulturabhängig (vgl. das in
Indien auf Totenfeiern getragene Weiß).
Vgl dazu Symbolik der Farben von Peter Stoeckl und das Lexikon
der Farbstoffe
- Kontrast- und
Konstanzphänomene:
Die in diesem Abschnitt dargestellten Phänomene beschränken sich
nicht allein auf die optische Wahrnehmungsmodalität. Auch bei den anderen Sinnen
bis hin zu gesellschaftspolitischen Bereichen finden sich ähnliche
Besonderheiten. (Die geringen Unterschiede zwischen Österreichern und den
benachbarten Deutschen werden z. B. engagierter diskutiert als die
offensichtlichen - und daher kaum problematisierten - zwischen Österreichern und
Aborigines.) Im Gegensatz zum Simultankontrast scheint der in
Ex.en nachgewiesene Distanzeffekt zu
stehen: Lässt man Vpn. von zwei Zahlen die höhere benennen, so nimmt die in
Millisekunden gemessene Antwortlatenz zu, wenn der Unterschied klein ist. (Obwohl
auch beim Zahlenpaar 9/8 völlig klar ist, welche Zahl die größere ist, braucht
man für die Entscheidung etwas länger als z. B. bei 2/7. Die
Reaktionszeit ist also umso geringer, je größer der Abstand der Zahlen
voneinander ist.)
* Simultankontrast: Darunter versteht man den Kontrast gleichzeitig dargebotener Reize (z. B. subjektive Farbtäuschungen in gewissen Konstellationen oder s. hier). Das überdeutliche Hervortreten der Kontraste benachbarter Reize (die Reizunterschiede werden deutlicher als erwartbar erlebt) ist psychologisch mit einer gewissen Fixierung auf die Unterschiede im Ähnlichen erklärbar, die paradoxerweise stärker ins Gewicht zu fallen scheinen als die, die sofort evident sind.
Die neuropsychologische Grundlage liegt in der Lateralen Inhibition: Die Verbindungen zwischen Sinneszellen und Schaltzellen wirken exzitatorisch (fördernd), wenn sie direkt nach „unten“, inhibitorisch (hemmend), wenn sie seitlich (lateral) weiterführen. Daher löst eine von einem stärkeren Reiz gespeiste Sinneszelle in ihrer Wirkung auf eine seitlich verdrahtete Schaltzelle eine stärkere Hemmung aus als eine von einem schwächeren Reiz gespeiste Sinneszelle.
Im Beispiel Abb. 1/13 wird die laterale Inhibition auf eine mit einem „+5-Schwarz-Rezeptor“ lateral verdrahteten Schaltzelle mit -1, die auf eine mit einem „+10-Weiß-Rezeptor“ verdrahteten mit -2 angenommen; so entstehen an der Schnittstelle andere Werte als daneben, wenn man aus Vereinfachungsgründen annimmt, dass jeder Rezeptor mit genau 1 Schaltzelle exzitatorisch und 2 - den rechts und links benachbarten - Schaltzellen inhibitorisch verbunden ist:
|
Abb. 1/12: Verstärkte Kontrastwahrnehmung
durch Laterale Inhibition
Abb. 1/13: Laterale Inhibition - schematische Erklärung (Quelle: Scheffelgymnasium)
|
* Sukzessivkontrast: Dieser Begriff bezeichnet den Kontrast hintereinander dargebotener Reize, z. B. folgendes, bereits um 1000 n. Chr. von Alhazen (965-1040; Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham / أبو علي الحسن بن الهيثم beschriebene Phänomen.
| ° | erscheint immer in der Komplementärfarbe |
| ° | ist proportional zur Darbietungsdauer |
| ° | ist auch bei geschlossenen Augen sichtbar |
| ° | wächst mit der Entfernung der „Projektionsfläche“ (s. u., Emmert'sches Gesetz) |
| ° | wandert mit den Augen mit |
| ° | lässt sich knapp nach seinem Verschwinden durch Lidschlag reaktivieren |
| ° | Erklärung (von Hering): Durch Dauerlicht erfolgt eine Dissimilation einer Sehsubstanz (Rhodopsin, Iodopsin), die durch nachfolgende Assimilation wieder rückgängig gemacht wird. |
Vgl. Ex zum Negativen Nachbild (oder hier)
* Konstanzphänomen: Durch die Konstanzleistungen wird eine Desorientierung im Sinnendatenchaos verhindert. Gleichartiges (gemeint sind Helligkeitszustände, Formen, Farben, Größen und Kontraste) wird auch unter verschiedenen Bedingungen, die aufgrund der Erfahrung miteinberechnet werden, als gleichartig erlebt. Wir beurteilen einen Wahrnehmungsinhalt nicht nur nach seiner Abbildung auf der Netzhaut oder anderen Rezeptoren, sondern gemäß unseren zusätzlichen, erlernten Informationen. (Deshalb erscheinen uns Menschen, die wir aus dem 20. Stock über die Straße gehen sehen, nicht in Ameisen-, sondern in Menschengröße.) Das Emmert'sche Gesetz (nach dem Schweizer Ophthalmologen Emil Emmert, 1844–1911) quantifiziert diesbezüglich den Zusammenhang zwischen der Bildgröße eines Objektes auf der Netzhaut und der wahrgenommenen Größe bei zunehmender Entfernung: G ≈ w · e (die wahrgenommene / scheinbare / visuelle Größe ist proportional dem Produkt aus Winkelgröße und Entfernung). Gemeinsam ist allen Konstanzphänomenen, dass das Gehirn Veränderungen kompensiert und so eine automatische Korrekturfunktion übernimmt. (Vgl. a. u.).
Vgl. Ex.: Das Weiß der Seiten eines Buches wäre in der Dämmerung objektiv dunkler als das Schwarz der Buchstaben im Sonnenlicht, wird aber in beiden Fällen als Weiß identifiziert. (Vgl. dazu im folgenden Video die Minuten 10:56 bis 12:08, wo dies eindrucksvoll demonstriert wird).
Die Konstanzleistungen können verloren gehen, wenn der Bezugsrahmen wegfällt (wie wir auch sonst ohne Bezugsrahmen in unserer Wahrnehmung unsicher oder hilflos werden). Vgl. dazu Ex. von August Kirschmann (1860-1932; promovierte bei Wundt): Hinter einer nur einen kleinen Ausschnitt freigebenden Abdeckung wird ein ursprünglich z. B. weißer Gegenstand rot beleuchtet. Er erscheint nun durch das Fenster rot, bei Entfernung der Abdeckung aufgrund der Kontrast- und Farbkonstanz jedoch wieder weiß, obwohl objektiv derselbe Seheindruck vorliegt. Grund: Ohne Vergleichsparameter und Kontextualisierung funktionieren unsere Wahrnehmungssysteme nicht mehr zufriedenstellend.
- Optische Täuschung:
vgl.
Top 10 Illusions, die im Internet kursierende PowerPoint Präsentation
„Optische Phänomene“, Optical Illusions
oder
„Optische Täuschungen - Illusions“, die zahllose, oft animierte Beispiele bringen.
Manchmal erscheinen Wahrnehmungsinhalte subjektiv anders, als es der objektiven Wirklichkeit entspricht (z. B. gleichgroße Kreise als verschieden groß, Farben und Bewegung in schwarz-weißen, ruhigen Bildern o. ä.). Dies nennt man optische Täuschung. Man kann sich ihr nicht entziehen. Einige Täuschungen werden z. B. von schizophrenen Personen nicht gesehen (Beispiel: Tilt-Illusion). Die Architektur berücksichtigt manchmal optische Täuschungen bewusst, um den gewünschten Eindruck zu erzielen. (Beispiel: Parthenon-Tempel auf der Akropolis, der deswegen „gerade“ erscheint, weil er mit einer leichten Krümmung gebaut wurde.)
Die bekanntesten Täuschungen sind die Wundt-T., eine Variante der Hering'sche T., die Müller-Lyer'sche T. (nach Franz Carl Müller-Lyer 1857-1916), die Oppel'sche T. (nach Johann Joseph Oppel, 1815-1894, der den Begriff geometrisch-optische Täuschung prägte; unterteilte Strecken erscheinen länger als gleichlange, nicht unterteilte Strecken), die Ehrenstein-Orbinson'sche T. (nach Walter Ehrenstein, 1899-1961, und William Orbinson, 1912-1952), die Zöllner'sche T. (nach Johann Karl Friedrich Zöllner 1834-1882), die Ebbinghaus-Illusion (nach Hermann Ebbinghaus, s. u.), die Poggendorf'sche T. (nach Johann Christian Poggendorf 1796-1877), die Sander'sche T. (nach Friedrich Sander 1889-1871), das Hermann-Gitter (von Ludimar Hermann, 1838-1914), die Ames'schen Perspektivtäuschungen (Ames'sches Fenster, Ames'scher Raum; nach Adelbert Ames jr. 1880-1955; eine ähnliche Verzerrung bewirkt der Beuchet-Stuhl - nach Jean Beuchet, 1914-2019, - bei dem aus passender Perspektive die sitzende Person weit kleiner als die nebenstehende wirkt; s. Folie 8) u. v. a. m.
Ex.: Unter diesem Link lassen sich einige eindrucksvolle Täuschungen betrachten.


Abb. 1/14:
Links sollen neun Personen (ohne Hund) erkannt werden (1
rechts oben, 4 in der Bildmitte plus 4 Gesichter an
den Türmen links oben, von denen 3 hier schwer zu erkennen sind) / Rechts
erzeugt das Auge Farben, wo gar keine sind
Eine einheitliche Theorie zur Erklärung aller Täuschungen ist nicht möglich, es gelten aber folgende
Beobachtungen:
* Das Wissen um die Täuschung ist wirkungslos.
* Wahrnehmungsinhalte beeinflussen einander wechselseitig.
* Das Netzhautbild allein ist für die Wahrnehmung nicht entscheidend.
* Reizkonfigurationen können unterschiedlich interpretiert werden
(1)

 (2)
(2)
Abb. 1/15a: Umspringbilder (Kippbilder): Würfel von links vorne oder rechts unten? (1) / Alte oder junge Frau? (2)
(3)

 (4)
(4)
Abb. 1/15b: Umspringbilder (Kippbilder): Gesichtsprofile oder Säule? (3) / 7 oder 6 sichtbare Würfel? (4)
* Oft wird Dreidimensionalität in zweidimensionalen Darstellungen vorgetäuscht (z. B. bei manchen Escher-Bildern, der bekannten Penrose'schen Treppe - nach Lionel Sharples Penrose, 1898-1972, bzw. seinem Sohn Roger Penrose, *1931, und anderen „Unmöglichen Figuren“), oft werden Konstanzphänomene, Erfahrungswerte oder erlernte Perspektiven bzw. secondary cues ausgenützt (z. B. bei der Ponzo- oder „Schienentäuschung“ (Mario Ponzo 1882-1960) oder der Ehrenstein'schen T. (Walter Ehrenstein 1899-1961). Bekannt ist auch die Hollow Face-Täuschung (Tiefenumkehr, bei der konvexe Strukturen als konkav oder umgekehrt gesehen werden; s. hier), die zeigt, wie unsere Erwartungen (in diesem Fall an ein hervortretendes Gesicht) unsere Wahrnehmung beeinflussen. (Schizophrene werden - s. u. - von der Hollow Face-Illusion nicht getäuscht.)
- Tiefensehen:
Der dreidimensionale Seheindruck (räumliches Sehen, Tiefensehen) entsteht durch
* Akkomodation (s. o.)
* Konvergenz: Die Sehachsen treffen einander durch Drehung der Augäpfel im scharf gestellten Punkt; sie sind umso paralleler, je weiter dieser entfernt ist. (s. o. Konvergenzfehler)
* Secundary cues (erlernte Distanzhinweise): Oberflächenbeschaffenheit, dunstige Atmosphäre, Perspektiven, Beleuchtung, bekannte Daten etc.
* Lateraldisparation: Die Querdisparation wird wirksam, wenn sich nach einigen Metern Akkomodation und Konvergenz kaum noch ändern. Innerhalb gewisser Netzhautareale (der Panum'schen Empfindungskreise, eig. -ellipsen; nach Peter Ludvig Panum 1820-1885) wird eine sukzessive Reizung in horizontaler Richtung (da die Augen nebeneinander liegen) nicht als Doppelbild oder Bewegung, sondern als Tiefeneindruck wahrgenommen. Ex.: Durch Druck auf den Augapfel entfernen sich die Areale zu weit voneinander, sodass Doppelbilder entstehen.
* Ex. „Umkehrbrille“, durchgeführt 1950 an der Universität Innsbruck von Theodor Erismann (1883-1961) und Ivo Kohler (1915-1985): das Leben mit einer rechts / links bzw. oben / unten vertauschenden Prismenbrille ist nach einigen Wochen problemlos möglich. Die Rückumstellung erfolgt schneller. Daraus folgt, dass die Raumvorstellung des Menschen nicht unabänderlich, ein Umlernen möglich ist (vgl. Video 1 = Video 2).
* Ex. „Visuelle Klippe“, durchgeführt 1960 von Eleanor Jackie Gibson (1910-2002) und Richard D. Walk (1920-1999): überdeckt man einen Abgrund mit einer Glasplatte, weigert sich ein Kleinkind, auch wenn es das Glas fühlen kann, die visuelle Klippe (vgl. Video) zu überkrabbeln (funktioniert auch bei Tieren). Tiefenwahrnehmung und räumliches Sehen wurden so schon im ersten Lebensjahr nachgewiesen.
Zur dreidimensionalen Wirkung mancher Muster vgl. 3D-Bilder - Stereogramme und Beispiele zum Betrachten: Stereogram Gallery
- Bewegungssehen:
* Definition: Werden Rezeptoren rasch
hintereinander (sukzessive) gereizt, erlebt man dies als Bewegung. (Einzelbilder müssen den sog.
Moment unterbieten, s. u.)
* Ursache: Ein Bewegungseindruck entsteht entweder durch Bewegung des Kopfes (die Netzhaut „streicht“ über die Objekte) oder durch Bewegung der Außenwelt (die Objekte „streichen“ über die Netzhaut). Dies kann durch Erfahrung und die Rückmeldung über die Kopf- oder Augenbewegung auseinandergehalten werden. Das Gehirn greift - wie immer - dauernd in unsere Wahrnehmung ein (vgl. verkehrtes Netzhautbild, Blinder Fleck, etc.) Fällt der Bezugsrahmen jedoch weg, kommt es zu Bewegungstäuschungen.
Exe.: Zwei-Züge-Täuschung (ohne Fixpunkt lässt sich nicht entscheiden, ob der eigene Zug oder der gegenüberliegende in Bewegung ist), die Mach'sche „Hexenschaukel“ auf Jahrmärkten (bei der sich das Haus um den Beobachter dreht, was das Gehirn als nicht möglich detektiert, sodass Schwindelgefühle folgen, als ob sich die Person selbst drehen würde; nach Ernst Mach 1888-1900; vgl. das Buch von Boris Goesl, *1982?, u. a., Zum Planetarium. Wissensgeschichtliche Studien; Fink-Verlag 2018).
Vorgetäuschte Bewegung wird auch beim durch den Stroboskopeffekt hervorgerufenen Phi-Phänomen (beschrieben von Max Wertheimer, 1880-1943) erzeugt: z. B. entsteht eine Scheinbewegung, wenn Lichtpunkte auf Reklametafeln „springen“. (Adhémar Maximilian Maurice Gelb, 1887–1936, entdeckte in einem Ex. das Tau-Phänomen, nach dem 2 von 3 Punkten, die alle voneinander denselben Abstand haben, dann als einander näher stehend wahrgenommen werde, wenn das zeitliche Intervall ihrer Darbietung kürzer ist.) Bewegungstäuschungen treten auch in verschiedenen anderen Situationen auf, z. B. beim Film (s. u.), als Autokinetischer Effekt, wenn kleine Lichtpunkte - nystagmusbedingt (s. o.) - vor dunklem Hintergrund als bewegt erscheinen, als Induzierte Bewegung, wenn z. B. ziehende Wolken den Mond bewegt erscheinen lassen, oder s. hier oder hier. Sie können auch durch eine „Überforderung“ der Netzhaut bedingt sein wie im folgenden Ex.: Blickt man etwas länger auf einen Wasserfall und bewegt die Augen danach z. B. auf eine ruhende Baumgruppe, scheint diese von unten nach oben zu „steigen" (motion aftereffect) oder bei der Abb. 1/16, die Drehbewegungen vortäuscht:
Abb. 1/16: Scheinbewegung (photographiert im Wiener Haus der Mathematik)
AKUSTISCHE WAHRNEHMUNG, RAUMLAGESINN - DAS OHR
Vgl. Hearing (Audition), Akustische Phonetik (Universität München) bzw. Hörzentrum Oldenburg oder Online-Hörtest
- Aufbau und Funktion der Ohren:
Vgl.
Das
Ohr
* Binauralität (Zweiohrigkeit): Abgesehen von der Redundanz (die Dysfunktionalität nur eines Ohres bewirkt noch keinen Hörverlust) bewirkt die Doppelausstattung einen Stereoeffekt und ermöglicht das Richtungshören, das aufgrund des zeitlichen Unterschiedes des Eintreffens des Reizes zwischen linkem und rechtem Ohr funktioniert. (Vgl. Ex.: Festlegen der Windrichtung durch Drehung des Kopfes und Beobachtung des Höreindruckes). Phylogenetisch sind unsere Ohren aus Druckrezeptoren (wie sie bei Fischen als niederfrequente Strömungsdetektoren funktionieren; trommelfellartige Membranen gibt es bereits bei Amphibien) entstanden.
* Außenohr (Ohrmuschel - Aurikel und sichtbarer Gehörgang): dient dem besseren Einfangen der Schallwellen
* Mittelohr: Hier existieren Verbindungen zur Eustachi'schen Röhre (nach Bartolomeo Eustachi, ca. 1500/20-1574) und zum Nasenraum. Das Trommelfell verstärkt die Schallwellen; Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel, zusammen die Ossikel) leiten die Wellen mittels Vibration durch das Ovale Fenster ins
* Innenohr: Hinter dem Mittelohr existiert ein häutiges Labyrinth aus Sacculus, Utriculus, den Bogengängen und der fast dreifach gewundenen Schnecke (Cochlea), in der sich eine Flüssigkeit, Sinneshärchen und die Basilarmembran, deren jeweilige Konfiguration den Höreindruck kodiert, mit dem reizaufnehmenden, mit 3500 inneren und 15 000 äußeren Haarzellen bestückten Corti'schen Organ (nach Alfonso Corti, 1822-1876) befinden. Über die gekreuzte Hörbahn (je Hörnerv einige Tausend Fasern, die zu den schnellsten Nervenzellen zählen), auf der das Synapsenzentrum des Olivarkomplexes passiert wird, gelangt der Eindruck ins Gehirn (zunächst in den primären Hörkortex).
|
|
|
Abb. 1/17: Aufbau des menschlichen Ohres: (Abbildung aus http://www.interton.de; dort auch Video)
- Daten:
* Hörbereich des Menschen (vgl.
Online-Hörtest):
Nach Erreichen einer Mindestlautstärke hören wir Tonhöhen im Frequenzbereich
von höchstens 16 bis 16 000 Hz (Luftschwingungen pro Sekunde). Bereits ab dem 15. Lj.
sind Einbußen (Presbyakusis; 60 J.: 5000 -
8000 Hz) zu verzeichnen. Tiere hören tw. weit besser als Menschen (Delphin: 150 bis 150000 Hz., Hund: 15 bis 50000 Hz, Katze: 50 bis 65000 Hz).
Die
Lautstärke eines Schalls hängt von der Amplitude ab. Maßzahlen sind Dezibel (dB
- objektiv; 1 Bel - benannt nach Alexander
Graham Bell,
1847-1922 - kennzeichnet den dekadischen Logarithmus des Verhältnisses zweier
Größen der gleichen Art bei Pegeln und Maßen, in diesem Fall 2mal log aus
Tonschalldruck gebrochen durch Schalldruck der Absolutschwelle) oder Phon (subjektiv;
auf einer Schallskala würden Isophone jene Töne verbinden, die als
gleichartig empfunden werden, nicht solche, die objektiv gleich sind).
Die Schallstärke ist dem Quadrat des Schalldrucks proportional. (Ein sehr
intensiver Hörreiz wird irgendwann zu einem Schmerzreiz.)
* Sprache und Musik: Die Mehrheit aller Geräusche liegt zwischen 500 und 8000 Hz., der Sprechbereich meist zwischen 1000 und 3000 Hertz, der Gesangsbereich zwischen 100 und 10000 Hz (Bass bis Sopran). Der Schalldruckpegel eines Orchesters beträgt etwa 100 dB, geflüsterte Worte unter 10 dB. fMRT-Studien zeigen, dass Sprache und Musik in unterschiedlichen kortikalen Bereichen verarbeitet werden. Die Unfähigkeit, Tonhöhen oder ganze Melodien erkennen zu können, nennt man Amusie. (Instrumental ausgeführte Musik - und nicht nur die Nachahmung von Naturgeräuschen - gibt es vermutlich etwa seit 40 000 Jahren, möglicherweise wurde davor schon gesungen.)
* Tondiskrimination: Der Mensch kann ca. 2000 unterschiedliche Töne voneinander unterscheiden, Geschulte (z. B. Musiker) schaffen mehr. Manche Menschen besitzen ein absolutes Gehör oder Tonhöhengedächtnis, das sie in die Lage versetzt, jeden beliebigen Ton ohne Hilfsmittel oder Bezugstöne identifizieren zu können. Diese Fähigkeit ist nur bedingt (unter 6 Jahren) erlernbar, meist aber angeboren. Der Embryo hört mit 20 Wochen, ab der 8. Schwangerschaftswoche kann er auf unterschiedliche Töne unterschiedlich reagieren.
- Hörstörungen:
*
Hörprobleme: Schwerhörigkeit (Hypakusis)
tritt im späteren Lebensalter fast zwangsläufig auf, da die Hörbahn im Laufe der
Zeit degeneriert und dann nicht mehr das gesamte Frequenzband wahrgenommen
werden kann. Hörhilfen verschaffen Abhilfe. Die Früherkennung ist vor allem bei
der Schwerhörigkeit (oder gar Gehörlosigkeit) Neugeborener wichtig, um nicht falschen Attribuierungen
anheim zu fallen und möglichst früh Maßnahmen und Förderungen einleiten zu
können.
* Hörsturz: Nach einem Ohrinfarkt plötzlich (meist einohrig) auftretende Höreinschränkungen (bis zum Hörverlust), die sich meist in angemessener Zeit wieder rückbilden. Die Störung (kein Notfall) verursacht ein Gefühl, als hätte man Watte im Ohr, und wird oft von einem Tinnitus begleitet. Als Ursachen gelten Durchblutungsstörungen oder Stress.
* Tinnitus: Ein Tinnitus aurium liegt vor, wenn Geräusche ohne objektive Schallquelle wahrgenommen werden (häufiger bei älteren Menschen und Musikern oder anderen lärmintensiver Umgebung ausgesetzten Menschen).
* Gehörlosigkeit (früher Taubheit, noch früher ungehœrde): Wie Blindheit kann Taubheit (Surditas) ihre Ursachen im Gehirn, in den Sinnesbahnen oder in den Sinnesorganen haben. Angeborener Gehörlosigkeit wird mit Cochlea-Implantaten und/oder dem Erlernen der Gebärdensprache begegnet. (Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist seit 2005 als eigenständige Sprache anerkannt.)
- Tonmischung:
* Weißes Rauschen: Zufallsmischung
aller Frequenzen (Begriff analog zur Farbmischung; Bspl.: alte TV-Geräte ohne
Sendereinstellung)
* Obertöne: Dieser Begriff bezeichnet mitschwingende ganzzahlige Vielfache der (tieferen) Grundtöne. Die meisten Schallquellen produzieren keinen einheitlichen, sondern einen zusammengesetzten Ton. Konstante Oberschwingungen, die den Charakter eines Schallereignisses prägen, heißen Formanten. Der Glockenschlag besteht nur aus Obertönen (Residuumphänomen).
* Eindruck: Als angenehm werden ganzzahlige Mischungen (akustische Harmonien) z. B. Oktave: 1:2; Quint: 3:2; Quart: 3:4; Septime 8:15 etc. empfunden. Schallereignisse haben je nach ihren Obertönen und anderen Variablen unterschiedliche Ausdruckswirkungen, die von Werner Herkner (*1941) nach den Dimensionen Lust - Unlust, Ernst - Heiterkeit und Ruhe - Aktivierung systematisiert wurden. Angenehme Geräusche werden als Klang, unangenehme als Lärm bezeichnet.
Die Anmutungsqualität von Lauten wurde von folgendem Ex. untersucht: Sollen Vpn. verschieden lautende Phantasiewörter vorliegenden eckig oder rund gezeichneten Formen zuordnen, so unterscheiden sich ihre Ergebnisse signifikant: 90% der Vpn assoziierten die Lautfolge „takete“ eher mit spitzen, die Lautfolge „maluma“ eher mit runden Körpern (Signifikanz erst ab der Pubertät; s. a. u.).
- Hydrodynamische Hörtheorie (Wanderwellen-,
Dispersionstheorie):
1960 entwickelt vom Ungarn Georg von
Békésy (1899-1972, Nobelpreis
1961). Sie löste die Schallbildtheorie von Ernst
Julius Richard
Ewald (1855-1921; sie verglich die
Vorgänge im Ohr mit den Mustern, die auf einer mit Sand bestreuten Platte
entstehen, die durch einen Ton in Schwingungen versetzt wird) und die Resonanztheorie von Hermann
von Helmholtz (eine
Einortstheorie; sie verglich die Basilarmembran mit den Saiten einer Harfe und
wurde durch die Habilitationsschrift von Otto Friedrich Ranke,
1899-1959, zur „Gleichrichter-Resonanztheorie“ erweitert) und einige weitere
widerlegte Theorien
ab.
Auch die Dispersionstheorie ist eine Einorttheorie: Die Schallwellen (Schwingungen von Luftmolekülen) werden in Abhängigkeit von ihrer Wellenlänge zerlegt (Dispersion, Frequenzauftrennung im Innenohr). Elastizität und Massendichte der Basilarmembran, auf der durch die in der Lymphflüssigkeit der Cochlea sich fortbewegenden Schallwellen frequenzspezifische stehende Wellen erzeugt werden, bestimmen - analog einer in Schwingungen versetzte senkrecht hängende Kette, deren unteres Ende sich in einem mit Wasser gefüllten Behälter befindet - den Ort der Maximalamplitude hoher bzw. tiefer Töne, wobei jedem Ton ein Reaktionsgebiet entspricht. Je größer die Elastizität und je geringer die Massendichte, desto größer die Leitungsgeschwindigkeit - und umgekehrt. Die Geschwindigkeit errechnet sich nach der zugrundeliegenden Formel als Wurzel aus Elastizität gebrochen durch Massendichte.
- Das Ohr als Gleichgewichtsorgan / Vestibularorgan:
* Physiologie des Gleichgewichtssinnes: Im Innenohr befinden sich drei
Bogengänge, die (den dreidimensionalen Raum kopierend) aufeinander normal stehen und mit
gallertartiger Flüssigkeit (Endolymphe), die an Sinneshärchen streift, gefüllt
sind.
Durch die Bewegungen des Kopfes gerät die Flüssigkeit in Bewegung und kommt nach dem
Trägheitsgesetz erst einige Zeit nach seinem Stillstand zur Ruhe. Dadurch
entsteht ein Schwindelgefühl. Man unterscheidet organischen Schwindel (physiogen)
von funktionellem Schwindel (psychogen).
Nachdem der österreichische Physiker und Philosoph Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (1838-1916) 1865 das Ohr als Gleichgewichtsorgan entdeckt hatte, erfolgte die Erforschung des Vestibularapparates durch den ersten österreichischen Medizinnobelpreisträger (1914), Robert Bárány (1876-1936).
* Sinn für die Lage des Kopfes im Raum: befindet sich ebenfalls im Innenohr. Zwei winzige Kalkkristalle (Otolithe) in Utriculus und Sacculus (zwei säckchenartige Gebilde im Innenohr) reizen Sinneshärchen, wenn der Kopf bewegt wird. (Diese Wahrnehmung kann z. B. bei manchen Flugmanövern getäuscht werden, weshalb Piloten angehalten sind, der Anzeige ihrer Instrumente zu vertrauen.) Die Wahrnehmung der Lage des Körpers im Raum (und die der Stellung der einzelnen Körperteile zueinander) nennt man Propriozeption. Sie ist zusammen mit Millionen Sensoren der Viszerozeption (Wahrnehmung der Körperorgane) Teil der durch Organellen vermittelten Interozeption (im Gegensatz zur Exterozeption, der Wahrnehmung der Außenwelt). Die Gesamtheit der Bewegungsempfindungen in Verbindung mit Lage, Spannung, Stellung im Raum und die subliminale Steuerung und Kontrolle von Körperteilen wird kinästhetischer Sinn genannt.
OLFAKTORISCHE WAHRNEHMUNG - DIE NASE
Vgl. Seite über das Riechen, Smell (Olfaction)
- Allgemeines:
Der Geruchssinn dient der Ortung
und Beurteilung von Nahrung, Territorien und Feinden (hier ist
der Mensch vielen Tieren unterlegen) sowie der
Erkennung der Pheromone (chemischer Signale bzw. Sexuallockstoffe von
Artgenossen), die ein für die Paarung kompatibles Immunsystem signalisieren, das
beim Menschen jedoch oft durch artifizielle Gerüche wie Parfums überlagert wird.
(Dieses Tatsache wird - ein mechanistisches Menschenbild voraussetzend - manchmal als Grund für missglückte Partnerwahlen
angeführt.)
Gerüche werden auch intentional, z. B. in der Werbung, manipulativ eingesetzt.
Für die Erforschung des olfaktorischen Systems erhielten Richard
Axel (*1946) und Linda
B. Buck (*1947) 2004 den
Medizin-Nobelpreis. Sie entdeckten unabhängig voneinander, dass jedes Neuron
nur einen Rezeptortyp ansteuert. Gleichartige Rezeptoren sind auf der
Riechschleimhaut nach dem Zufallsprinzip verteilt, werden aber im Bulbus
olfactorius (einem unterhalb des Frontalhirns liegenden vorgestülpten
Gehirnteil, dessen Aufgaben über das Olfaktorische hinausreicht; s. u.)
an derselben Stelle wahrgenommen. So generiert das Gehirn eine aus den
verschiedenen Schleimhautbereichen zusammengesetzte Empfindung.
- Geruchstheorien:
* Biologie: Die olfaktorische Wahrnehmung erfolgt
über eine Differenzierung des Epithels der oberen Nase (die auch als Teil der Atmungsorgane täglich ca.
20 000 Liter Luft filtern, erwärmen und befeuchten muss). Beteiligt am Riechen sind das olfaktorische (der obere Bereich der beiden Nasenhöhlen in
der sogenannten Riechzone - Regio olfactoria - oder Riechschleimhaut) und
das nasal-trigeminale System. Pheromone werden über das nach dem dänischen Chirurgen Ludwig
Levin Jacobson (1783–1843)
benannte Jacobson- oder
Vomeronasalorgan in der Nasenhöhle aufgenommen. In der Nasenschleimhaut
zählte man ca.
10 Mio. säulenförmige Riechzellen, die es ermöglichen, die Duftstoffe mit ca. 350 verschiedenartige
Rezeptoren, die sich auf Zilien, also feinen, auf den Riechzellen sitzenden Härchen
(die von Schleim umhüllt sind, der die Geruchsmoleküle auflöst, um ein Andocken
an die Rezeptoren zu ermöglichen) befinden, wahrzunehmen.
Da Gerüche im Gegensatz zu den anderen Wahrnehmungsformen ipsilateral verarbeitet werden (das rechte Nasenloch von der rechten Gehirnhälfte, das linke von der linken) und damit nicht über den Thalamus laufen, sondern über Geruchsfäden im Siebbein ins Limbische System geleitet und dort abgespeichert werden, bleiben sie meist unbewusst und werden oft mit früher Erlebtem assoziiert. (Sie können sogar als Trigger für PTSD - s. u. - fungieren.)
Man unterscheidet Makrosmaten (gute Riecher, z. B. Hunde) von Mikrosmaten (schlechte Riecher, z. B. Menschen) und Anosmaten (ohne Geruchssinn, z. B. Vögel). Unter Dysomien versteht man Riechstörungen (haben sie ihre Ursache in Fehlfunktionen des Riechkolbens, spricht man - im Unterschied zu den durch äußere Ursachen bedingten peripheren - von zentralen Dysomien). Eine COVID 19-Infektion (u. a.) kann den Geruchssinn (auch den Geschmackssinn) vorübergehend oder für lange Zeit außer Kraft setzen (Anosmie bzw. Hyposmie, wenn der Sinn noch reduziert funktioniert). Auch 90% aller von der Parkinson-Erkrankung Betroffenen (nach dem englischen Arzt James Parkinson, 1755-1824, der die Krankheit als Paralysis agitans erstbeschrieben hat) berichten von einer frühzeitigen Beeinträchtigung der Olfaktorik.
* Stereochemische Geruchstheorie: Nach John E. Amoore (1930-1998) passen die aufsteigenden Moleküle augrund ihrer räumlichen Gestalt in die Rezeptoren wie ein Schlüssel ins Schloss und bewirken nach einer chemoelektrischen Transduktion (Umwandlung des chemischen Reizes in ein elektrisches Signal) einen Geruchseindruck, der ipsilateral (aus Platzmangel kann keine Überkreuzung mehr stattfinden) zum Riechkolben (Bulbus Olfactorius) und weiter ins Riechhirn (Rhinencephalon) weitergeleitet wird. Auch der Gesichtsnerv Nervus Trigeminus kann in der Nasenhöhle (nasal-trigeminal) über seine freien Endigungen (nicht über eigene Sinneszellen) flüchtige Substanzen in Empfindungen wie brennend, stechend, beißend, kühlend sowie in der Mundhöhle (oral-trigeminal) flüchtige und nicht-flüchtige Substanzen in die Empfindungen scharf, prickelnd, kühlend umsetzen. (Die Nähe zur haptischen Wahrnehmung, s. u., ist offensichtlich.) Zu neueren Entwicklungen s. o.
- Einzelne Gerüche:
* Duftstoffe: Der Geruchssinn (als chemischer Sinn) erlaubt die Verarbeitung zahlloser flüchtiger chemischer
Substanzen, deren Moleküle in das Riechsystem eindringen können. Nur sieben der
Chemischen Elemente besitzen in ihrer Reinform einen Geruch: Fluor, Chlor, Brom, Jod,
Phosphor, Arsen und Sauerstoff (als Ozon; z. B. vor Regengüssen oder, wenn O3 aus
Eisbergen entweicht, riechbar). Die Duftstoffe müssen wasserlöslich
und gasförmig sein, um umgewandelt werden zu können.
Ex.: 1 Millionstel Milligramm Vanille pro 1 Liter Luft
genügt, um einen Riecheindruck hervorzurufen. Menschen (Frauen etwas mehr als Männer)
können nur wenige Einzelgerüche
(und zahllose Kombinationen) wahrnehmen:
| ° | stechend, beißend (z. B. Essig, Ameisensäure) |
| ° | faulig (z. B. verdorbene Eier, Schwefelwasserstoff) |
| ° | ätherisch (z. B. Fleckputzmittel) |
| ° | kampferartig (z. B. Mottenmittel) |
| ° | moschusartig (z. B. Engelswurz) |
| ° | minzig (z. B. Pfefferminze) |
| ° | blumig (z. B. Rosen) |
Andere Gerüche (Aromen) sind Mischungen, sodass dem Menschen ca. 100 000 (manche Schätzungen liegen weit höher) verschiedenartige Eindrücke möglich sind. Experten können bis zu 10 000 Gerüche voneinander unterscheiden.
GUSTATORISCHE (GESCHMACKS)WAHRNEHMUNG - DIE ZUNGE
Vgl. Taste (Gustation)
- Biologie und Funktionsweise:
Die Rezeptoren auf der Zunge heißen Geschmackspapillen (Schleimhautstrukturen mit Erhebungen),
deren Anzahl etwa bei 100 liegt. Sie tragen 5 bis 150 birnenförmige Geschmacksknospen - pro cm² können über 1000
Knospen vorhanden sein -, an deren oberem Ende bis zu 100 Geschmacksporen das Eindringen
der zu verarbeitenden chemischen Substanzen ermöglichen. Diese nicht neuronalen
Geschmackszellen erneuern sich alle 10-30 Stunden laufend. Die nervösen Elemente
liegen unterhalb der Geschmacksknospen. Manche Menschen (sogenannte
Supertaster) weisen eine erhöhte Geschmackssensitivität auf.
Der Geschmackssinn funktioniert meist im Zusammenspiel mit anderen Sinnen, v. a. mit dem Geruchssinn und dem optischen Sinn. (Vgl. folgende Ex.e: Die Geschmacksrichtung eines gelben Himbeersafts wird seltener bzw. langsamer erkannt als die eines - erwartbaren - roten. / Die Trefferquote sinkt, wenn die Nase zugehalten wird.) Auch ein etwaiges Hungergefühl und Sprache beeinflussen die gustatorische Wahrnehmung. (So versucht die Werbung „Geschmacksverbesserungen“ zu erzielen, indem sie den Produktverpackungen Wörter beifügt, die passende Eigenschaften insinuieren; z. B. „tropical“, „tasty“.) Neben Geschmacksempfindungen können Lebensmittel an den Nervenenden in der Mundhöhle auch Schmerzempfindungen (z. B. das in Chili enthaltene Capsaicin) oder Temperaturempfindungen (z. B. die kühlende Minze) auslösen.
- Geschmacksrichtungen:
Die Geschmacksknospen lassen vier Geschmackseindrücke zu, von
denen man (v. a. David Pauli
Hänig, 1863-1920, dessen Arbeiten
später verzerrt dargestellt wurden) lange annahm, sie seien nicht überall auf der Zunge
in der gleichen Weise möglich.
Ex.: Wenn man etwas Salz auf die Zungenspitze
aufträgt, kann man den Geschmack nur schwer
identifizieren.
| ° | süß |
| ° | salzig |
| ° | sauer |
| ° | bitter |
Nach neueren Forschungen (v. a. durch Linda May Bartoshuk, *1938) sind die Rezeptoren nicht der Reihenfolge nach auf der Zunge von vorne nach hinten angeordnet, sondern über die gesamte Zunge verteilt. Die Zungenmitte ist geschmacksunempfindlicher als die Ränder. Außerdem gebe es mit umami (japanisch für würzig, schmackhaft; detektiert z. B. Glutamat) und fettig zwei weitere Geschmacksrichtungen.
HAPTISCHE WAHRNEHMUNG - DIE HAUTSINNE
Vgl. Video zur haptischen Wahrnehmung der Universität Regensburg von 1982 und Touch (Somatosensation)
- Allgemeines:
Die Haut (δέρμα) ist das größtes Sinnesorgan (ca. 2 m², ca. 20-25% des
Körpergewichts). In 1 cm² Haut (besteht aus Oberhaut / Epidermis mit Hornhaut
/ Cornea,
Lederhaut / Dermis, Corium - beides zusammen Cutis - und Unterhaut / Subcutis
mit Fettgewebe) befinden sich ca. 4 m Nervenbahnen und 1 m Blutgefäße. Sie hat vielfältige Funktionen:
Atmung, Schutz (vor UV-Strahlen, Verletzungen, Kälte etc.), taktiler Sinn, Temperaturregelung
über Schweißdrüsen usw. und enthält für folgende
Empfindungen
- Rezeptoren:
* Tastsinn: funktioniert über die
Tastrezeptoren Meissner-Körperchen
und Merkel-Zellen (nach dem
deutschen Anatomen und Physiologen Georg
Meissner, 1829-1905 und Friedrich
Merkel 1845-1919; vor allem in der
unbehaarten Haut und an den erogenen Zonen). Zusätzlich erfolgt (wie bei
tierischen Schnurrhaaren) über mechanorezeptive Follikel eine Rückmeldung über die
Haarstellung.
* Druck: Eine Identifizierung von Druck bzw. eine rasche Adaptation daran wird durch die in der Subcutis befindlichen Vater-Pacini-Körperchen (nach dem deutschen Anatomen Abraham Vater, 1684–1751, und dem italienischen Anatomen Filippo Pacini, 1812–1883), mittels derer auch Vibrationen und Oberflächentexturen erkannt werden können, ermöglicht. Beständigen Druck, wie etwa den der Kleidung auf der Haut, nimmt man allmählich nicht mehr wahr. Der Körper ist nicht überall gleich berührungssensitiv, vgl. Ex. (von Ernst Heinrich Weber): Wenn man gespreizte Zirkelspitzen auf die Haut setzt, beträgt der für zwei getrennte Empfindungen notwendige Abstand zwischen 1 mm (auf der Zunge) und 68 mm (auf dem Rücken). Eine Störung der Druckempfindlichkeit nennt man Dysbarognosie (eine leichte Form der Abarognosie; s. u.).
* Temperatur: Die Erforschung des Temperatursinns (Thermorezeption) erfolgte mithilfe von Capsacain (auch in Chili enthalten; auf Englisch nicht zufällig mit dem Epitheton „hot“ bedacht), das in der Lage ist, das Protein TRPV1 (das Kationenkanäle bildet, die Nervenzellen Wärme verspüren lassen) zu kodieren, v. a. durch David Julius (*1955) und Ardem Patapoutian (*1967). Sie identifizierten diverse Sensoren in den Nervenenden der Haut und erforschten die Signaltransduktion der Sensorik (Nobelpreis 2021). Wärme- und (10mal häufigere) Kälterezeptoren nehmen die (Außen)temperatur und ihre Änderungen wahr. 1 cm² Hand kann bis zu 5 Kaltpunkte und 0,4 Warmpunkte enthalten, andere Körperregionen noch mehr (z. B. Lippe: 20 Kaltpunkte) oder auch weniger. Als Folge der erhaltenen Informationen reagiert der Körper bei übermäßiger Kälte mit Schüttelfrost (um Wärme zu erzeugen) oder bei übermäßiger Hitze mit Schweißausbrüchen (um Verdunstungskälte zu generieren).
| ° | Kälte: Ex.: Besteigt man eine heiße Badewanne, reagiert man zunächst mit (atavistischer) Gänsehaut: paradoxe Kälteempfindung, da die Kältepunkte der Hautoberfläche näher liegen und häufiger sind als die Wärmepunkte, die überdies langsamer arbeiten. |
| ° | Wärme: Ex. zur Relativität der Empfindungen: Wenn man die rechte Hand 20 sec in heißes, die linke gleichzeitig in kaltes und dann beide in lauwarmes Wasser hält, erzielt man ein umgekehrtes Wärmeempfinden. (Eine vergleichbare, analoge haptische Täuschung, die - wie die optischen Täuschungen - trotz gegenteiliger Einsicht in die wahren Verhältnisse nicht abgeschaltet werden kann, ist die Charpentier'sche Täuschung; nach Augustin Charpentier, 1852-1916. Ex.: Hebt man (gleichzeitig oder nacheinander) zwei Würfel von gleichem Gewicht, aber unterschiedlicher Größe, so empfindet man den kleineren Würfel als schwerer. |
Da die weiterleitenden Bahnen unterschiedliche Temperaturen nah beieinander liegender Objekte nicht zu unterscheiden imstande sind, kann folgende haptische Täuschung entstehen: legt man im Ex. eine warme Münze zwischen zwei kalte, dann fühlen sich alle drei gleich kalt an, wenn sie mit den mittleren drei Fingern einer Hand gleichzeitig berührt werden.
* Schmerz: Schmerz, der nur subjektiv eingeschätzt, aber nicht objektiv gemessen werden kann, wird aufgrund von undifferenzierten Schmerzrezeptoren, der freien Enden der sensorischen Nervenbahnen, die als Nozizeptoren (in der Leder- und Oberhaut) Signale an das Gehirn leiten, um durch „Overpowern“ anderer Impulse eine z. T. lebensnotwendige Prioritätsveränderung zu bewirken, wahrgenommen. Solange die physiologische Balance zwischen Erregung und Hemmung stimmt, funktioniert der Schmerz als notwendiges Warnsignal, wird diese (z. B. durch Einnahme von Schmerzmitteln schon bei geringem Anlass, von Alkohol, bei Übergewicht oder unter Stress) gestört, können Schmerzen auch ohne Ursache entstehen, weil sich durch das Anwerfen von Entzündungsmediatoren (Neuroinflammationen) die Schmerzverarbeitung im Gehirn verändert.
Schmerzen können akut oder chronisch auftreten. (Kopf-, Lenden- oder Halswirbelsäulen- und Athroseschmerzen treten häufig auch chronifiziert auf; zu Kopfschmerzen vgl. hier.) Wird ein normalerweise harmloser Reiz als Schmerz empfunden, spricht man von Allodynie, wenn zusätzlich auch die Empfindlichkeit auf Schmerzreize erhöht ist und überreagiert wird, von Hyperalgesie. Eine Überempfindlichkeit gegenüber allen Stimuli, auch Schmerzreizen, heißt Hyperpathie, eine unangenehme Sensibilitätsstörung, die spontan oder auf diverse Reize z. T. schmerzhafte Missempfindungen auslöst, Dysästhesie. Prinzipiell unterscheidet man
3 Schmerzmodi:
| ° | nozizeptive Schmerzen (drückend, ziehend, stechend; mechanisch, chemisch, thermisch oder inflammatorisch verursacht) |
| ° | neuropathische Schmerzen (oft chronisch kribbelnd; verursacht durch dysfunktionales Gewebe oder geschädigte Nerven) |
| ° | noziplastische Schmerzen (schwer, brennend; durch veränderte Schmerzwahrnehmung ohne Schädigungen verursacht) |
Ex. Phantomschmerz: ein amputierter Teil schmerzt, wenn ehemals dafür zuständige Nerven, deren Enden nicht mehr vorhanden sind (was das Gehirn aber nicht „weiß“), gereizt werden bzw. einander überlappende Kortexareale Interferenzen zeigen. Linderung kann die vom indischen, in den USA tätigen Neurowissenschaftler Vilayanur Subramanian Ramachandran, *1951, erfundene Spiegelbox verschaffen, die dem Hirn vorspielt, dass der fehlende Teil noch vorhanden wäre.)
Schmerzen werden mit Opiaten (wie Morphin oder Codein), die direkt am Rezeptorsystem angreifen und so die Schmerzempfindung und -übertragung regulieren, mit schmerzstillenden Analgetica (wie z. B. Paracetamol) und entzündungshemmenden Antiphlogistica (z. B. Ibuprofen, Aspirin) bekämpft. Dies kann bei missbräuchlicher Anwendung zu schweren Abgängigkeiten (s. u.) führen.
DIE ZEITWAHRNEHMUNG
Vgl. Psychologie der Zeit
- Allgemeines:
Vorbemerkung: Zeit, in dem Sinne, wie wir sie glauben wahrzunehmen, gibt es
nicht. Schon Aurelius Augustinus von Hippo
(354-430) hat auf die Frage Quid est enim tempus? geantwortet: „Si nemo
ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.“ Empirisch erfahrbar ist für uns ausschließlich die Gegenwart.
Vergangenheit und Zukunft sind als Erinnerung und Erwartung intrapsychische
Phänomene. (Vgl. Ludwig Wittgenstein, 1870-1954: „Wenn man unter
Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt
der ewig, der in der Gegenwart lebt.“ oder Friedrich Schiller,
1759-1805: „Dreifach ist der Schritt der Zeit: / Zögernd kommt die Zukunft
hergezogen, / Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, / Ewig still steht die
Vergangenheit“.)
Immanuel Kant (1724-1804) hat Zeit (wie auch Raum) als angeborene Anschauungsform, die denkkategorial die Erscheinungen (Phänomene), aber nicht das „Ding an sich“ erschließen würde, bezeichnet. Außerhalb dieser Kategorie sei ein Denken gar nicht möglich. Die „Wirklichkeit“, wie immer sie „wirklich“ beschaffen sei, werde in unsere kongenitalen Voraussetzungen eingepasst. Albert Einstein (1879-1955) wies nach, dass Zeit geschwindigkeits-, masse- und ortsabhängig sei und als absolute Messgröße des Universums nicht existiere; es habe die „Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion“. Der britische Neurowissenschaftler Anil Kumar Seth (*1972; s. u.) meint, dass Zeit (genauso wie Farbe oder das Bewusstsein des Selbst) keine direkte Reflexion einer objektiven Existenz, sondern eine Konstruktion unseres Gehirns, die auf etwas anderem (anderen Sinneserfahrungen) beruhe, sei (vgl. hier). Die Erfahrung sei real, nach einer objektiven Substanz von Zeit (oder Farbe oder dem Ich), die unabhängig von unserem Geist dieser Erfahrung entspricht, suche man aber vergeblich.
- Steuerung:
Die Grundlagen der Zeitwahrnehmung
funktionieren nicht bei allen Lebewesen gleich. Beim Menschen erfolgt die
Steuerung durch das Gehirn. Entscheidend für die Zeitwahrnehmung scheint die Inselrinde, die auch für
die Interozeption -
s. o. - verantwortlich ist, zu
sein. Auch Basalganglien und der rechte Parietallappen sind beteiligt, aber wohl
nicht (wie früher angenommen) der alleinige Sitz der inneren Uhr. Ex.: Ameisen haben eine durch Chinin
(Futterbeigabe) beeinflussbare stoffwechselgesteuerte „innere Uhr“.
Beweise für die Hirnsteuerung:
* Exaktes Aufwachen zu bestimmter Uhrzeit ist ohne Wecker (oft) möglich.
* Relativ exakte Zeitangaben, ohne auf eine Uhr zu sehen, sind (auch nach zufälligem Aufwachen!) möglich.
* Posthypnotische Aufträge (s. u.), die mit einem bestimmten Zeitpunkt verknüpft sind, werden pünktlich erfüllt.
* Substanzen, die auf das ZNS (und damit auch auf das Gehirn) wirken (z. B. Alkohol), beeinflussen auch die Zeitwahrnehmung.
- Psychische Präsenzzeit:
Die psychische Präsenzzeit ist nach William Stern
(1871-1938) jene Zeitspanne, in der das Vergangene eben noch bewusst ist, ohne dass eine
Gedächtnisleistung in Anspruch genommen werden müsste. Ex.:
Jede Sekunde wird eine Ziffer dargeboten. Nach dem unvermuteten, unangekündigten Ende der
Darbietung (bewusstes Mitlernen wird dadurch verhindert) müssen die Ziffern von
hinten nach vorne aufgeschrieben werden. Die Anzahl der Treffer bis zum ersten
Fehler ergibt ungefähr die Dauer der Präsenzzeit (meist 6 bis 12 sec).
- Circadianer Rhythmus:
Der
circadiane Rhythmus
(auch zirkadianer R.; darunter versteht die Chronobiologie die Schwankungen innerhalb des
Tages, die „innere Uhr“) ist angeboren und bestimmt das Leistungsverhalten.
Normalerweise wird er durch den Lichteinfall, der auf den Nucleus
suprachiasmaticus und die Zirbeldrüse (das ehemalige Scheitelauge)
weitergeleitet wird, gesteuert. Dadurch wird über die Veränderungen des
Adenosin-, Serotonin- und Melatoninhaushalts der Hormonspiegel und damit die
Stimmung beeinflusst. Neben dem Lichteinfall ist auch der Stoffwechsel ein
natürlicher Rhythmusgeber. Prinzipiell gilt, dass - genauso wie während des
Schlafes - im Laufe des Tages Aktivitäts- und Ruhephasen einander ablösen.
(2017 ging der Medizin-Nobelpreis an die US-Amerikaner Jeffrey
C. Hall, *1945, Michael
Rosbash, *1944 und Michael
W. Young, *1948, für die
Erforschung der molekularen Kontrollmechanismen des circadianen Rhythmus.) Einige Korrelate dieser Veränderungen (die individuell unterschiedlich sein
können) sind in der folgenden Graphik dargestellt:
Abb. 1/18: 24 h-Uhr: Circadianer Rhythmus (© Thomas Knob; zu den Schlafphasen s. o.)
Im sogenannten Bunkerschlaf-Ex. soll überprüft werden, inwieweit die Tagesrhythmizität bzw. deren Periodenlänge unveränderlich sind. Ergebnis: In totaler Abgeschiedenheit (keine Uhr, kein Sonnenlicht oder andere Tageszeithinweise) entwickelt der Mensch einen längeren, etwa 25-Stunden-Rhythmus, wie 1962 der französische Speläologe Michel Siffre (1939-2024; vgl. Interview) in einem zweimonatigen Selbstversuch herausgefunden haben will. (Unbewiesene) Theorie: Es besteht ein Zusammenhang mit der im Laufe der Jahrtausende sich verändernden (allerdings in 50 000 Jahren 1 Sekunde langsamer werdenden!) Geschwindigkeit der Erdrotation.
Eine im Alltag auftretende Störung des circadianen Rhythmus' (circadiane Dysrhythmie) besteht im sogenannten Jetlag: Werden in kurzer Zeit mehrere Zeitzonen überschritten (bzw. überflogen), kann die Adaption an die neue Situation einige Zeit in Anspruch nehmen, da die innere Uhr noch einige Stunden bis Tage in der alten Zeitzone verweilt. Um die vorzeitige Melatoninausschüttung zu verhindern, empfiehlt es sich, im Sonnenlicht zu bleiben. Meist fällt die Umstellung Richtung Westen einfacher als Richtung Osten, da man „nur“ die Einschlafzeit nach hinten verschieben muss. (Reisen nach Norden oder Süden wirken sich hingegen ohne die angesprochenen Begleiterscheinungen bloß auf die Verlängerung/Verkürzung des Sonnentages aus. Dieselben Symptome wie beim Jetlag können in geringem Ausmaß auch bei der Sommer- / Winterzeitumstellung auftreten.)
Vgl. Chronobiologie, ein Biotiming Tutorial, The Circadian Rythm Lab, What makes you tick? und Seiten über Lichttherapie 1 / 2 und Chronotherapy.
- Moment:
Unter einem Moment („Nu“, „Augenblick“)
versteht man die Zeitdauer, die vergehen muss, damit zwei Reize als voneinander getrennt wahrgenommen
werden können. Der optische Moment des Menschen liegt bei 1/18 sec und kann sich durch
Drogeneinfluss auf 1/12 sec verlängern. (Vgl.: der Moment ist z. B. bei der Fliege
oder beim Kampffisch - 1/30 sec - kürzer, bei der Schnecke mit 1/4 sec. länger
als beim Menschen.) Ex.: Ein
herkömmlicher (vordigitaler) Film besteht aus Tausenden Einzelaufnahmen, die rasch
hintereinander abgespielt werden, und musste daher
mindestens 18 Bilder pro Sekunde bieten, um nicht ruckartig zu erscheinen (meist 24, im TV 25). Zeitrafferaufnahmen
werden erreicht, indem weniger Aufnahmen,
Zeitlupenaufnahmen, indem mehr Aufnahmen pro Zeiteinheit hergestellt und mit jeweils 24 Bildern /
sec abgespielt werden.
- Beeinflussung des Zeitempfindens:
Jeder Mensch macht im Laufe seines Lebens die Erfahrung, dass die Art und Weise,
in der Zeit erlebt wird, völlig unterschiedlich sein kann. Zeit kann einerseits
„rasen“, andererseits fast „stillstehen“. Folgende Faktoren können in diesem
Zusammenhang wirksam werden:
* Sinnvolle Beschäftigung bzw. Abwechslung lässt die Zeit subjektiv schneller vergehen als langweilige Tätigkeiten. Ex.: Lustbetonte Dias scheinen subjektiv kürzer projiziert worden zu sein als unlustbetonte, bewegte Bilder kürzer als unbewegte.
* Subjektive Zeitdehnung durch starke Emotionen (z. B. Zeitlupeneffekt bei Schrecksekunden). Ex. von Elizabeth Loftus (*1944; s. a. u.): Die Zeitdauer der Projektion eines Filmes, der einen Banküberfall zeigt, wurde von den Probanden, die danach Zeugenaussagen machen sollten, bis zum 5fachen überschätzt.
* Im Alter scheint die Zeit rascher als in der Jugend zu vergehen. (Ex.: Vpn sollen sich melden, wenn sie glauben, 8 min seien verstrichen. Ergebnis: Greise melden sich nach 3 - 5 min, Jugendliche nach bis zu 10,5 min.) Erklärung: Ein Jahr ist für einen Zehnjährigen ein Zehntel, für einen Siebzigjährigen nur mehr ein Siebzigstel seiner bisherigen Lebenszeit. Andere Theorien: Die Zeitwahrnehmung hängt bewiesenermaßen mit der Körpertemperatur zusammen, und die sinkt mit dem Alter. / Älteren Menschen begegnen weniger neuartige Situationen als jüngeren, womit der erste Punkt zum Tragen kommt.
* Drogen, die auf das ZNS oder den Stoffwechsel wirken (v. a. Alkohol, Sedativa), beeinflussen das Zeitempfinden (da das ZNS die Zeitwahrnehmung steuert - s. o.).
* Kulturelle bzw. zivilisatorische Umfeldbedingungen scheinen das Zeiterleben zu beeinflussen. Spätestens seit dem Aufkommen des Internets glauben z. B. viele Menschen, einen inneren Zwang verspürend, immer rascher auf Einflüsse von außen reagieren zu müssen, wodurch sie sich unter Stress gesetzt fühlen. Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen, die Gefahr, „abgehängt“ zu werden, steigt. Der französische Medienphilosoph Paul Virilio (1932-2018) sprach schon 1977 vom drohenden „rasenden Stillstand“ in einer immer schneller werdenden Welt. Er untersuchte geschichtliche Epochen und politische Ereignisse unter dem Aspekt von Geschwindigkeitsverhältnissen. Die verhängnisvollste Folge der zunehmenden Beschleunigungstendenzen des 20. Jhdts. sei der dromologische Stillstand (griech. δρόμος = Rennbahn; Dromologie = Lehre von der Geschwindigkeit): Die akzelerierende Beschleunigung führe letztendlich zu ihrem Gegenteil, der Mensch blockiere sich selbst (z. B. im Stau aufgrund angestrebter größtmöglicher Mobilität). Virilios Erachtens nach vernichte die Geschwindigkeit den Raum und verdichte die Zeit.
Die Abstraktionsleistung der Gestalterkennung bewältigt der Ratiomorphe Apparat, eine der Vernunft vorgeschaltete Instanz, die eintreffende Reize in einem Algorithmus unbewusst verrechnet (aus heutiger Sicht wohl mit dem System 1 - s. o. - identifizierbar). Der Ausdruck stammt von Karl Bühlers (1879-1963) Assistent Egon Brunswik Edler von Korompa (1903-1955). Sie lässt uns das Konstante, Substantielle im Wandel des Akzidentellen erfassen, wenn wir z. B. bei der Gesichtserkennung oder in Karikaturen Charakteristisches sofort einer Person zuordnen, ohne uns subjektiv anstrengen oder lange nachdenken zu müssen. Das Entstehen einer Wahrnehmung aus komplexeren, ganzheitlichen „Vorgestalten“ und das Ausdifferenzieren von Wahrnehmungsinhalten nannte die Gestaltpsychologie (in Person von Friedrich Sander, 1889-1971, bzw. seiner Schüler) Aktualgenese.
- Gestaltbegriff:
Vgl.
Gestaltgesetze
oder auch Gestalttherapie s. u.
Die Gestaltpsychologie wurde 1890 vom österreichischen Psychologen Christian von Ehrenfels (1859-1932) begründet und von der „Berliner Schule“ (Kurt Tsadek Lewin, 1890-1947, Max Wertheimer, 1880-1943, Kurt Koffka, 1886-1941, und Wolfgang Köhler, 1887-1967) fortgeführt. Von Wertheimer stammt z. B. der Begriff Prägnanztendenz (Tendenz zur guten Gestalt, die uns z. B. vier in gleichem Abstand im Uhrzeigersinn angeordnete Punkte ergänzen und darin ein Quadrat erkennen lässt), von Köhler u. a. das Ex. zur Anmutungsqualität von Sprachlauten (s. o.).
Eine Gestalt (definiert als das, was im Wandel gleich bleibt, also das Substanzielle im Unterschied zum Akzidentellen)
* ist ein vom Hintergrund abgehobener Wahrnehmungsinhalt,
* dessen Einzelteile als zusammengehörig empfunden werden
* und der transponierbar ist (z. B. bleibt eine Melodie in einer
anderen Tonart, ein Kreis mit größerem Radius, eine Kathedrale in einer anderen Farbbestrahlung
dieselbe Melodie, dieselbe geometrische Figur, dieselbe Kathedrale).
* Eine Gestalt ist mehr als die Summe der Einzelteile
(Übersummativität; auch wenn man alle Einzeltöne einer Klaviersonate
von Wolfgang
Amadeus Mozart,
1756-1791,
auflistet, erfasst man noch lange nicht die Melodie). Diese letzte Eigenschaft
geht auf Aristoteles (Ἀριστοτέλης;
384-322 v. Chr.) zurück. (Vgl. Metaphysik 1041b 11-14: ἐπεὶ δὲ τὸ ἔκ
τινος σὑνθετον οὔτως ὥστε ἓν εἶναι τὸ πᾶν, ἀλλὰ μὴ ὡς σωρὸς ἀλλ' ὡς ἡ συλλαβή. ἡ
δὲ συλλαβὴ οὐκ ἔστι τὰ στοιχεῖα, οὐδὲ τὸ βα ταὐτὸ τῷ β καὶ α, οὐδ' ἡ σὰρξ πῦρ
καὶ γῆ. / Das aus Bestandteilen zusammengesetzte
Ganze ist nicht wie ein Haufen, sondern wie eine Silbe. Eine Silbe ist nicht die
Summe ihrer Laute: weder ist ba dasselbe wie b plus a, noch Fleisch dasselbe wie
Feuer plus Erde.)
- Kohärenzfaktoren der Gestalt:
Als Kohärenzfaktoren der Gestalt bezeichnet man seit 1923 Kriterien, nach denen Einzelteile
im Gehirn zu einer Gestalt zusammengefügt werden (nach Georg
Elias Nathaniel Müller, 1850-1934):
* Nähe
* Gleichheit, Ähnlichkeit
* Symmetrie
* Einfachheit, Prägnanz, „gute“ Gestalt (die auch dort erkannt wird, wo gar keine reale Entsprechung vorhanden ist: z. B. - bei fast allen Völkern - Sternbilder, Felsformationen)
* Geschlossenheit, Verbundenheit
* Kontur, Kontinuität, „gute“ Fortsetzung
* Gleichzeitigkeit, gemeinsames „Schicksal“, gemeinsame Region
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
|
| ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶● ●̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶●
|
Abb. 1/19: Beispiel für Kohärenzfaktoren: Geschlossenheit schlägt Nähe - oben sieht man die nahe beieinander stehenden Punkte („Augenpaare“) als zusammengehörig an, unten die verbundenen Punkte („Hanteln“). Nähe spielt keine Rolle mehr.
- Intuition:
Die angesprochene vorrationale
Erkenntnisleistung, bei der der präfrontale Kortex wenig Rolle spielt und die
Basalganglien zum Tragen kommen, erscheint oft (im Gegensatz zu detailliertem Wissen) als diffuse Ahnung,
als Intuition (s. a. o.). Darunter versteht Gerd
Gigerenzer (*1947) „gefühltes
Wissen, das rasch im Bewusstsein auftaucht, dessen tiefere Gründe uns nicht
bewusst sind, das aber stark genug ist, um danach zu handeln“. Es handle sich um
„einfache Heuristiken, die evoluierte Fähigkeiten benutzen“, Informationen zu
integrieren und unsere
Entscheidungen zu lenken imstande seien, und dabei nicht immer, aber oft durch die „Intelligenz des
Unbewussten“ erfolgreich und komplexen statistischen Verfahren überlegen seien
(vgl. Video-Statement zur
Entscheidungsfindung). Im Gegensatz zum „Unbewussten“ (s. o.)
wird in diesem Zusammenhang manchmal auch der Begriff „unterbewusst“ verwendet.
Evolutionär hat sich bei den Säugetieren jenes Areal, in dem das Unterbewusste
sitzt, zum Bulbus olfactorius (Riechkolben), einem vorgeschobenen
Gehirnteil, der nicht mehr nur für das Olfaktorische (s. o.)
zuständig ist, entwickelt. Es reagiert - biologisch sinnvoll - auf negative
Reize besonders stark (s. u.).
Gefährlich wird Intuition dann, wenn sie auch dort, wo rational nachgedacht werden müsste, ohne Reflexion wirksam wird und so notwendige Entscheidungen und Transformationen verhindert bzw. Situationen, in denen kontraintuitive Lösungsschritte nötig wären, nicht erkannt werden. (Beispiel: Ähnlich einem CRT - s. o. - soll im Ex. die Frage beantwortet werden, ob es wahrscheinlicher ist, dass Susi A) eine Bankangestellte oder B) eine in einer Bürgerrechtsbewegung aktive Bankangestellte sei, wenn vorausgesetzt werden darf, dass Susi eine politisch orientierte, feministische, interessierte und aktive Person aus einem liberalen Elternhaus ist. - Lösung: Da B) eine Teilmenge von A) ist, sollte die Frage nach logischem Nachdenken einfach zu beantworten sein.)
Nach Herbert Alexander Simon (1916-2001, Wirtschaftsnobelpreis 1978 für seine Forschungen zu Entscheidungsprozessen, einer der Mitbegründer der Disziplin der Künstlichen Intelligenz und der Verhaltensökonomik (Verhaltensökonomie, Behavioral Economics, die Ökonomie und Psychologie miteinander zu verbinden versucht, indem sie das wirtschaftliche Entscheidungsverhalten von Menschen in realen Situationen beschreibt, ohne ein Rationalitätsideal zugrundezulegen; s. a. u.) besteht Intuition in einer nicht bis ins Bewusstsein dringenden, automatischen Anwendung der Gedächtnisinhalte durch das Denk- und Entscheidungssystem 1 (vgl. a. u. bzw. o.). Die jeweilige Situation liefere einen Hinweisreiz (cue), der Gedächtnisinhalte aktiviere, die dann für eine Entscheidung herangezogen werden, deren Gründe man - wie z. B. auch bei der Gesichtserkennung - „weiß, ohne sie zu wissen“. Simon meint: „Intuition is nothing more and nothing less than recognition“. Sie beruhe auf „implizitem Wissen“, also auf solchem, an dessen Erwerb wir keine Erinnerung hätten (da es bereits bei der Geburt, evolutionär in uns „eingebaut“, vorhanden sei oder wir es in der frühen Kindheit erworben hätten).
WOVON HÄNGT AB, WAS UND WIE WIR WAHRNEHMEN?
Im Folgenden werden allgemeine Bestimmungsstücke der Wahrnehmung erwähnt, die bei allen Sinnesmodalitäten eine Rolle spielen (können). In diesem Zusammenhang zu beachten sind auch grundlegende philosophische Überlegungen zum Verhältnis von Realität und virtueller Realität bzw. die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, zu unterscheiden, ob wir uns in dieser oder in jener Welt befinden. (Der australische Bewusstseinsforscher David J. Chalmers - s. o. - vertritt 2022 in seinem Buch Realität+ - Virtuelle Welten und die Probleme der Philosophie die Auffassung, dass wir nicht wissen können, ob wir uns in einer virtuellen Welt bzw. Realitätssimulation befinden, dass virtuelle Welten jedoch ebenfalls real seien und dass es möglich sei, in ihnen ein gutes Leben zu führen.
- Angeborene oder erworbene Voraussetzungen:
Insgesamt müssen wir uns immer der Tatsache bewusst sein, dass wir nicht die
Realität wahrnehmen, sondern ihre Interpretation durch unser Gehirn, dessen (Vor)arbeit
uns meist nicht bewusst wird. „Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind; wir
sehen sie so, wie wir sind“ (Anaïs
Nin, 1903-1977). Die Situation wurde in Fortführung von Bruner
(s. u.) vom britischen
Neurowissenschaftler Anil Kumar
Seth (*1972),
der Gehirne für biologische Vorhersagemaschinen (predective processing)
und Bewusstsein für eine exklusive Eigenschaft lebender Systeme hält, „kontrollierte
Halluzination“ genannt, da wir permanent die Hypothesen unseres Gehirns mit den
eintreffenden Reizen, die wir für die Wirklichkeit halten, abgleichen und somit
unser Weltbild immer wieder unbewusst korrigieren. Ein komplexes
Bewusstseinsmodell müsse wie ein spinnennetzartiges Koordinatensystem
dargestellt werden, in dem jede Dimension für eine andere
Bewusstseinseigenschaft stehe (und nicht linear wie auf einer Geraden höhere und
tiefere Bewusstseinszustände annehmen). Berücksichtigungswürdige Aspekte seien
das Selbst (Kernmerkmal von Bewusstsein ist ja, dass es sich auf ein Subjekt
bezieht), die Bewusstseinsinhalte und die verschiedenen Grade des Bewusstseins. (zu
neueren Bewusstseinstheorien
s. a. o.).
Folgende mit der biologischen Ausstattung assoziierte bzw. durch soziale
Einflüsse überformte Faktoren spielen bei jeder Wahrnehmung eine Rolle:
* Angeborene Anschauungsformen: Wir können epistemologisch nur so „funktionieren“, wie unser Gehirn bzw. seine indisponiblen Denkkategorien dies zulassen. (Die Bezeichnung „Angeborene Anschauungsformen“ geht auf Immanuel Kant zurück; sie bewirken z. B., dass wir die Welt nur räumlich-zeitlich erfassen können (so, als ob es diese Kategorien in der uns vorgestellten Form tatsächlich gäbe), obwohl die theoretische Physik inzwischen nachgewiesen hat, dass die objektive Realität völlig anders „aussehen“ muss, als unsere subjektiven Eindrücke dies nahelegen.)
* Intaktheit bzw. Vorhandensein der Sinnesorgane: Sie sind z. B. für den Raum, die Welt der Geräusche etc. vorhanden, für Magnetismus nicht, und z. T. trainierbar. Insgesamt lassen uns unsere Rezeptoren nur einen winzigen Bruchteil der Welt verarbeiten (und auch der ist anders, als wir annehmen). Zusätzlich können pathologische Phänomene die Wahrnehmung beeinträchtigen. Die Unfähigkeit, Gewichte zu schätzen (Abarognosie), geht z. B. auf Kleinhirnerkrankungen zurück. (Tiere haben z. T. angeborene Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung, die jenseits der menschlichen Bandbreite liegen: z. B. sehen Schlangen Infrarot, Haie erkennen elektrische Felder, Vögel orientieren sich am Erdmagnetismus.)
* Psychische Voraussetzungen: Vgl. etwa Trugwahrnehmungen, s. u., oder die „Wahrnehmungen“ im Traum, die uns darauf hinweisen, dass unsere Realität womöglich nicht absolut ist.
* Bereitschaft wahrzunehmen: Sie entsteht durch komplexe Interferenzen individueller Voraussetzungen mit Sozialisations- und Erziehungsprozessen. Das Ergebnis lässt sich innerhalb der Bandbreite von Neugier, Interesse vs. Apperzeptionsverweigerung verorten. (Der Ausdruck für die Neigung, die Wahrnehmung auszuschalten und / oder sich etwas vorzumachen wurde vom Schriftsteller Franz Carl Heimito Ritter von Doderer, 1896-1966, der Wut für ihre fatalste Form hielt, verwendet.)
* Hyperästhesie oder Hyp(o)ästhesie: Darunter wird Über- bzw. Unempfindlichkeit gegenüber Reizen, die überhäufig / seltener oder sehr intensiv / weniger intensiv erlebt werden, verstanden. Das Vorhandensein einer solchen Besonderheit verstärkt oder schwächt die Wahrnehmung ihrer Merkmalsträger/innen.
* „Filter“: Eine entscheidende Abhängigkeit ist die davon, was unser Gehirn (bzw. der Thalamus als „Torwächter des Bewusstseins“) über die Bewusstseinsschwelle lässt. Nur Neues und / oder Wichtiges, das eine Mindestreizstärke mitbringt, kann bewusst verarbeitet werden. Nach dem zum ersten Mal 1958 von Donald Broadbent (1926-1993) dargelegten (der Informationsfluss vom sensorischen Input zum Bewusstsein werde von der Aufmerksamkeit - s. u. - streng reguliert) und später von Frederic Vester (1925-2003) ausgearbeiteten Flaschenhalsmodell erfüllen nur ganz wenige der eingehenden Reize diese Kriterien. (Theorie: Bei so genannten Savants, die - oft autistisch, 6 von 7 sind männlich - als Rechenkünstler, Detailzeichner mit photographischem Gedächtnis - s. a. u. - etc. Spezialbegabungen / Inselbegabungen aufweisen, funktionieren diese Filter nicht; alles wird durchgelassen, der „Zensor“, der Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet, ist abgeschaltet, was manchmal mit einem selbstständigen Leben unvereinbar ist.)
- Einstellung und
Aufmerksamkeit:
* Wichtige Ereignisse, die unsere
Aufmerksamkeit (laut William James,
1842-1910, „die Inbesitznahme [...] eines von offenbar mehreren gleichzeitig
möglichen Objekten oder Gedankengängen [...] durch den Geist“) völlig in
Beschlag nehmen, verhindern, dass Unwichtigeres wahrgenommen werden kann. (Dieses
Phänomen wird von Illusionisten ausgenützt, indem sie den Fokus des Publikums
durch übertrieben deutliche Gesten von unscheinbaren, aber entscheidenden
Bewegungen ablenken, und ist im Alltag allerorten beobachtbar: z. B.
wird ein stolperndes Kind an der Peripherie des Gesichtsfeldes, das man bei
entspanntem Autofahren vielleicht registriert hätte, gar nicht bemerkt, wenn die Aufmerksamkeit
gerade von einem Unfall vor der Windschutzscheibe in Beschlag genommen wird.) Die Wahrnehmungsselektion
erfolgt unbewusst durch das Gehirn nach den Kriterien „bekannt / unbekannt“ bzw.
„wichtig / unwichtig“. Nur neue und wichtige perzeptive (wahrgenommene), kognitive
(gedachte) und emotionale (gefühlte) Geschehnisse werden im Langzeitgedächtnis
weiterverarbeitet.
Die angesprochenen Mechanismen werden von den (sozialen) Medien und der politischen und kommerziellen Werbung ausgenützt, denen es in hohem Ausmaß nur noch darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen (und damit Clicks zu generieren, Auflagen zu erhöhen, Wählerstimmen zu lukrieren, Verkaufszahlen zu erhöhen etc.), indem sie Wichtigkeit und Neuigkeit simulieren. Dies funktioniert bei vielen Menschen unabhängig von Faktentreue, Sinnhaftigkeit oder auch nur einem gewissen intellektuellen Niveau selbst mit absurden Inhalten oder abwegigen Aussagen. (Nach 2020 wurde mit dem „Kauf“ von Aufmerksamkeit weltweit erstmals mehr Geld verdient als mit Erdölprodukten.)
* (Cocktail)party-Effekt: Dieser Ausdruck wurde 1953 von Edward Colin Cherry (1914-1979) geprägt. Ex.: Ein willkürliches Lenken der Aufmerksamkeit auf eine von mehreren rundum an Stehtischen plaudernden Gesprächsgruppen und ein Umschalten in eine andere ist Zuhörenden möglich, ohne den Standort zu verändern (= selektive Aufmerksamkeit; s. a. o.). Diese Fähigkeit, die Zuhören und Ignorieren gleichzeitig erfordert, nimmt mit dem Alter ab und ist davon abhängig, dass man nahe genug steht und beide Ohren funktionieren. (Selektive Wahrnehmungen spezifischer Art, z. B. die Beobachtung springender Punkte auf einem Bildschirm bei gleichzeitiger Ignorierung aller unbewegten Punkte, lassen sich durch fMRT-Scans als kortikale Aktivierung der entsprechenden Region nachweisen.)
* (Vor)einstellungen und Erwartungen lassen die Wahrnehmung ungenau werden. Diese Verzerrungen (s. o.) bleiben meist unbewusst und wirken sehr stark. Ex.: Das ukrainische Ushgorod erscheint den meisten Wienern viel weiter als Bregenz entfernt, da ihnen die (in Wahrheit ca. 60 km Luftlinie fernere) österreichische Stadt innerlich näher liegt. Die Thesen des Directive State Concept von Gordon Allport (1897-1967) - Bedürfnisse, Werte, Wünsche, Motive etc. beeinflussen unsere Wahrnehmung - wurde zum Konzept von der hypothesengeleiteten Wahrnehmung von Jérôme Seymour Bruner (1915-2016) weiterentwickelt: objektive Informationen werden verzerrend an die eigenen Hypothesen über die Realität unbewusst angeglichen; alle Wahrnehmungen werden unter dem Einfluss von Erwartungen und damit unbewusster Hypothesenbildung gesehen. Diese und ähnliche Phänomene, bei denen als Hinweise sozial relevante Informationen zur Urteilsbildung, vor allem über Personen, herangezogen werden, nennt man social perception / soziale Wahrnehmung. (Die Erstveröffentlichung dieser Theorie erfolgte 1951 im Buch An approach to social perception von J. S. Bruner und Leo Joseph Postman, 1918-2004). Vgl. auch folgendes Ex.: Eine wertvolle Münze und mehrere Pappscheiben mit verschiedenen Durchmessern werden hintereinander blind abgetastet. Soll die in Bezug auf die Münze gleichgroße Pappscheibe bestimmt werden, wird meist auf eine zu große getippt. Erklärung: Münzen sind wertvoller als Pappe und werden daher in ihrer Größe überschätzt; eine Information verzerrt also unbewusst die Wahrnehmung. (Ein erstes Ex. dieser Art wurde bereits 1947 von J. S. Bruner und Cecile C. Goodman, 1926?-????, an Kindern durchgeführt - s. hier -, als Beispiel für tachistoskopische Ex.e von Bruner und Postman s. Video hier. Die wechselseitige Abhängigkeit von realer Umwelt und dem Erleben wird von der Psychophysik, s. o., untersucht.)
* Priming-Effekt: Die Tatsache, dass die Verarbeitung eines Reizes durch vorangegangene Reize beeinflusst wird, nennt man Priming-Effekt (s. u.). Dieser kann bewusst ausgenutzt werden.
- Bezugsrahmen:
* Bezugsrahmen: Vom Bezugsrahmen hängt ab, ob etwas groß / klein, warm / kalt, bewegt / unbewegt etc. erscheint. Fällt er weg oder ändert er sich, ist eine geordnete Wahrnehmung nicht
mehr möglich (Beispiel dazu s. z. B. o.)
oder derselbe Wahrnehmungsinhalt erscheint plötzlich anders. Vgl. „Context“
oder folgende Darstellung:
|
Abb. 1/20: Der objektiv identische Farbton der Buchstaben erscheint (bei Vergrößerung noch deutlicher) je nach Hintergrundfarbe unterschiedlich. |
ABC |
ABC |
* Wir nehmen nur wahr, was sich verändert (z. B. NICHT den Druck der Kleidung auf der Haut, das Mühlrad, das immer klappert, den Eigengeruch etc; vgl. auch Fixationsblindheit s. o. etc.) An gleichbleibende Reize gewöhnt sich der Wahrnehmungsapparat, er „stumpft“ ab. Diese Habituation ist eine einfache Art des (nicht-assoziativen) Lernens. (Dies trifft auch auf das Gegenteil, die Sensitivierung, zu, bei der die Darbietung eines Reizes zu erhöhter Reaktionsbereitschaft führt.)
- Ausdruck und Eindruck:
* Ausdruck: Jeder Mensch erlebt Reize - abhängig von seiner
Vorgeschichte und seiner „Ausstattung“ - in einer individuellen Art und Weise (s. a. o.).
„Ausdruck ist dasjenige an einer Wahrnehmung, was unter Mitwirkung des Denkens
in uns eine gefühlsmäßige, emotionelle Reaktion auslöst.“ (Rohracher)
Ausdruck wird daher vom Reizempfänger definiert. (Von Werner Herkner, *1941,
wurden z. B. die Ausdruckswirkungen klassischer Instrumente eines
Symphonieorchesters untersucht und dabei in Sonagrammen das unterschiedliche
Spektrum an Obertönen berücksichtigt. Die Charakteristik eines Schallereignisses
wird auch von konstanten Oberschwingungen, den Formanten, geprägt. All
dies bestimmt zusammen mit Ansatz-, Einschwinggeräuschen und feinmodulatorischen
Veränderungen die Klangfarbe. Wissenschaftliche Ansätze wie diesen nennt man
experimentelle Ästhetik.)
* Eindruck: Unter Eindruck versteht man die von Rohracher angesprochene Reaktion. Laut ihm machen Menschen Eindruck (via Ausdruckserscheinungen) durch ihre Physiognomie, ihre Mimik, ihre Gestik und Motorik, ihre Stimme und Sprechweise und ihre Schrift. (Die Graphologie wurde 1875 vom französische Priester Jean-Hippolyte Michon, 1806-1881, begründet, konnte aber die wissenschaftlichen Gütekriterien - s. o. - nie wirklich erfüllen.) Hinzuzufügen wären ev. der ausgesendete Geruch, die Auswahl der Kleidung und die verwendeten Sprachformen bzw. -ebenen. Um den Eindruck fassbar zu machen, werden Polaritätsprofile (s. o.) verwendet.
Den durch menschliche Eindrücke entwickelten Algorithmen weit überlegen zeigt sich die Künstliche Intelligenz (s. u.): Der Verhaltensökonom Sendhil Mullainathan / செந்தில் முல்லைநாதன் (*1973) ließ in einem Ex. eine halbe Million reale Fälle durch den Computer laufen, in denen aufgrund zur Verfügung stehender Daten entschieden worden war, ob Strafgefangene vorzeitig entlassen werden können. Die Vorschläge der KI wurden mit den Ergebnissen der tatsächlich tätig gewesenen Richter verglichen. Ergebnis: Die Rückfallsquote der von den Richtern begnadigten Delinquent/innen war um 25% höher als die, die entstanden wäre, hätte die KI entschieden. Dies zeigt einmal mehr (s. a. o.), dass es sicherer ist, sich auf Datenevidenz zu verlassen als auf menschliche Eindrücke. (Selbst das blinde Befolgen ganz einfacher Regeln erzielt oft eine höhere Genauigkeit als die Urteilskraft der Menschen.)
Eine besondere Rolle scheint der erste Eindruck zu spielen, der allerdings entgegen der allgemeinen Annahme auch täuschen kann, wenn das Gegenüber manipulatorische Kraft entwickelt. (Zum Beispiel führte die Tatsache, dass Arthur Neville Chamberlain, 1869-1940, Adolf Hitler, 1886-1945, nach einem ersten Treffen 1938 viel zu positiv einschätzte, zur verhängnisvollen Appeasement-Politik.) Ähnlich fehlerhaft bestimmt der letzte Eindruck die Bewertung eines Ereignisses nachhaltiger als die währenddessen erlebte Erfahrung. (Diese Erkenntnis geht auf Exe. von Kahneman zurück, der Menschen nach einer Darmspiegelung ohne Narkose befragt hat. Wer längere Zeit stärkere Schmerzen als andere verspürt hat, äußerte sich trotzdem insgesamt zufriedener, wenn das Ende der Untersuchung als eher angenehm empfunden wurde. Vgl. a. o. Peak-End-Regel)
|
|
Copyright © 1999-2026 Thomas Knob. All rights reserved. - Die Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten wird keine Verantwortung übernommen.