|
|
Vorbemerkung:
Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.
Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.
|
KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 2. TEIL (mit LINKS ins Internet)
|
Volltextsuche in allen 5 Teilen: |
|
|
Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,
ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at
|
|
INHALT DES 2. TEILS:
III. ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE (Allgemeines - Phasen der psychischen
Entwicklung - Entwicklungsstörungen - Geistige Behinderung)
⇘
IV. PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE (Definitionen - Einige historische Auffassungen
von Pädagogik -
Bildungsinhalte - Bildungseinrichtungen - Erziehungsstile und Erziehungsfehler -
Erziehungsziele)
⇘
Im Folgenden werden grundlegende Fragen und allgemeine Begriffe, die in diesem Abschnitt verwendet werden, definiert. - Vgl. a. (Entwicklungs)psychologie-Informationen
- Forschungsgebiet:
Die Entwicklungspsychologie befasst sich mit der Beschreibung und Erklärung
der Veränderungen des Erlebens und Verhaltens eines Menschen im Laufe seiner
Lebenszeit. Sie untersucht die Rolle der seelischen Vorgänge und Zustände bei
der Entwicklung des Bewusstseins im Laufe der Jahr(zehnt)e von der Geburt (tw.
sogar den Monaten davor) bis zum Tod.
- Entwicklung:
Entwicklung ist die Entfaltung eines zweckhaften Ganzen in Auseinandersetzung mit
anderen zweckhaften Ganzen. Es handelt sich um einen irreversiblen
Differenzierungsprozess, an dessen Ende Mündigkeit (Selbständigkeit,
Lebensausstattung, Identität) steht (stehen soll). Der Begriff insinuiert das
Sichtbarwerden von etwas bereits Vorhandenem. Dies - und vor allem die
Zielgerichtetheit - ist schon im antiken (von Aristoteles
- s. u. - eingeführten) Entelechie-Begriff
enthalten (ἐντελέχεια besagt, dass etwas sein Ziel in sich selbst habe).
- Programmierung:
Die zu entwickelnden Programme des Menschen sind z. T.
offene Programme.
Das bedeutet, dass der „Inhalt“, mit dem sie gefüllt werden, unterschiedlich
sein kann. Die
Fähigkeit zur Sprache ist z. B. angeboren und nach entsprechender Reifung abrufbar, ob
sich diese Anlage nun anhand von Englisch, Chinesisch oder der Gebärdensprache etc.
realisiert, aber nicht. (Insgesamt stehen zur Zeit ca. 8000 in 200 bis 300
Sprachfamilien einteilbare Möglichkeiten zur Verfügung - s. hier
-, die auf insgesamt nicht mehr als etwa 70 - im Deutschen werden ca. 40
realisiert - verschiedenen Lauten basieren, die man - oft mehr schlecht als
recht - durch Buchstaben wiederzugeben versucht: das Wort „klingen“ enthält
z. B. weder ein N noch ein G noch ein E, zusätzlich ist das L ist ein anderes L
als in „Laut“. Wie
das Max-Planck-Institut
für Kognitions- und Neurowissenschaften - MPI CBS; benannt nach dem
deutschen Physiker Max-Planck,
1858-1947 - herausfand, hinterlassen
unterschiedliche Muttersprachen unterschiedliche Konnektome im Gehirn; s.
hier).
- Prägung:
Unter Prägung versteht man eine
irreversible Fixierung eines Triebes auf ein Objekt. (Ein Beispiel ist die
Nachlaufprägung bei Gänsevögeln, die durch das erste in ihrem Leben wahrgenommene bewegte Objekt
- experimentell auch durch eine
Spielzeugeisenbahn, normalerweise aber durch die Gänsemutter oder andere frisch
geschlüpfte Jungvögel - ausgelöst wird;
s. a. u. Beim Menschen könnte man von einer Prägung auf Bezugspersonen, auf die Landschaft
der Umgebung, in der er aufwächst, etc. reden. Diese Wahrnehmungsobjekte werden
immer - positiv oder negativ - eine andere mentale Reaktion auslösen als
andere.)
- Reifung:
Reifung erfolgt von selbst (autonom) und schafft die Voraussetzungen für das Lernen (z. B.
Kortexreifung als Voraussetzung für das Schachspiel, Reifung des Stützapparates
als Voraussetzung für einen Purzelbaum etc.). Sie ist genetisch programmiert.
- Lernen:
Lernen (ein im Grunde durch Umwelt- oder Erfahrungseinwirkung
provozierter Vorgang, der sich in einer Änderung des Denkens und Verhaltens zeigt; s. a. u.) wird
durch bewusste, gezielte Maßnahmen (Intentionale Erziehung) in Gang
gesetzt, erfolgt aber auch durch direkten Umweltkontakt oder
immanente Einwirkungen (Funktionale Erziehung, Sozialisation; s. a. u.). Jérôme
Seymour Bruner
(1915-2016), ein Vertreter der sogenannten kognitiven Wende, erforschte das
entdeckende Lernen (= Zur-Verfügung-Stellen von Lernanregungen, um die
Eigenaktivität des Lernenden zu fördern und ihn spiralartig von ersten
Prinzipien auf höhere Ebenen zu führen). In sogenannten sensiblen
(kritischen) Perioden (Empfänglichkeitsphasen; Begriffe von Maria Montessori,
s. a. u.; auch tuning
periods genannt)
erfolgt das Lernen leichter als danach. Werden sie verpasst (was zumindest für
die elementarsten Lernprozesse in der Praxis
nicht leicht möglich ist), hat das lebenslange Folgen. (Das Versäumte kann nicht
mehr nachgeholt werden.)
Für die Sprache hat dies zum ersten Mal der Chefarzt der ersten Taubstummenanstalt in Paris, Jean Itard (1774-1838), anhand des „Wolfskindes“ Victor von Aveyron (ca. 1788-1828), der nach vermutlich 6-8jährigem Aufenthalt im Wald ca. 12jährig einem französischen Dorf zugelaufen war und nie mehr sprechen lernte, beschrieben. (Itard hatte als Einziger - gegen seinen Lehrer Philippe Pinel; s. u. - angenommen, dass Victors „Idiotie“ keine biologischen, sondern kulturelle Ursachen habe.) Das entscheidende Zeitfenster für das Bilden sprachlicher Kategorien ist von der Geburt bis längstens zum dritten Lebensjahr offen. In dieser Periode benötigt die primäre Hörrinde im Gehirn als Voraussetzung für diese Fähigkeit die entsprechenden (meist akustischen) Reize.
Die Einwirkung anderer ist deshalb notwendig, da es (gemäß der afrikanischen Weisheiten „Ein Mensch wird Mensch durch andere Menschen“ - einer Maxime der Ubuntu-Philosophie - bzw. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“) im Wesen des Menschen liegt, von allein weder ein Selbst bilden noch überhaupt überleben zu können. Vgl. die Kaspar-Hauser-Exe. (= solche, die auf Deprivation beruhen): Der Staufer Friedrich II (= Federico II di Svevia, 1194-1250; ab 1220 Kaiser des römisch-deutschen Reichs) ließ Kinder isoliert aufwachsen, um herauszufinden, welche Sprache sie ohne Einfluss sprechen würden - ob Hebräisch, Griechisch oder Latein die Ursprache sei (nach heutigen Maßstäben unmenschlich, nach damaligen aber womöglich in seiner „Wissenschaftlichkeit“ fortschrittlich). Die Folge war der Tod der Kinder durch mangelnden Sozialkontakt. (Der „historische“ Kaspar Hauser lebte ca. 1812-1833, er wurde ermordet.) Vgl. auch die berühmte Textstelle Πολιτικά / Politik 1253a von Aristoteles (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.), nach der der Staat ein Werk der Natur und der Mensch von Natur aus ein geselliges Wesen sei. („Ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον.“ S. a. u.)
- Phase:
Phasen sind Zeitabschnitte (mit z. T. recht willkürlichen Grenzen), denen ein
Ordnungsprinzip zugrunde liegt (ähnlich z. B. den Literaturepochen),
das die jeweils anstehenden Entwicklungsaufgaben definiert, deren
Verfehlung zu Problemen führt. (Developmental tasks wurden vom Amerikaner Robert
J. Havinghurst, 1900-1991, als je
nach Lebensphase - bei Havinghurst
Säuglingsalter und frühe Kindheit bis 6, mittlere Kindheit bis 13, Adoleszenz
bis 18, frühes Erwachsenenalter bis 30, mittleres Erwachsenenalter bis 60,
spätes Erwachsenenalter ab 60 Jahre - auf Grundlage physischer Reife,
individueller Zielsetzungen und gesellschaftlicher Erwartungen zu bewältigende,
konkrete Anforderungen beschrieben.)
Die Angaben der Abschnittsgrenzen erfolgen mit Semikolon (1. Zahl = Jahr, 2. Zahl = Monat). Wie allen Einteilungen liegt auch der hier verwendeten eine gewisse Willkür zugrunde; sie könnte mit demselben Recht genauso gut auch anders aussehen (und sieht in Werken zur Entwicklungspsychologie auch oft anders aus). Zu beachten ist auch der Unterschied zwischen objektiven Gegebenheiten (Alter) und subjektivem Empfinden. („Man ist immer so alt, wie man sich fühlt.“) Robert Kastenbaum (1932-2013) erforschte diese Diskrepanz und stellte fest, dass sie mit zunehmendem Alter ansteigt und sehr breit werden kann. Das durch molekulargenetische Veränderungen determinierte biologische Alter eines Menschen lässt sich mit der 2013 vom deutsch-amerikanischen Bioinformatiker und Gerontologen Stephan / Steve Horvath (*1967) entwickelten epigenetischen Uhr (s. hier und Selbsttest) unter Verwendung einer Analyse von DNA-Methylierungsstellen auf wenige Jahre genau bestimmen. (Für die Eruierung des kalendarischen Alters genügt nach wie vor die Geburtsurkunde.)
- Die vier Grundfragen der
Entwicklungspsychologie:
Nach Heinz Heckhausen
(1926-1988) können folgende jeweils zwischen zwei Gegenpositionen
hin und her pendelnde Grundfragen formuliert werden:
* Ist das Kind ein kleiner Erwachsener, oder ist der Erwachsene ein groß gewordenes Kind?
* Ist das Kind ein aktiver Erkunder oder ein passiver Empfänger?
* Ist das Kind ein Bündel von Elementarprozessen oder ein integriertes Gesamtsystem?
* Sind die Ergebnisse der kindlichen Entwicklung stärker von Erbfaktoren oder von Umwelteinflüssen bestimmt?
Es ist offensichtlich, dass jeweils eine Position die im Vergleich zur anderen modernere Auffassung abbildet, wiewohl jeweils beide Aspekte berücksichtigenswerte Implikationen enthalten. Vor allem im letzten Punkt scheint das Pendel immer wieder hin- und herzuschwingen bzw. - wie schon Heckhausen formulierte - die Frage als falsch gestellt betrachtet zu werden. (Dazu s. a. u.)
PHASEN DER PSYCHISCHEN ENTWICKLUNG
Grundlegende Voraussetzung für psychische Entwicklung ist ein höher entwickelter lebender Organismus. Als wichtiges Merkmal des Lebens wird meist (neben dem zellulären Aufbau, dem Stoffwechsel, der Stimulationsfähigkeit u. a.) die Fähigkeit zur Autopoiesis (der Begriff wurde von den chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana, 1928-2021, und Francisco Javier Varela García, 1946-2001, geprägt), also die dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz) entgegenstehende Möglichkeit zur Hervorbringung bzw. Erneuerung der eigenen erhaltenden Systeme wie der Zellerneuerung. Lebende Systeme sind rekursiv und selbst das Produkt ihrer Organisation. Im Gegensatz dazu können z. B. Viren oder noch so menschenähnliche Input-/Output-Maschinen wie Computer nicht aus eigenem schadhafte Elemente ihrer selbst wiederherstellen. (Der Begriff „Autopoiesis“ wurde später vom Soziologen Niklas Luhmann, 1927-1998, auf soziale Systeme übertragen.)
Die hier verwendete Phaseneinteilung der psychischen Entwicklung des Menschen folgt in den ersten Abschnitten Marian Heitger (1927-2012), Erziehen, Lehren, Lernen. ORF-Lehrgang 1970. (Zur Freud'schen Phaseneinteilung s. u.; die Phasen der Sprachentwicklung, des kindlichen Spiels, der Entwicklung von Zeichnungen, des Abschieds vom Leben und diejenigen von Kohlberg und Erikson sind in dieses Kapitel eingearbeitet.)
- 0;0 bis 0;6: Säuglingsalter:
* Ordnungsprinzip der ersten Phase: Kennenlernen
des eigenen Körpers und seiner Zustände
Ich ⟺ Körper |
Abb. 2/1: Ordnungsprinzip 1. Phase
* Genetische Voraussetzungen: Der Ausdruck „Genetik“ (genauso wie „Gameten“, „Zygote“, „hetero-“/„homozygot“ und „Allele“) wurde 1905/6 vom britischen Biologen William Bateson (dem Vater von Gregory Bateson; s. u.) im Zuge seines Bestrebens, die 1866 veröffentlichten, aber weithin ignorierten Erkenntnisse von Gregor Mendel (1822-1884) anzuerkennen, geprägt. Zusammen mit den Umwelteinflüssen bestimmen die zur Zeit noch kaum veränderbaren nicht einmal 20 000 Gene (Karyotyp 44+XX oder 44+XY; s. a. u.) durch die Anordnung ihrer ca. 3 Mia. Basenpaare (die Nukleotide, die in der DNA die beiden Stränge der Doppelhelix, die sich um die eigene Achse dreht, bilden, sind über Basen, die wie Puzzleteile zusammenpassen - Adenin mit Thymin und Guanin mit Cytosin - miteinander verbunden) die Entwicklung und das Verhalten des Menschen. Die DNA enthält jene Informationen, die es ermöglichen, RNA und damit die aus den 20 Aminosäuren aufgebauten Proteine (Eiweiße; man schätzt ihre Anzahl auf unvorstellbare 10300; sie werden - s. u. -mit den Mitteln der KI analysiert) als chemische Bausteine des Lebens herzustellen, die dann spezielle Aufgaben zu bewältigen imstande sind. (Die Umwandlung der Erbinformation in Proteine nennt man Genexpression. Aminosäuren sind riesenmolekülartige Carbonsäuren, bei denen ein alphaständiges Wasserstoffatom durch eine Aminogruppe NH2 ersetzt ist: Alanin, Arginin, Asparagin, Asparaginsäure, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin und Valin.) DNA-Untersuchungen bewirkten, dass biologische Konzeptionen von „Menschenrassen“ nicht mehr gerechtfertigt werden können, da nur Gradienten, aber keine klar abgegrenzten Gruppen festgestellt werden können. Europäer sind z. B. bis heute mit den Ostafrikanern genetisch enger verwandt als diese mit den Westafrikanern. (Vgl. dazu Jenaer Erklärung von 2019)
Homo sapiens ist vor ca. 30 000 bis 40 000 Jahren als einzige von damals mindestens vier weiteren existierenden Menschenarten, deren Erbanlagen wir teilweise immer noch in uns tragen, übrig geblieben. Menschen gab es nach Erkenntnissen des frühen 21. Jhdts. schon vor ca. 2,6 Mio Jahren, der Homo sapiens ist durch die 2017 erfolgten Entdeckungen des Teams von Jean-Jacques Hublin (*1953 in Algerien; Balzan-Preis - nach Eugenio Balzan, 1874-1953, - 2023) am Jebel Irhoud / جبل إيغود, in Marokko seit 300 000 Jahren fossil belegt. (Erste primatenartige, tw. aufrecht gehende Hominini - Toumaï - gab es schon vor 7 Mio. Jahren, den zweibeinigen Affen Australopithecus vor 4 Mio. Jahren.)
Homo sapiens (Bezeichnung von Carl von Linné, 1707-1778) hat sich vermutlich bald nach dem vor ca. 50 000 Jahren erfolgten Afrika-Exodus in Westasien im Bereich des heutigen Nahen Ostens zum ersten Mal mit den dort ansässigen Neandertalern, die sich in Europa aus dem Homo erectus entwickelt hatten, ihre Toten bestatteten und sprachen, gepaart (nach Forschungen des Genetikers Johannes Krause, *1980, ungefähr vor 49 000 bis 45 000 Jahren) und ist dann nach Europa vorgedrungen (wie 47 500 Jahre alte Höhlenfunde von Hublin in Thüringen nachwiesen). Ein Echo aus dieser Vorzeit bilden die 2 bis 3% Neandertalergene (nach dem Fundort Neandertal an der Düssel bei Mettmann in Deutschland), die fast alle Menschen außerhalb Afrikas aufweisen. Teile der Neandertaler-DNA wurden erstmals 1997 vom schwedischen Begründer der Paläogenetik und Medizin-Nobelpreisträger 2022 Svante Pääbo (*1955; Sohn des Medizin-Nobelpreisträgers von 1982 Sune Bergström - 1916-2004 - der den Einfluss von Prostaglandinen auf vitale Prozesse erforscht hatte) entschlüsselt.
Bis vor ca. 6000 bis 7000 Jahren hatten alle „Europäer“ eine dunkle (Vitamin B-produktionsfeindliche) Hautfarbe, möglicherweise sogar noch der berühmte „Eismann Ötzi“, der ca. 3200 v. Chr. gelebt hat. (Die Mutation der hellen Haut setzte sich in nördlicheren Gegenden Eurasiens in wenigen 1000 Jahren erst durch die Umstellung der ehemals vitamin-D-reicheren fisch- und fleischhaltigen Ernährung nach der neolithischen Revolution in Verbindung mit Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht durch, sodass nun auch in sonnenarmen Gegenden das Vitamin D leichter über die Haut produziert werden konnte.)
In West-
und Südostasien ist der prozentuelle Anteil des Erbguts des Denisova-Menschen,
einer (s. hier) erst
2010 von Bence Viola
(*1977) u. a. entdeckten und von Svante
Pääbo genetisch identifizierten
Neandertalerabspaltung (s. hier), noch höher. Afrikaner tragen genetisches Material einer
noch unbekannten Menschenart (ohne Fossilfunde; „Geisterpopulation“), die durch
Genanalysen indirekt erschlossen werden konnte. Die fünfte bekannte Menschenart
zur Zeit der Herausbildung des Homo sapiens, Homo floresiensis (der
kleinwüchsige „Hobbit-Mensch“), blieb aufgrund ihrer Insellage vermutlich ohne
genetische Auswirkungen auf den heutigen Menschen.
Vgl.
folgendes Video und den
Festvortrag vor der
ÖAW 2018, eingeleitet vom damaligen dortigen Präsidenten, dem späteren Physik-Nobelpreisträger 2022 Anton
Zeilinger, *1945, und s. a.
hier.
* Anthropologische Voraussetzungen: Der Mensch ist laut Arnold Gehlen (1904-1976) „von Natur aus ein Kulturwesen“, das „Weltoffenheit“ aufweist. (Es ist nicht zur Einpassung in ein bestimmtes Milieu gezwungen, ist erfahrungsbereit auch für Wahrnehmungen ohne Signalcharakter und in seiner Freiheit nicht durch einschränkende Instinkte eingeengt.) Der Mensch ist vom Anthropologen Adolf Portmann (1897-1982) als „physiologische Frühgeburt“ bezeichnet worden, die eine verkürzte Embryonalentwicklung aufweist, die dem für einen späteren Geburtstermin zu großen Kopfumfang (im Verhältnis zum sehr engen Geburtskanal) geschuldet ist. Deshalb sind die Fontanellen zwischen den Schädelplatten zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht geschlossen, die Gehirnentwicklung (v. a. die Myelinisierung; s. o.) ist noch nicht abgeschlossen, selbstständiges Bewegen unmöglich und längere Hilflosigkeit als bei vielen anderen Tieren die Folge. (Wie der Leipziger Psychiatrieprofessor Paul Flechsig, 1847-1929, bereits 1874 nachwies, beruht die spätere Größenzunahme des Gehirns aber nicht auf der Vervielfältigung der Neuronen, sondern auf deren zunehmender Faserdicke durch Myelinisierung.) Bereits Johann Gottfried Herder (1744-1803) sprach aufgrund der Instinktreduktion des Menschen von einem „Mängelwesen“ (das z. B. nach seiner Geburt über keine biologischen Waffen verfügt und - im Unterschied zur Tierwelt mit ihrem starren Verhaltensrepertoire - nicht sicher in seine Umwelt eingepasst ist), andere zählten den Menschen zu den Nesthockern.
Die Gehirnmyelinisierung - v. a. im orbitofrontalen Kortex - ist erst in oder nach der Pubertät abgeschlossen. (Vernünftige Gefahreneinschätzung und verantwortliches Denken können daher erst dann erwartet werden, was bei einer etwaigen Diskussion über das Strafmündigkeitsalter oder die frühestmögliche Erwerbsmöglichkeit eines Führerscheins beachtet werden sollte.) Der Nachteil der im Vergleich zur Tierwelt langsameren Hirnentwicklung bewirkt jedoch, dass wir uns zunächst gezwungenermaßen ausführlich mit einfachen Strukturen auseinandersetzen (alles andere erscheint zunächst nur als strukturloses Rauschen), bevor es unser System zulässt, aufbauend auf dieser Grundlage jene komplexen Strukturen zu verarbeiten, die nur dem Menschen zugänglich sind. Die Reifung garantiert die richtige Reihenfolge der Lerninhalte: zunächst grobe Strukturen, in der Folge immer weiter verzweigte Verfeinerungen.
Im Gegensatz bzw. in Kompensation zu den oben erwähnten einschränkenden Aspekten steht also fest, dass der Mensch besser als alle anderen Säugetiere lernen, sein Wissen weitergeben und sich anpassen kann. Er ist laut Konrad Lorenz, s. u., ein „Spezialist aufs Nichtspezialisiertsein“, der durch sein nie erlahmendes Neugierverhalten und das Zusammenwirken von Praxis und Gnosis jedem Affen überlegen sei, unterschiedlichste Lebensräume zu besiedeln vermöge und z. B. unter allen Lebewesen der Erde zwar nicht der schnellste, aber der ausdauerndste Läufer sei. Zusätzlich dazu widerlegt der Mensch tw. das Gesetz, dass der Überlebensspielraum eines Lebewesens verkehrt proportional zu seinem Organisationsniveau sei. (Bakterien könnten vermutlich Millionen Jahre im Weltraum überleben). Da das Korsett einer instinktgebundenen Festlegung des Denkens und Verhaltens gelockert wurde, konnte sich der Mensch flexibel zu einem weltoffenen Wesen entwickeln, das imstande ist, sich an unterschiedlichste Umweltbedingungen anzupassen und dessen Interesse an einer forschenden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt lebenslang erhalten bleibt. Inzwischen sind 97% aller Säugetiere Menschen, was allerdings auch immer - bedingt durch die nun entstandene Dysfunktionalität der menschlichen Beziehungen - das Risiko des Scheiterns (bis hin zur nun möglichen Auslöschung der eigenen Art durch die Zurückdrängung der Natur bis zu deren Vernichtung oder den Einsatz atomarer Sprengkörper) als Preis für diese Freiheit beinhaltet.
Im Unterschied zum Tier, das automatisch seine Art repräsentiert, ist der Mensch laut Heitger mit Individualität (um die er auch weiß), Selbstbewusstsein (nicht nur Ichbewusstsein) und Freiheit ausgestattet. (Ein prinzipieller - nicht nur gradueller, sondern substantieller - Unterschied zwischen Mensch und Tier kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Auch Tiere können Geist, Intelligenz - s. u. - und bestimmte Bewusstseinszustände haben, wenn sie ihr Wissen auch nicht anhäufen können. Da aber nur der Mensch die Erde im Hinblick auf Biologie, Geologie und Atmosphäre nachhaltig verändert hat, wird das derzeitige Zeitalter seit 2000 auf Vorschlag des niederländischen Chemikers, Ozonlochforschers und Meteorologen Paul Crutzen, 1933-2021; Chemie-Nobelpreis 1995, auch Anthropozän genannt.)
* Statistik: Insgesamt kommen in Österreich auf 1000 Mädchen im ø 1055,7 Buben zur Welt (51,4%). Durch erhöhte männliche Unfall- und sonstige Todeszahlen gleicht sich dieses Missverhältnis bis zur Pubertät wieder aus, am Lebensende dominieren dann die Frauen aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung. Mehrlingsgeburten (deren Auftrittswahrscheinlichkeit mit dem mütterlichen Alter ansteigt) liegen unter 3%. Das Erstgebärendenalter lag 2024 in Österreich im ø bei 31,6 Jahren (3,6 Jahre höher als 30 Jahre davor), Männer werden ølich mit 34 Jahren erstmalig Väter. Zusätzlich verringerte sich die Anzahl der funktionstüchtigen männlichen Spermien durch Lifestyle- oder Umwelteinflüsse (Alkohol, Cannabis, Übergewicht etc.) seit den 70er-Jahren um die Hälfte, sodass die Rate der gewollt oder ungewollt kinderlosen Paare auf bis zu 15% anstieg. Die Anzahl der Erstgebärenden unter 18 Jahren sank in Wien zwischen 1970 und 2024 von 555 um 92% auf 44.
Kurzfristig wurde aufgrund starker Zuwanderung manchmal ein leichter Anstieg der absoluten Geburtenzahlen beobachtet, 2024 gab es in Österreich aber nur 76 873 Geburten bei 87 407 Sterbefällen. (2020 waren es noch noch 83 603 - die meisten im Juli, die wenigsten im Februar; Ausländeranteil über 20% - bei knapp unter 9 Mio. Einwohnern, gleichzeitig aufgrund der damals coronabedingten Übersterblichkeit 91 599 Todesfälle). 2014 wurden in Österreich bei ca. 8 Mio. Ew. 81 722 Menschen geboren, 2001 - ein Rekordtiefststand - bei 3,6% Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (die Anzahl der Sterbefälle lag höher) nur 75 458 (33,1% davon - bis dahin ein Rekordwert - unehelich; ca. 69 000 Inländer). Auf 1000 Einwohner fallen also seit einigen Jahren weniger als 10 Geburten. Die Unehelichenrate betrug 2020 41,2% (Rekord 2016 42,2%).
Grund: In den Post-Babyboom-Jahrgängen gibt es immer weniger potentielle Eltern und immer häufiger bewusste Kinderlosigkeit (vgl. 1963: 134 809, 1992 noch 95 302 Geburten; von 1939 bis 1972 - selbst 1945 - lag die Geburtenzahl pro Jahr immer höher als 100 000). Die Fertilitätsrate (die 2001 nur noch bei 1,33 lag) betrug 2020 im ø 1,44 Kinder pro Frau, sank aber 2024 auf das bisherige Allzeitminimum von 1,31 (vgl. Statistik Austria; zum Vergleich: Niger 6,7, Hongkong 0,8).
Alle Zahlen sind deutlich geringer als vor Aufkommen der „Anti-Baby-Pille“ in den 60er-Jahren des 20. Jhdts., die trotz kirchlicher Proteste (vgl. Enzyklika Humanae Vitae von Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 1897-1978; seit 1963 als Paul VI. der 262. Papst der römisch-katholischen Kirche) das wichtigste Kontrazeptivum geworden ist. (Sie wurde vom bulgarisch-österreichisch-USamerikanischen Schriftsteller und Chemiker Carl Djerassi, 1923-2015, entwickelt und zunächst nur für verheiratete Frauen zugelassen.) Folge: Das Durchschnittsalter der Österreicher (es lag 2021 bei 43,2) wird bis 2030 auf über 45 steigen (auch wenn sich die Tendenz leicht abschwächt). 2014 waren 15% (1950: 23%) unter 19, 18 % (1950: 11%) über 65. 2040 werden die Über-65jährigen mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Bevölkerungspyramide wird dann in eineinhalb Jahrhunderten auf den Kopf gestellt worden sein. (Anfang des 20. Jhdts. kamen auf einen Pensionisten noch 9 Erwerbstätige, 2040 werden es nur noch 2 sein.) Die angesprochenen Entwicklungen werden vorbehaltlich einer Änderung der Situation - etwa durch starke Migrationsbewegungen, Kriege, Pandemien mit hohen Opferzahlen oder Naturkatastrophen - eintreten. (Der Geburtenrückgang kann weltweit beobachtet werden, prozentuell am stärksten in Südamerika von durchschnittlich 5,8 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf 2,0 im Jahr 2020. Trotzdem wird die Weltbevölkerung noch einige Jahrzehnte wachsen.)
|
|
Abb. 2/2: Bevölkerungsentwicklung (Quelle: Statistik Austria:
https://www.statistik.at
Durchschnittliche Maße eines neugeborenen Kindes:
| ° | ø 51 cm Länge |
| ° | ø 3325 g Gewicht (alle Neugeborenen unter 2500 g - etwa 6 von 100; ebenso viele wiegen über 4000 g - werden Frühgeburt, small for date, genannt. Vgl. Informationen für Eltern Frühgeborener) |
| ° | ø 35 cm Kopfumfang |
Knaben und Zweitgeborene sind im Durchschnitt größer und schwerer als Mädchen und Erstgeborene.
* Schwangerschaft und Geburt: Der Mensch kommt im ø nach 281 Tagen Tragezeit (Naegele-Regel zur Errechnung des voraussichtlichen Geburtstermins nach Franz Naegele, 1778-1851: 1. Tag der letzten Menstruation minus 3 Monate plus 7 Tage) - normalerweise aus der Kopflage - auf die Welt. Die pränatale Entwicklung gliedert sich in ein germinales Stadium (die ersten beiden Wochen), ein embryonales Stadium und ein fötales Stadium (ab der 9. Schwangerschaftswoche). 4 Geburten von 100 erfolgen bereits vor der 37. Schwangerschaftswoche, kaum eine nach der 42. Woche, da die Geburt dann künstlich eingeleitet wird. Alle Geburten ab der 38. Schwangerschaftswoche gelten in Österreich (und anderswo) als termingerecht, alle Säuglinge bis zum 28. Tag nach dem errechneten Geburtstermin als Neonatus.
Die Betreuung der Geburt erfolgt mit verschiedenen
Methoden wie z. B. der Sectio Caesaris (in Österreich 2023 fast ein Drittel;
2012 noch 12%), mit und ohne Dammschnitt, mit und ohne Schmerzmittel, im
Liegen, Hocken, auf dem Gebärstuhl, unter Wasser etc. Die Methodenwahl
sollte sinnvollerweise
bereits im Laufe der Schwangerschaft besprochen werden (vgl. die Beschreibung verschiedener
Möglichkeiten
und
Empfehlungen österreichischer Geburtenstationen).
Seit den 80er-Jahren
des 20. Jhts. werden die Prinzipien der sanften Geburt beachtet, als deren
Vater Frédérick Leboyer
(1918-2017) mit seinem 1974 veröffentlichten Buch Geburt ohne Gewalt
gilt.
Vgl. auch die entsprechenden
Seiten von Netdoktor.at, dem
EKIZ-Dachverband und
Rund
ums Baby
* Säuglingsreflexe (z. T. rudimentär; vgl. Video 1, 2; zu Reflexen allgemein s. u.): In der pränatalen Entwicklung wird - nach dem aus heutiger Sicht etwas zu apodiktisch formulierten Rekapitulationsgesetz / Biogenetischen Grundgesetz von Ernst Haeckel (1834-1919) - während der Ontogenese die Phylogenese rekapituliert. Postnatal finden sich tw. als „Überbleibsel“ z. T. atavistische
| ° | Suchreflex: Bestreichen der Wange bewirkt eine Kopfbewegung in Richtung des Reizes |
| ° | Saugreflex: Berühren der Lippe und der Wange bewirkt Saugen |
| ° | Schluckreflex: tritt beim Füttern bis ca. zum 3. Lebensmonat automatisch auf |
| ° | Greifreflex: Fingerbeugung bei Bestreichen der Handinnenflächen (palmar; analog plantar auch an der Fußsohle); sehr stark (Kind könnte an einer Wäscheleine „aufgehängt“ werden) |
| ° | Schreitreflex: In der Senkrechten gehalten, „geht“ ein Säugling, wenn seine Füße den Untergrund berühren. Dabei beobachtbar ist der |
| ° | Aufrichtungsreflex: Wird während des Schreitens plötzlicher Druck auf eine Fußsohle ausgeübt, zeigt der Säugling Stehbereitschaft (Streckung des entsprechenden Beines, Beugung des anderen). |
| ° | Babkinreflex: Beim Druck auf beide Handflächen öffnet das Kind den Mund, schließt die Augen und neigt den Kopf nach vorne (auch Hand-Mund-Reflex; nach dem russisch-kanadischen Neurologen Boris Petrowitsch Babkin / Борис Петрович Бабкин, 1877-1950). |
| ° | Babinskireflex: Das Kind spreizt die Zehen, wenn man über die Sohle streicht (nach dem Pariser Joseph F. Babinski, 1857-1932). |
| ° | Atemschutzreflex: sorgt dafür, dass Babys die Luft anhalten, wenn ihnen Wasser über das Gesicht läuft |
| ° | Schwimmreflex: Ruder- und Paddelbewegungen, die im Wasser auftreten |
| ° | Mororeflex: plötzliche passive Veränderung des Kopfes oder beidseitiges Schlagen auf den Polster neben den Ohren bewirkt ein Aufreißen der Arme mit gespreizten Fingern und danach langsames Zusammenführen der Arme vor der Brust (nach dem deutschen Kinderarzt Ernst Moro, 1874-1951) |
| ° | Galant-Rückgratreflex: Wenn seitlich der Wirbelsäule entlanggestrichen wird, krümmt sich das Baby in die entsprechende Richtung (nach dem Russisch-Schweizer Psychiater Johann Susmann Galant, 1896-1978, der auch als erster unter Globus abdominalis über die eingebildete Schwangerschaft geschrieben hat). |
| ° | Abstoßreflex: Wenn es Widerstand an den Sohlen spürt, stößt sich das Kind in Bauchlage mit den Füßen ab. |
| ° | Tonischer Nackenreflex: In Rückenlage streckt der Säugling asymmetrisch seine Gliedmaßen mit Faustschluss und Spitzfußstellung auf der Seite, auf die der Kopf gedreht wird (ca. ab der 7. Woche sistiert). |
Die Reflexe ersetzen das noch nicht ausgeprägte planvolle Handeln; wenn sie nach einiger Zeit mit zunehmender Hirnreifung nicht verschwinden (meist längstens nach 6 Monaten), nur einseitig oder überhaupt nicht auftreten, deutet dies auf eine Entwicklungsstörung (s. u.) hin. Reflexe, die lebenslang erhalten bleiben, gelten nicht als Säuglingsreflexe (Lidschlussreflex, Patellarsehnenreflex etc.)
* Im Krankenhaus: In Österreich wurden 2023 über 98% aller Kinder im Spital geboren. (Zum Vergleich: in Holland gibt es - u. a. wegen eines elaborierten Hebammensystems - etwa 90% Hausgeburten.)
| ° | Apgar-Test
(1952 von der Anästhesistin und Geburtshelferin Virginia Apgar,
1909-1974, entwickelt; vgl.
hier): Die Beurteilung des Allgemeinzustands der Neugeborenen bzw. deren
Prognose erfolgt postnatal durch Vergabe von 0, 1 oder 2 Punkten für:
|
||||||||||
| Eine Minute nach der Geburt beträgt der Score im Mittel 9 Pt., nach fünf Minuten 10 Pt. (Diese diagnostische Leitlinie gilt als Paradebeispiel für eine erfolgreiche Vorhersagemöglichkeit durch eine Formel mit einfachen, gleich gewichteten Variablen ohne Prädikatorengewichtung - also ohne einen Algorithmus der multiplen Regression; vgl. hier. Sie ist dem klinischen Urteil erfahrener Ärzte bzw. komplizierteren Formeln weit überlegen.) | |||||||||||
| ° | Neugeborenenscreening (für die Schweiz vgl. Seite neoscreening.ch), z. B. PKU-Test (s. u.) wird standardmäßig (in den verschiedenen Ländern und abhängig von den jeweiligen Gesundheitssystemen in unterschiedlichem Ausmaß) durchgeführt. | ||||||||||
| ° | Versorgung des Neugeborenen (Säubern, Stillgeschäft in Gang bringen, - z. T. noch unabgenabelt und mit Käseschmiere, hinlegen, z. B. in einer seit Ende der 70er-Jahre des 20. Jhts. üblichen Rooming-in-Situation, etc.) | ||||||||||
| ° | Ausführliche pädiatrische Untersuchung in den ersten Tagen nach der Geburt (z. B. um eine Hüftgelenksdysplasie u. a. sofort zu erkennen, Vitamin D als Rachitis-Prophylaxe anzuordnen etc.) |
* Vorteile des Stillens: Die Nahrung ist immer zur „Hand“ und gesund, der Zeitaufwand ist mit ca. 30 min pro Stillvorgang (allerdings mehrmals täglich) relativ gering, Angebot und Nachfrage regeln sich selbstständig, die Nahrungsaufnahme ist mit Sozialkontakt und daher Oxytocin-Ausschüttung verbunden: es entsteht Bindung (Bonding; s. u.). Die durchschnittliche Dauer des Stillens hat in den letzten 100 Jahren deutlich abgenommen. Aus sozialpsychologischer Sicht und von der WHO werden mindestens 6 Monate empfohlen, bevor zugefüttert werden kann. (Dass diese Hinweise ignoriert werden, ist den geänderten Lebensumständen geschuldet, die sich zulasten der Bedürfnisse der Kinder, aber zugunsten der Bedürfnisse der Mütter entwickelt haben. Da die Beteiligung der Väter am Erziehungsgeschehen bzw. den innerhäuslichen Angelegenheiten nach wie vor weit unter dem Zeitaufwand der Mütter liegt - bis auf das Stillen gibt es keinen Grund, der dies rechtfertigen würde - müssen, wie auch sonst in der Gesellschaft, die Schwächsten zurückstecken, die auch später um die Erfüllung günstiger Entwicklungsvoraussetzungen gebracht werden, wenn der Kindergartenbetreuungsschlüssel in unzumutbarer Weise um ein Vielfaches das Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnisse verfehlt.)
* Erste physische Entwicklung: Der erste Atemzug sollte innerhalb der ersten 20 Sekunden erfolgen und die Hautfarbe rasch rosig werden (vgl. - hier oder hier - „Blue babies“ durch Methämoglobinämie, Herzfehler oder vorübergehend). Die erste Miktion erfolgt unmittelbar post partum, der erster Stuhl (Mekonium) ist schwarz, dann entstehen aromatische Muttermilchstühle. Die Neugeborenen nehmen zunächst ab (Tiefstwert 3. Tag, maximal tolerabel sind 10%), nach 10 Tagen haben sie ihr Geburtsgewicht wieder erreicht. Das Abfallen des Nabelschnurrestes erfolgt nach etwa 8 Tagen. Oft tritt nach dem dritten Tag ein leichter Ikterus auf („Neugeborenengelbsucht“). Nach 3-4 Monaten hat sich das Geburtsgewicht verdoppelt (nach einem Jahr verdreifacht). Größe mit 0;6: ø 66 cm. Mit ca. 5 Wochen kann ein Baby aus der Bauchlage seinen Kopf heben, mit etwa drei Monaten selbständig den Kopf wenden. Erst später ist ein selbständiges Drehen von der Bauch- in die Rückenlage möglich. Vorteile der Rückenlage: ev. größeres Wahrnehmungsfeld, weniger SIDS-(Sudden Infant Death Syndrom)-Fälle (vgl. Risikofragebogen, Seite 1, Seite 2); Vorteile der Bauchlage: geringere Erstickungsgefahr bei ev. Erbrechen. Mit etwa 0;4 greift das Kind nach angebotenen Gegenständen. Die Zahnentwicklung startet unterschiedlich (z. T. auch erst nach 0;6, beginnend mit den unteren Schneidezähnen), der Gebrauch der Sprechwerkzeuge ist unspezifisch. Am Beginn der Sprachentwicklung stehen Lallmonologe (s. u.). Schreien ist in Maßen bis zu einem gewissen Grad normal, sollte aber immer be(ob)achtet werden. (Es sendet wichtige Signale wie „Hunger“ oder „Schmerz“ aus und ist eine erste Methode, Selbstwirksamkeit - s. u. - zu erleben, stärkt allerdings entgegen landläufigen Mythen nicht die Lungenfunktion.) Spätestens wenn über drei Wochen an drei Tagen über drei Stunden geschrieen wird, sollte dies ein Alarmzeichen sein (Dreierregel; in manchen Städten gibt es Schreiambulanzen - s. Österreich). Zu beachten ist auch das zunehmend abnehmende stark erhöhte Schlafbedürfnis von Säuglingen.
* Sozialentwicklung: Die wichtigste Grundlage einer gesunden Sozialentwicklung besteht darin, dass - nach einem Zitat des Schweizer Pädiaters Oskar Jenni (*1967) - Menschen aus dem „nahen Umfeld“ des Kindes „verlässlich, vertraut, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sind“ („5 Vs“). Die Qualität der Beziehungserfahrungen prägt die Entwicklung eines Menschen lebenslang. Gefahr für den späteren Werdegang droht daher, wenn die von Jenni angesprochenen Voraussetzungen fehlen, also z. B. in frühen Lebensphasen Bezugspersonen oftmals wechseln, wie dies zunächst von René Arpad Spitz (1887-1974) bei Kindern, die mehrmonatige Spitalsaufenthalte zu überstehen hatten, beobachtet wurde: Die Folgeerscheinung (ein Bild der psychischen Verwahrlosung) nannte er Hospitalismus. Sie äußert sich im Laufe der Kindheit in Verhaltensstörungen, z. B. Iaktation (Schaukeltick), Enuresis (Bettnässen), Enkopresis (Einkoten), Onychophagie (Fingernägelkauen), Dermatillomanie (Aufkratzen der Haut), Trichotillomanie (Haare ausraufen) etc., und retardierter Entwicklung. („Gefühlsmangelkrankheit“; vgl. Hospitalismus bzw. folgendes Video von Spitz. Alle genannten Symptome können auch andere Ursachen haben.) Jede Form von ELS (early-life stress; s. u.) gilt als schädlich für die spätere Entwicklung (und wird stark unterschätzt).
Zu wenig Eindrücke und Lernmöglichkeiten (im Extremfall Deprivation, also Reizentzug) während der Frühentwicklung reduzieren zudem dramatisch die Aktivitäten der Nervenzellen und damit indirekt die Intelligenz. Im Normalfall genügt es, ein vernünftiges Minimum an Anregungen und Förderungen zur Verfügung zu stellen, da Kinder - s. o. - nach der Scheinwerfertheorie funktionieren. (Im späteren Leben führt Reizdeprivation zu psychischen Störungen und erhöhter Anfälligkeit für Manipulationen. Brain washing / Hirnwäsche - der Ausdruck geht auf eine 1950 erschienene Artikelserie über den Koreakrieg von Edward Hunter, 1902-1978, zurück - beruht darauf.)
Das erste Lächeln erfolgt mit 7 bis 9 Wochen (auch taubblind Geborene lächeln, da es sich um eine angeborene Verhaltensweise handelt). Gesichter werden zunächst nur schemenhaft erfasst (vgl. folgende Seite), aber anderen Mustern vorgezogen. Gesichtserkennung ist angeboren und wird durch sogenannte Face-Patches auf der Großhirnrinde rechts unten hinten seitlich - s. o. - gesteuert. Wie beim Erlernen der Muttersprache schränkt sich die Offenheit für andere Möglichkeiten, z. B. für die Diskriminationsfähigkeit von Affengesichtern, immer mehr ein. (Verkehrt angeordnete Gesichter werden daher nur im ersten Lebenshalbjahr gleichartig akzeptiert. Aufgrund des Thatcher-Effekts - so benannt, da 1980 von Peter Gage Thompson, *1950?, in den diesbezüglichen Ex.en Photos der englischen Premierministerin Margaret Thatcher, 1925-2013, verwendet wurden - können deutliche Verzerrungen bei auf dem Kopf stehenden Gesichtsabbildungen, die nach dem Umdrehen sofort auffallen, auch von Erwachsenen nicht erkannt werden. Vgl. hier)
Eltern reagieren auf das angeborene „Kindchenschema“ (Bezeichnung von Konrad Lorenz als Beispiel für einen AAM; s. u.). Mit 0;3 erkennen Babys ihre Bezugspersonen (oder zumindest immer gleiche Situationen). Eine konstante Umwelt (Personen sind dabei wichtiger als Sachen oder die Wohnumgebung) ist daher anzustreben. Schon vorher scheinen Kinder auf die Stimme der Mutter (die sie ja schon während der Schwangerschaft „kennengelernt“ haben) anders zu reagieren als auf fremde Stimmen.
Zur Bindungstheorie bzw. neurobiologischen Aspekten s. u., zu Beziehungs- und anderen Problemen im Falle einer Scheidung der Eltern s. Opfer der Rosenkriege - Rollenmissbrauch der Kinder.
* Identitätsentwicklung: Unter Identität wird die Vorstellung davon, wer man selbst im Unterschied zu anderen Personen ist, verstanden (nach Erik Homburger Erikson, 1902-1994, „die Fähigkeit des Ich, angesichts des wechselnden Schicksals Gleichheit und Kontinuität aufrechtzuerhalten“). Diese Vorstellung entsteht als Akt sozialer Konstruktion unter Einfluss zahlloser Faktoren (z. B. aus den persönlichen Erinnerungen) im Laufe des Lebens und führt zu (auch Selbst‑)Anerkennung und Zugehörigkeit zu anderen Personen oder Personengruppen (oder auch nicht). Die diesbezüglich wichtigste „Entscheidung“ ist die zwischen Urvertrauens vs. Urmisstrauen (die erste von insgesamt acht Identitätsstufen nach Erikson), da sich eine in der frühen Zeit des Aufwachsens auf dieser Basis erworbene Grundhaltung positiv oder negativ auf das gesamte Leben auswirkt. Zur weiteren Entwicklung von Identität in der Theorie von Erikson vgl. diese Links und die folgende Tabellenübersicht der in seinen Büchern Childhood and Society 1950 und Identity and the Life Cycle 1966 in Anlehnung an Freuds psychosexuelle Phasen (s. u.) erstellten acht Identitätsstufen:
|
Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson |
||
| Stufen der Identität: | Beschreibung („Epigenese der Identität“): | Zitate: „Ich bin, ...“ |
| 1. Identitätsstufe (ca. 0;0-1;0): | Urvertrauens vs. Urmisstrauen | „... was man mir gibt.“ |
| 2. Identitätsstufe (ca. 1;0-3;0): | Autonomie vs. Scham, Zweifel | „... was ich will.“ |
| 3. Identitätsstufe (ca. 3;0-5;0): | Initiative vs. Schuldgefühl | „... was ich mir zu werden vorstellen kann.“ |
| 4. Identitätsstufe: (ca. 5;0-12;0) | Werksinn, Leistung vs. Minderwertigkeitsgefühl | „... was ich lerne.“ |
| 5. Identitätsstufe (ca. 12;0-20;0): | Erwachsenenidentität vs. Identitätsdiffusion | „... was ich bin.“ |
| 6. Identitätsstufe (ca. 20;0-45;0): | Intimität vs. Isolierung | „... was mich liebenswert macht.“ |
| 7. Identitätsstufe (ca. 45;0-65;0): | Generativität vs. Selbstabsorption, Stagnation | „... was ich bereit bin zu geben.“ |
| 8. Identitätsstufe (ca. 65;0-100;0): | Ich-Integrität vs. Verzweiflung, Lebensekel | „... was von mir überlebt.“ |
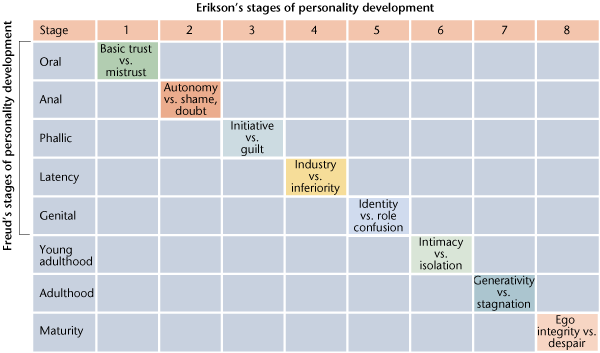
Abb. 2/3:
Erikson und Freud
(Quelle:
http://www.jogolis-kindergarten.de/wordpress/?page_id=82)
Der britische Pädiater und Schüler von Melanie Klein (s. u.) Donald Woods Winnicott (1896-1971) prägte die Begriffe „Wahres Selbst“, das es uns ermögliche, authentisch und spontan zu leben, Beziehungen zu unterhalten, kreativ zu sein und uns lebendig zu fühlen, und „Falsches Selbst“, das als eine Art Schutzmaske getragen werde und im besten Fall später ein gesellschaftskompatibles Verhalten ermögliche, wenn das Baby, das nicht alleine gedacht werden könne („There is no such thing as a baby“), in seiner Dyade mit einer (in diesem Fall nicht) „good enough mother“ emotionale Deprivation erlebt habe und nicht in die Lage versetzt worden sei, den Ablösungsprozess (eventuell mithilfe eines Übergangsobjekts wie z. B. einem Deckenzipfel) zu vollziehen.
Der Begriff Identität (vgl. a. u. 1, u. 2) wurde auch philosophisch untersucht, z. B. von Søren / SÖren Kierkegaard, 1813-1855, der 1849 in seinem Buch Die Krankheit zum Tode davon sprach, dass Verzweiflung eine Krankheit des Selbst sei, das zu keiner Einheit gefunden habe. Sie könne sich dreifach äußern: man könne verzweifelt sich gar nicht bewusst sein, überhaupt ein Selbst zu haben (also ein dumpfes, auf die Sinnlichkeit beschränktes Leben ohne Selbstreflexion führen), man könne verzweifelt nicht man selbst sein wollen (also wissen, dass man ein Selbst habe, damit aber nicht zufrieden sein und eine andere Identität annehmen wollen), oder man könne verzweifelt man selbst sein wollen (also auf der Suche nach dem sein, der man tatsächlich sei).
Nach Eva-Maria Jaeggi (geb. Schaginger; *1934; Vortrag Teleakademie; nicht mehr aktiv) kreist der Begriff „Identität“ '(Bewusstsein für die eigene Besonderheit) um drei Problemfelder, die früher anders als heute behandelt wurden:
| ° | Der Begriff „Selbst“ | Früher: Im Mittelpunkt stand die Frage, was den „Wesenskern“ ausmache. Vgl. Friedrich Nietzsches (1850-1900) in Anlehnung an Pindar (Πίνδαρος; 518/22-nach 446 v. Chr.) entstandenes Zitat „Werde, der du bist!“ | Heute: Der Begriff „Selbst“ wird relativiert, der Begriff „Identität“ verflüssigt, Essentialismus abgelehnt. Erhöhte Mobilität in allen Lebensbereichen führt zu Heterogenität bzw. Flexibilisierung von Selbstbild und Identität. |
| ° | Die Idee einer zielgerichteten Entwicklung | Früher: Wichtige Fragen waren: Gibt es eine kontinuierliche Identitätsentwicklung? Sind Identitätsbrüche immer destruktiv? | Heute: Normative Entwicklungsvorstellungen greifen nicht mehr. Statt starrer, entfremdeter Identitäten werden balancierende Identitäten im Zusammenhang mit Resonanz (s. u.) beschrieben. Veränderung wird positiv gesehen. |
| ° | Die Rolle der Anderen | Früher: Die wichtigste Frage war, wann der Einfluss anderer Personen gefördert bzw. unterbunden werden sollte. | Heute: Private Beziehungen bekommen zulasten von Religionen, Berufen, Institutionen etc. eine größere Rolle. Die Idee, dass Identität durch Aushandlung entsteht, kommt auf. Voraussetzung dafür ist eine gewisse Ambiguitätstoleranz. |
Zu beachten ist, dass sich diese Tabelle auf individualistische Kulturen bezieht. Die Begriffe „Identität“ und „Selbst“ würden in Gemeinschaftskulturen (s. u.) ganz anders gesehen werden. Als nützlich erwies sich im Zusammenhang mit diachroner Identität die Unterscheidung in Person (die sich im Laufe des Lebens nicht verändert und jederzeit - etwa auch in dementem Zustand - Rechte und Würde genießt) und Persönlichkeit (die aus einer Mischung genetischer Dispositionen und Umwelterfahrungen gebildet wird und sich, z.B. durch das Auftreten einer Alzheimer-Erkrankung - s. u. -, drastisch verändern kann).
- 0;6 bis 2;6: Frühkindheit:
* Ordnungsprinzip der zweiten Phase: Kennenlernen der
gegenständlichen Welt (deren Elemente noch unverbunden bleiben)
Ding 1 .... Ding 2 .... Ding 3 .... Ding 4 .... Ding n |
Abb. 2/4: Ordnungsprinzip 2. Phase
* Physische und motorische Entwicklung: Sie erfolgt immer in der selben Abfolge, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Wichtige Aspekte dieser Phase sind: Immer bessere Körperkoordination und -beherrschung gemäß dem kephalo-kaudalen Trend (von oben nach unten; z. B. zuerst Kontrolle über die Nackenmuskel, später über den Schließmuskels) und dem proximal-distalen Trend (von nah zu fern; z. B. zuerst Ausprägung der Arm-, dann erst der Fingermotorik), am Beginn dieser Phase die 1. Dentition (Ausbildung des 20zahnigen Milchgebisses, manchmal mit frühkindlichem Bruxismus = Zähneknirschen), das allmähliche Erlernen selbständigen Essens und Ausscheidens, das Wachstum (die ø-Länge am Ende der Phase über 90 cm; das Wachstumstempo nimmt ab) usw. Das Erlernen des Sitzens bewirkt eine wesentliche Wende: Durch die Überschneidung von Greifraum und Sehraum entstehen völlig neue Möglichkeiten des Spielens (und Handelns überhaupt). Grob- und Feinmotorik verbessern sich fast täglich, Werkzeuggebrauch und das Verwenden von Knöpfen wird möglich. Das freie Stehen und Gehen wird meist zwischen 0;10 und 1;2 beherrscht.
Von Anfang an benutzt das Kind in seinem Verhalten
2 Modi:
| ° | Exploration / Erkundung: die (flexible) Suche nach neuen Möglichkeiten mittels Experimentieren und (je nach Individuallage) Überdenken der Situation mit unsicheren, oft erst längerfristig sichtbaren Ergebnissen |
| ° | Exploitation / Nutzung: die (effiziente) Nutzung des bereits Vorhandenen in inkrementeller Vorgangsweise zur Optimierung und Erhaltung des Gelernten mit unmittelbar sichtbaren Ergebnissen |
In dieser (und der nächsten) Phase werden die Kinder immer mobiler, was die Unfallgefahr, z. B. durch (Fenster)stürze, Ertrinken, Stromschläge, Leitern, den Straßenverkehr, Putzmittel, Medikamente etc. und die Vorliebe, alles in den Mund zu stecken, im Vergleich zu den Monaten davor drastisch erhöht, da Kinder die Gefahren (besonders die durch Verkehrsmittel, die sie aufgrund ihrer Körpergröße ganz anders wahrnehmen als Erwachsene) noch nicht adäquat abschätzen können. Es ist daher wichtig, präventive Maßnahmen zu ergreifen. (Im Anlassfall kann Auskunft bei der Vergiftungsinformationszentrale unter Tel.: +43 1 406 43 43 und in Deutschland bei der Giftzentrale bzw. der Rettung / dem Ärztenotdienst eingeholt werden.) In der zweiten Hälfte der Frühkindheit lässt die Feinmotorik bereits erste „Zeichnungen“ zu, die zunächst nur aus schwer, wenn überhaupt identifizierbarem „Gekritzel“ bestehen (s. u.).
Stark zugenommen hat etwa seit dem Jahr 2000 die schon früh auftretende Kurzsichtigkeit, weil die Entwicklung der Augen immer wieder längere Phasen der Fernfixierung benötigen würde. Da Eltern ihre Kinder aber zunehmend im Haus behalten und ihnen - die Situation drastisch verschärfend - elektronische Geräte, die ausschließlich zur Nahfixierung zwingen, zur Verfügung stellen, entstehen irreversible Myopien. (Kinder sollten sommers wie winters täglich mindestens zwei bis drei Stunden in der freien Natur, wo eine andere Lichtzusammensetzung herrscht, verbringen, wie dies etwa in Norwegen - auch bei Regen - völlig normal ist. In Südkorea, das der gegenteiligen Entwicklung vorauseilte, waren bald nach dem Aufkommen der Smartphones 80% aller Volksschüler kurzsichtig; vgl. dazu auch den folgenden Abschnitt.)
* Spielzeug: soll das Erfassen der Dingwelt in allen Facetten unterstützen. Begriffe entstehen vor dem Auftreten der Sprache durch Begreifen. Auch Dinge des alltäglichen Gebrauchs oder der Umwelt (z. B. im Wald) werden zum „Spielzeug“. Günstig ist eine anregende bzw. angereicherte, aber nie überfordernde Umgebung. Gefahr: die Überfülle an z. T. pädagogisch wertlosem (Plastik)spielzeug schränkt die Phantasie ein und fördert einen unkritischen Materialismus. Ein wichtiger Diskussionspunkt der letzten Jahre betrifft elektronische Geräte im Kinderzimmer, die dort (zumindest bis zum 7., möglicherweise bis zum 10. Lebensjahr) wenig bis nichts verloren haben sollten. Kindertöpfe mit Tablet-Haltevorrichtung für 2-Jährige sind hier nur die kuriose Spitze des Eisbergs (wenn auch beide dadurch ermöglichten Tätigkeiten Wischen erfordern). Das Gegenmodell bestünde darin, mit den Eltern gemeinsam Zeit zu verbringen, Aktivitäten und Erlebnisse zu teilen und miteinander zu reden. Nichts fördert die Entwicklung des Potentials der vorhandenen Gene und damit die Intelligenz eines Kindes mehr als eine anregungsreiche, liebevolle Umwelt. Das diesbezüglich vorhandene Angebot entscheidet von der Geburt an maßgebend über die weitere Entwicklung. (Die wenigsten Eltern würden ihre Kinder unkontrolliert Suchtmittel konsumieren, in Pornoshops gehen, Hinrichtungen ansehen oder unbeaufsichtigt Fremde treffen lassen, haben aber keine Bedenken, ihnen Smartphones zur Verfügung zu stellen, die all dies möglich machen.)
Hochproblematisch ist in diesem Zusammenhang, dass Kinder oft kein Kontrastprogramm geboten und den Medienkonsum der Eltern, denen dies meist nicht bewusst ist, als „Vorbild“ vorgesetzt bekommen. Wenn ein Kind während seines Aufwachsens die Aufmerksamkeit seiner Eltern permanent mit dem Handy (der Großteil der Erziehenden kennt keine stundenlangen, ruhigen, handy- und tablet- bzw. laptopfreien Zeiten mehr) teilen muss, als Freizeitbeschäftigung nur den TV-Konsum (oder andere screenbezogene Tätigkeiten und das mehrmals pro Woche) wahrnimmt und daher kennenlernt, aber nie oder nur alle paar Wochen mit der Natur in Berührung kommt, so wird dies prägend sein. (Den Eltern und damit später ihrem Nachwuchs ist dabei meistens nicht bewusst, dass nicht nur sie ihre Geräte, sondern umgekehrt vor allem diese sie benützen, um Daten zum Wohle der dahinter stehenden Digitalkonzerne zu sammeln. Die dabei verwendeten Benutzeroberflächen und zugrunde liegenden Algorithmen setzen Dopaminausschüttung frei und sind bewusst suchtfördernd gestaltet. Edward Tuftes, *1942; US-amerikanischer Informationsforscher: „Nur zwei Branchen bezeichnen ihre Kunden als ‚User’: illegale Drogen und Software.“)
Untersuchungen zeigen, dass hochintelligente Kinder darunter weniger (aber doch) leiden, für durchschnittliche oder weniger begabte Kinder diese Situation aber eine mentale Katastrophe ist. Auswirkungen zeigen sich später vor allem in Bezug auf das Durchhaltevermögen bei schwierigeren Aufgaben (vgl. mhd.: „die andern tugende sint enwiht, und ist dâ bî diu stæte niht“ - Thomasîn von Zirklære, ca. 1186-angeblich 1238, Der Welsche Gast Vers 1819) und die psychische Stabilität und damit auf den erreichten Bildungsabschluss und das Gelingen von Beziehungen. (Vgl. Video-Interview und das Buch des amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt, *1963, The Anxious Generation. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness - auf Deutsch Generation Angst. Wie wir unsere Kindern an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen -, in dem die Auswirkungen der Screengeräte auf die kindliche Psyche wissenschaftlich untersucht werden)
* Kognitive Entwicklung: Die Gehirne von Aufwachsenden (die bei der Geburt nur ein Viertel des Erwachsenengewichts haben und in den ersten beiden Lebensjahren rapide wachsen) sind in einem (lebenslang anhaltenden) permanenten Lernmodus. Es werden Muster erkannt, Regeln extrahiert und später auch Bewertungen abgegeben. Die in dieser (und der nächsten) Phase vorherrschenden Lern- (und Lebens)bedingungen entscheiden über späteren Lernerfolg in der Schule. Nach neueren Erkenntnissen der Neurobiologie sind sich Kinder vermutlich schon sehr früh (noch bevor sie dies sprachlich ausdrücken können) mancher Informationen, aber erst mit ca. 2 Jahren ihrer selbst bewusst. Der Nachweis für Letzteres erfolgt durch das 1970 von Gordon G. Gallup (*1941; nicht mit dem Revolutionär der Meinungsforschung und Gründer des Gallup-Instituts George Horace Gallup, 1901-1984, zu verwechseln) für Schimpansen und in ihrer Dissertation 1968 von Beulah Amsterdam, geb. Kramer (*1937) für Kleinkinder entwickelte Spiegelex.: Fassen sich die Getesteten, denen auf eine der Wangen ein Punkt gemalt wurde, nach Ansichtigwerden ihres Spiegelbilds an die richtige Stelle, ist so etwas wie Ich-Bewusstsein anzunehmen. Ansatzweise entsteht in dieser Phase bereits eine Theory of mind , also die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können (Selbsteinsicht, beginnendes Verstehen, dass jeder Mensch eigene / andere Gedanken, Überzeugungen und Absichten hat, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen; s. a. u.), was in der Folge Perspektivübernahme und (un)moralisches Handeln ermöglicht. (Dies ist mit Abstrichen auch für Primaten und sogar Pferde nachgewiesen.)
* Sprache: Die Funktionsweise der Sprechwerkzeuge wird von Anfang an trainiert, wobei in den Lallmonologen bereits sprachtypische Intonationsmuster erkannt werden können. Die Sprachfähigkeit muss von den Eltern - in einer Art bewusst einkalkulierten Überforderung - antizipiert (vorweggenommen) und vorausgesetzt werden, um entstehen zu können. Die Bezugspersonen verwenden die Sprache, als ob ihre Kinder sie bereits verstehen könnten (und müssen auf die Vorbildwirkung grammatikalisch richtiger Sätze achten). Dadurch, dass die Umwelt unterstellt („so tut, als ob“), dass das Baby die Sprache versteht, kann sich diese im Kind entwickeln, sobald die Reifungsgrundlagen vorhanden sind. Im Unterschied zum rein imitierenden Papagei sucht das Kind aufgrund seiner vorhandenen genetischen Dispositionen (beteiligt sind z. B. die Gene NOVA1 und FOXP2) von Beginn an nach wiedererkennbaren Mustern und (Bedeutungs)zusammenhängen, die es ihm später ermöglichen werden, eigenständige, noch nie dagewesene Sätze zu sprechen und weitere Sprachen zu erlernen (was umso leichter fällt, je polyglotter man schon ist). Auch taubstumm geborene Kinder sind zu komplexen Sprachstrukturen fähig, solange sie wie alle anderen Heranwachsenden in den sensiblen Phasen einen dementsprechenden Input (in ihrem Fall in Form der Gebärdensprache) bekommen.
Nach Schätzungen des Ulmer Psychiatrieprofessors Manfred Spitzer (*1958) lernt ein Kind im Durchschnitt alle 90 Minuten ein neues Wort. Das tatsächlich erreichte Sprachniveau differiert jedoch innerhalb der untersuchten Kohorten aufgrund des sozioökonomischen Hintergrunds und anderer Faktoren zum Teil erheblich, sodass manche Kinder später beim Eintritt in das Bildungssystem oft weit über oder unter dem durchschnittlichen Niveau ihres Jahrgangs liegen (s. a. u.). Die Förderung der Sprachentwicklung - und damit automatisch der späteren schulischen Lernentwicklung - erfolgt, wenn sie erfolgreich sein will, hauptsächlich über handlungsrelevante sprachliche Interaktionen (gemeinsames Kochen, Gartenarbeit, Ausflüge etc. - also gemeinsame Zeit) und über das Vorlesen, verbunden mit anschließendem Miteinander-Sprechen. Völlig unzureichend wirkt in diesem Alter „elektronische“ Sprachförderung durch digitale Geräte, da dadurch das Auslesen von Mimik und Gestik und damit das erfolgreiche Einschätzen anderer Personen - das z. B. als Prophylaxe gegen das Manipuliert-Werden dient - verkümmert bzw. gar nicht erst entstehen kann. Es fehlt zudem die durch zwischenmenschliche Kontakte erzielte Synchronität (Herzschlag, Atmung, EEG-Wellen, Oxytocinausschüttung, Gesprächsrhythmen etc. stellen sich aufeinander ein), die in der Folge Vertrauen ermöglicht. Erst nachdem eine Wechselwirkung (bzw. Tausende Wechselwirkungen) mit der realen Welt zu inneren Repräsentationen der Wahrnehmungsinhalte im Gehirn geführt hat (haben), können digitale Endgeräte mit ihren (aufgrund mangelnder Korrelation der Sinnesmodalitäten verarmten) virtuellen Realitäten einen Mehrwert bieten.
Das Sprachverstehen gliedert sich in drei Stufen: Sprachwahrnehmung und -erkennung, die semantische Analyse (Parsing) und die Sprachverwendung (die Benutzung der mentalen Repräsentationen).
Wie Exe. an Neugeborenen zeigten, wird die „Mutter“sprache schon von Geburt an anderen Idiomen vorgezogen, da das Gehör (beginnend zwischen 24. und 28. Schwangerschaftswoche) zumindest in den letzten drei Monaten ante partum eine Gewöhnung ermöglicht hat. Bei mehrsprachigem Aufwachsen (das unter anderem geistige Flexibilität fördert und dadurch im Alter eine eventuelle Alzheimer-Erkrankung - s. u. - erst Jahre später ausbrechen lässt) sollen die verschiedenen Sprachen eindeutig unterschiedlichen Personen oder Situationen (Vater/Mutter, Familie/Umgebung) zugeordnet sein. Erst wenn das Kind sich der Mehrsprachigkeit bewusst wird (2./3. Lj.), kann es gezielt umschalten. (Nach dem 12. Lj. ist ein völlig akzentfreies Erlernen einer Fremdsprache nur noch wenigen möglich. Die problemlos funktionierende Fähigkeit, verschiedenartige Laute auch in fremden Sprachen zu unterscheiden, verliert sich bereits mit etwa einem halben Jahr.)
Bereits sieben Monate alte Säuglinge sind in der Lage, einfache grammatikalische Strukturen zu unterscheiden, zu lernen und (erkennbar an veränderter Aufmerksamkeitsspanne) anzuwenden. Zunächst werden Einwortsätze (80% Substantiva, 20% Verben), dann ganze Sätze, die parataktisch gereiht werden, generiert. Der Wortschatz beträgt in der Frühkindheit etwa 300 Wörter, die dominierende Frageform ist die Was-Frage („1. Fragealter“).
|
Die sieben Stufen der
Sprachentwicklung |
|
| 1. Stufe (ca. 0;0-0;4) | Organisch bedingte Laute und Schreie (z. B. Geburtsschrei, Gurren etc.) |
| 2. Stufe (ca. 0;4-0;10) | Lallmonologe, tw. durch Nachahmung; häufige Lautverdopplungen („dada“, „mama“ etc.) |
| 3. Stufe (ca. 0;10-1;6) | Stadium der sinntragenden Einwortsätze ohne festen grammatischen Umriss |
| 4. Stufe (ca. 1;6-2;0) | Worthaufen, Zwei-, dann Mehrwortsätze, die syntaktisch zusammengehören |
| 5. Stufe (ca. 2;0-2;6) | Flexionsbildung; Negations-, Frage- und Befehlssätze werden möglich |
| 6. Stufe (ab 2;6) | Komplexe, zunächst parataktisch, dann hypotaktisch gebaute Sätze |
| 7. Stufe (bis zum Tod) | Ständige Wortschatzerweiterung bei immer höherem Abstraktions- und Komplexitätsgrad |
Eine der ersten systematischen Untersuchung zur Kindersprache stammt vom Erfinder des IQ, William Stern - s. u. -, und seiner Frau Clara (1877-1948), den Eltern des Philosophen Günther Anders (1902-1992) und der Widerstandskämpferinnen Hilde Marchwitza-Stern, gesch. Schottlaender (1900–1961) und Eva Michaelis-Stern (1904–1992). Das Ehepaar Stern hielt auf 1000enden Seiten alle Entwicklungsschritte ihrer Kinder fest.
Großen Einfluss auf die Frage, was Menschen dazu befähigt, Sprachen zu erlernen bzw. wie sie das tun, hatte die nativistische Idee einer allen Sprachen der Welt zugrundeliegenden Universalgrammatik von Noam Chomsky (*1928; s. a. u.), der als Mitbegründer der kognitiven Wende der Psychologie weg von der reinen Verhaltensbeobachtung (vgl. u. Behaviourismus) gilt. Danach enthalte das Gehirn eine mentale Schablone für Grammatik, ein computerähnliches Programm bringe die in Nominalphrase und Verbalphrase trennbaren Sätze hervor (z. B. „Die interessierten Schüler der 7. Klasse...“ = NPh; „...lesen gerne im Psychologieskriptum.“ = VPh). Demgegenüber postuliert die gebrauchsbasierte Linguistik, dass Kinder beim Spracherwerb auf intuitivem Wege allgemeine kognitive Fähigkeiten wie z. B. die zur Analogiebildung nutzen. (Zur Kontroverse s. hier)
Andere Theorien führen den Spracherwerb auf die Fähigkeit zur
Mustererkennung, lernpsychologisch auf Nachahmung (von
Chomsky abfällig „parrot fashion“
genannt; z. B.
Skinner,
s. u.),
neurolinguistisch auf die Ausbildung der beiden Sprachzentren im Gehirn (des
für die Produktion zuständigen grammatikorientierten Broca-
und des für das Verstehen notwendige bedeutungsorientierte Wernicke-Areal;
nach Pierre Paul
Broca, 1824-1880, und Carl
Wernicke, 1848-1905;
s. a. u.) oder, wie
Jérôme Seymour
Bruner (1915-2016),
interaktionistisch auf den
Einfluss der Bezugspersonen zurück. Nicht alle diese Theorien sind
unvereinbar. Die Spracherwerbsforschung (bezieht sich auch auf Zweit- und
weitere Sprachen) ist gemeinsam mit der Sprachwissensforschung (untersucht die
Kompetenz der Sprecher) und der Sprachprozessforschung (untersucht die
Performanz der Sprecher) ein Teil der Psycholinguistik.
Vgl.
a. o. und Tutorial Sprache
und Gehirn und zur frühkindlichen Sprachentwicklung folgende
Dissertation)
* Sozialentwicklung, Bindungstheorien: Soziale Signale werden nun nicht mehr reflexartig abgesendet, sondern gezielt (und tw. bereits manipulierend) an Bezugspersonen gerichtet. Eine Anpassung an deren Forderungen wird möglich.
2. Identitätsstufe nach Erikson: Autonomie vs. Scham, Zweifel (entspricht etwa Freuds Analphase, s. u.: Es geht darum, eine selbstgesteuerte Lebenshaltung zu entwickeln und sich nicht für die eigenen Produkte schämen und abwerten lassen zu müssen). Erste Erfahrungen mit der Selbstständigkeit erfordern positive Unterstützung, besonders bei Misserfolgserlebnissen, durch die Bezugspersonen. Regeln mit äußeren (Sanktionen) und inneren (Scham) Konsequenzen bei ihrer Übertretung werden erlernt.
Einen besonderen Stellenwert hat (nicht nur) in dieser Altersstufe die Bindungstheorie: Im Hinblick auf die Sozialentwicklung wurde besonders das biologisch angelegte, durch das Hormon Oxytocin („Kuschelhormon“; s. o.) maßgeblich beeinflusste bzw. dessen Ausschüttung beeinflussende Bindungsverhalten, dessen beidseitiges Ziel Schutz und Fürsorge ist und das vor allem unter Stress aktiviert wird, erforscht. Die psychologische Bindungstheorie geht auf John Bowlby (1907-1990) zurück, der - ursprünglich aus psychoanalytischer Sicht und tw. beeinflusst von Konrad Lorenz (s. u.) - die intensive emotionale Beziehung eines Säuglings zu einer Bezugsperson - für Bowlby vor allem die Mutter - erforschte (Theory of attachment; erstmals 1958 in seiner Schrift The nature of the child’s tie to his mother, später in Child Care and the Growth of Love. Vgl. Can I leave my baby?). Michael Rutter (1933-2021) versuchte später - 1972 - nachzuweisen, dass nicht die Identität der Bezugsperson, sondern die Qualität der Fürsorge für die psychische Gesundheit entscheidend sei. Bruno Bettelheim (1903-1990) - s. a. u. - glaubte in israelischen Kibuzzim sogar nachgewiesen zu haben, dass Kinder auch ohne durchgehend zur Verfügung stehende Bezugsperson Urvertrauen entwickeln können, wenn sie mit Altersgefährten zusammenleben.
Bowlbys Mitarbeiterin Mary Ainsworth (1913-1999) erstellte aufgrund seiner und ihrer Beobachtungen anhand des unten beschriebenen, berühmt gewordenen Experiments folgende Bindungstypen:
|
Die vier Bindungstypen nach Mary Ainsworth: |
|
| Typ I: Sichere Bindung |
Die Kinder haben Zuversicht in die Verfügbarkeit der Bezugsperson, Bindungs- und Explorationsverhalten stehen in Balance zueinander. (Secure Attachment) |
| Typ II: Unsicher-vermeidende Bindung |
Die Kinder scheinen kaum unter der Trennung zu leiden (Pseudounabhängigkeit), das Explorationsverhalten dominiert das Bindungsverhalten. (Avoidant Attachment) |
| Typ III: Unsicher-ambivalente Bindung |
Die Kinder leiden unter der Trennung, ein klammernd-aggressives Bindungsverhalten dominiert das Explorationsverhalten. (Ambivalent Attachment) |
| Typ IV: Desorganisierte Bindung |
Die Kinder verhalten sich widersprüchlich oder erstarren bzw. zeigen kein eindeutiges Bindungs- oder Explorationsverhalten. (Disorganized Attachment) |
Ex: Ainsworth entwarf für ihre Forschungen, die die Regulation von Nähe vs. Distanz zu der Bezugsperson bzw. das Verhältnis von Bindungs- (z. b. Weinen, Klammern, Nachfolgen) vs. Explorationsverhalten (Wegbewegen, Erkunden der Umwelt) des Kindes untersuchten, die so genannte „Fremde Situation“ (vgl. folgendes Video):
| In einem standardisierten Setting von 8 ca. dreiminütigen Abschnitten betritt das beobachtete, ca. einjährige Kind in Stadium I mit seiner Mutter (damals zu fast 100% die Bezugsperson Nr.1) ein Zimmer und spielt in ihrer Anwesenheit, aber ohne ihr Zutun (Stadium II). In Stadium III betritt eine fremde Person das Zimmer und nimmt Kontakt zu Mutter und Kind auf. In Stadium IV verlässt die Mutter das Zimmer und lässt ihr Kind zurück, um das sich nun die fremde Person kümmert. In Stadium V kehrt sie wieder, die fremde Person geht. In Stadium VI wird das Kind von beiden Personen allein gelassen. Stadium VII: nur die fremde Person betritt das Zimmer und nimmt Kontakt zum Kind auf. In Stadium VIII kommt die Mutter erneut zurück, die fremde Person verlässt den Raum. |
Registriert werden im Zuge dieser Vorgänge die Verhaltensanteile des Kindes, die im Zusammenhang mit der Bezugsperson stehen bzw. jene, die der Umwelt zugewandt sind. (Man hatte erwartet, dass in Anwesenheit der Mütter das Explorationsverhalten, in ihrer Abwesenheit das Bindungsverhalten dominieren würde. Dies trifft jedoch nur für Typ I zu.)
Ainsworth beobachtete darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen den Bindungstypen und einem überproportional häufig auftretenden Verhalten der Mütter: Bei Typ I verhielten sie sich unter Ceteris-paribus-Bedingungen situationsangemessen, bei Typ II ihren Kindern gegenüber abwehrend-distanziert, bei Typ III inkonsequent und nicht konstant und bei Typ IV Angst auslösend oder selbst ängstlich. Es erübrigt sich festzuhalten, dass eine sichere Bindung einer der wichtigsten Resilienzfaktoren - s. u. - für das spätere Leben darstellt.
Ein anderes bekannt gewordenes Ex. von Harry Frederick Harlow (1905-1981; den ursprünglich zweiten Vornamen Israel ersetzte er 1930 wegen des Antisemitismus in den USA) erforschte das Bindungsverhalten von Rhesus-Affen: Harlow wies nach, dass mutterlos aufwachsende Äffchen von zwei aus Draht nachgebildeten „Müttern“ jene, die mit Stoff bespannt und weich war, bevorzugten, auch dann, wenn nur die andere Milch spendete (diese wurde dann ausschließlich zur Nahrungsaufnahme besucht). Aufgrund eines zweiten Exs. postulierte er, dass soziale Bindungen für die emotionale Entwicklung wichtig seien (wofür er von Bowlby gelobt wurde): Äffchen, die er isoliert aufwachsen ließ, waren tendenziell verhaltensgestört, solche, die alleine bei ihrer Mutter aufwuchsen, waren ängstlich und solche, die mit Mutter und Spielgefährten aufwuchsen, entwickelten sich einigermaßen normal.
Die Ergebnisse der modernen Hirnforschung in Bezug auf die frühkindliche Bindung bzw. die Entwicklung allgemein betonen die Tatsache, dass durch die vorgegebenen Gene der Mensch nicht vorprogrammiert ist, sondern epigenetisch (s. u.) bzw. aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns (s. u.) erst geformt werden muss. Kinder benötigen dazu (in einer möglich stressfreien Umgebung) unumgänglich Eltern (bzw. Bezugspersonen), die ihre Gefühle und Bedürfnisse erkennen, richtig deuten und - individuallagenadäquat - als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die menschliche Selbstwerdung gelingt nur im frühen Wechselspiel mit Bezugspersonen - oder eben nicht. Im Prinzip gehe es nach Joachim Bauer (*1951) darum, dass das noch nicht zu einem Selbst fähige, da aufgrund des frühen Geburtstermins unterentwickelte Gehirn eines Babys zunächst seine Bezugspersonen wie eine externe Festplatte dazu „benutze“, um über Resonanz (Begriff von Hartmut Rosa, *1965, als Gegenbegriff zu „Entfremdung“ geprägt: ein über Spiegelneuronen - s. o. - funktionierendes „Mitschwingen“, das im Unterschied zu einem Echo beide Seiten verändere; es beinhalte einfühlende Wahrnehmung und stimmige Beantwortung) sein Ich zu bilden bzw. gebildet zu bekommen (da es sich von selbst nicht bilden könne). Die Reaktionen in den ersten 24 Monaten, einer extrem sensiblen und störanfälligen Phase, sollen geduldig, zeitnah und dyadisch (in einer 1:1-Situation) sein, um eine gute Bindung zu erzielen. „Die stärkste Droge für den Menschen ist der andere Mensch.“
Eine große Gefahr, dass diese Vorgänge nicht ausreichend zustande kommen könnten, bestehe laut Bauer darin, dass Eltern ihre Fürsorgepflichten zu früh an oft nicht an wissenschaftlichen Kriterien orientierte Betreuungseinrichtungen mit völlig unzureichendem Betreuungsschlüssel (der für diese Altersstufe bei 1:2, höchstens 1:3 liegen sollte) delegieren oder sich selbst durch digitale Endgeräte substituieren. Dadurch fehle gemeinsame Zeit, den „unausgesprochenen Auftrag“ des Kindes zu erfüllen: „Lass mich - durch die Resonanz, die ich von dir erhalte - spüren, dass ich existiere. Zeige mir durch die Art, wie du auf mich reagierst, wer ich bin. Zeige mir durch die Art, wie du auf meine Emotionen reagierst, wie man Gefühle auslebt und mit Affekten umgeht. Zeige mir durch die Art, wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du mit dir umgehen lässt, was es heißt, Mitmensch zu sein. Lehre mich, was man mit alledem, was die materielle Welt ausmacht, anstellen kann - oder nicht anstellen sollte. Schließlich: Lass mich sehen, wie ich Dinge, die mir zur Verfügung stehen, spielerisch und kreativ einsetzen kann.“ (Zitat aus Joachim Bauer, *1951, Wie wir werden, wer wir sind. München 22019, S. 63)
Es gilt inzwischen als unumstrittene wissenschaftliche Erkenntnis, dass Versäumnisse und Störungen in den ersten drei (bis sechs) Lebensjahren, vor allem Vernachlässigung und erlittene oder beobachtete Gewalterfahrung, den Lebensverlauf dauerhaft zu (zer)stören imstande sind. Ungesunder Stress und traumatische Erfahrungen scheinen nach neueren Erkenntnissen das Gehirn (und andere physische Bereiche) sich zwar rascher entwickeln zu lassen, aber auch seine Plastizität (s. u.) zu bremsen. Die Hypothek, mit der solche Kinder ihre weitere Entwicklung bestreiten müssen, erweist sich (zu) oft als überfordernd. Die statistische Wahrscheinlichkeit, später selbst deviantes Verhalten oder psychische Instabilität zu zeigen - also das zu wiederholen, was man selbst erlebt hat - ist gegenüber gut betreuten und ruhig aufwachsenden Kindern deutlich erhöht. (Analog dazu hat der Ökonom James J. Heckman, *1944; Wirtschaftsnobelpreis 2000, 2006 nachgewiesen, dass Bildungsinvestitionen ausschließlich in Kinderbetreuungseinrichtungen bis zum frühen Schulalter einen Return of investment bringen.)
Vgl. zu diesem Thema auch das folgende Interview mit Nicole Strüber (*1979?) und die Vorträge zu „Geist-Genom-Gehirn-Gesellschaft“.
- 2;6 bis 5;6: Kleinkindalter:
* Ordnungsprinzip der dritten Phase: Kennenlernen immer neuer
(nicht mehr als unverbunden nebeneinander stehend erlebten) Einzelheiten der Welt und ihrer Beziehung zueinander bzw. zur erkennenden Person.
In dieser Phase werden Kinder laut Maria Montessori
(s. a. u.) „vom unbewussten
Schöpfer zum bewussten Arbeiter“.
Ding 1 ⟺ Ding 2
⟺
Ding 3
⟺
Ding 4
⟺ Ding n |
Abb. 2/5: Ordnungsprinzip 3. Phase
* Physische und motorische Entwicklung: Der erste Gestaltwandel beginnt: die Körperproportionen (das Verhältnis Kopf / Gesamtlänge beträgt bei Neugeborenen 1:4, bei Erwachsenen 1:8) verändern sich, der Zahnwechsel steht an. Die Bewegungsabläufe werden immer sicherer und „runder“. Im Bereich des Sports und des Erlernens eines Musikinstruments sind am Ende dieser Phase (zumindest bei begabten Kindern) bereits koordinative Leistungen höheren Grades möglich. (Zahlreiche spätere Weltklassesportler oder Musiker haben ihre Karrieren - manchmal auf Druck ihrer überehrgeizigen „Eislaufmütter“, „Hockeymums“ oder Trainerväter - in dieser Phase begonnen.)
* Kognitive Entwicklung: Fortlaufend werden immer höhere geistige Leistungen möglich, die bereits durch unbewusstes Chunking (also das Zusammenfassen von Informationen zu größeren Einheiten, die es ermöglichen, eine ganze Struktur statt einzelner Elemente im Gedächtnis zu behalten) erzielt werden können. Die Fähigkeit zu Abstraktionsleistungen (die sich auch in der Sprache ausdrücken, z. B., wenn eine Haarbürste „Igel“ genannt wird) und dem Arbeiten mit geistigen Konzepten nimmt immer mehr zu.
* Sprache: Die Warum-Fragen lösen die Was-Fragen ab bzw. ergänzen sie („2. Fragealter“), Nebensätze (hypotaktische Fügungen), anhand deren Häufigkeit und adäquatem Gebrauch man Rückschlüsse auf die (sprachliche) Intelligenz des Kindes ziehen kann, entstehen. Oft lassen sich sprachschöpferische Tätigkeiten (Neologismen wie „übergestern“ oder „klavieren“, Übergeneralisierungen wie „ich rufte“ oder „das Radio ist eingeschalten“) beobachten. Mit 3;0 beträgt der Wortschatz meistens bereits 1000 ± x Wörter (zu schichtspezifischen Unterschieden s. u.). Der Wissenschaftssoziologe Keith Stanovich (*1950; s. u.) sieht in der Sprach- und vor allem der Leseentwicklung den Matthäus-Effekt (nach Mt. 25,29) wirken: Früh geförderte Kinder, die häufig mit Sprache konfrontiert würden, hätten auch später Vorteile, benachteiligte Kinder schleppten ihre Situation (lebens)lang mit sich. Der Unterschied zwischen guten und schlechten Lesern nehme im Laufe der Zeit zu, nicht ab (vgl. a. u. Defizithypothese). Vor allem Englisch als Fremdsprache sollte schon in dieser Altersstufe verpflichtend von guten Sprechern im Kindergarten (und erst recht später in der Volksschule) regelmäßig angeboten werden, um spätere Überforderungen zu vermeiden.
* Zeichnungen: Die Entwicklung kindlicher Zeichnungen durchläuft - beginnend in der Frühkindheit - meist folgende Phasen:
| ° | Phase des Spurschmierens (ohne Beachtung des Ergebnisses) |
| ° | Phase des Kritzelns (wenn ein Stift gehalten werden kann; wahllose Farbgebung) |
| ° | Symbolstadium, Phase der Kephalopoden (= Kopffüßler, von griech. κεφαλή und πούς; Menschendarstellung ohne Rumpf) |
| ° | Vorschemaphase (Boden- und Himmellinien erscheinen, der Detailreichtum nimmt zu, Farben werden bewusst eingesetzt, es lassen sich erste Handlungs- und Erzählstrukturen erkennen, die Unverwechselbarkeit nimmt zu, so wie auch das Bewusstsein des Kindes dafür, dass das Bild ein Kommunikationsmittel sein kann) |
| ° | Schemaphase I, naiver Realismus (Werkreife im Hinblick auf Motive und Bildorganisation ist eingetreten, „Röntgenbilder“ bilden das an sich unsichtbare Innere z. B. eines Hauses ab; die Bilder können nun auch an der inneren Realität des Kindes orientiert sein. Gemalt wird nicht, was gesehen, sondern was gewusst wird.) |
| ° | Schemaphase II, visueller Realismus (Dreidimensionalität, realistische Größenverhältnisse werden beachtet, Ironisierungen sind möglich, Bilder werden bewusst geplant) |
Kinderzeichnungen werden auch oft zu diagnostischen Zwecken im psychiatrischen bzw. therapeutischen Bereich herangezogen, z. B. im Rahmen projektiver Tests (s. o.) wie der bekannten, wenn auch umstrittenen, 1957 von Luitgard Brem-Gräser (1919-2013) entwickelten Untersuchungsmethode „Familie in Tieren“. (Art, relative Größe und Stellung des Gezeichneten zueinander werden als Grundlage von Interpretationen benutzt.)
* Moralentwicklung: Am (vor) Beginn dieser Phase entsteht des Ich-Bewusstsein, meist verknüpft mit dem Gedächtnis (und der Ausprägung der Händigkeit; die erste bewusste Erinnerung tritt meist vor / am Beginn dieser Phase auf). Damit kann sich das Kind als Urheber eigener Handlungen erkennen, was die Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung und dem Entstehen von „schlechtem Gewissen“ (s. a. u.) ist. Dieses Entstehen einer Selbstwirksamkeitserwartung (engl. perceived self-efficacy, zuerst beschrieben vom gebürtigen Kanadier Albert Bandura, 1925-2021, in den 1970er Jahren; s. a. u.) bzw. einer internalen Kontrollüberzeugung („die Welt wird auch von mir und nicht ausschließlich von externen Faktoren beeinflusst“) ist für eine gesunde psychische Entwicklung unumgänglich (s. a. u.). Können wird als begrenzt von Wollen und Sollen erlebt.
Voraussetzung für jede Art von moralischem Empfinden ist die Möglichkeit, auch anders gehandelt haben zu können. Dasselbe gilt für Lügen (die bewusste Äußerung von Unwahrheiten), die in dieser Phase möglich werden. (Davon zu unterscheiden sind spielerische Behauptungen ohne Nachweis. Analog dem Teekannenbeispiel von Bertrand Russell, 1872-1970, liegt dabei die Beweislast immer bei der Person, die empirisch nicht Widerlegbares postuliert: Wer behauptet, dass eine kleine, für Teleskope nicht sichtbare Teekanne permanent die Sonne umkreist, kann nicht erwarten, dass ihm geglaubt wird.)
3. Identitätsstufe nach Erikson: Initiative vs. Schuldgefühl (je nachdem, wie Eltern auf die Eigeninitiative des Kindes, das die Umwelt immer weiter gehend erkunden und eigene Erfahrungen machen soll, reagieren).
Die erste der drei Moralstadien nach Lawrence Kohlberg (1927-Suizid 1987), der mit der Präsentation moralischer Dilemmata (bekannt wurde das Heinz-Dilemma: Darf Heinz in die einzig in Frage kommende Apotheke einbrechen, um ein lebensnotwendiges Medikament für seine todkranke Frau zu stehlen, wenn dort für die Arznei unverhandelbar ein unverschämt hoher Preis verlangt wird, den er nicht zahlen kann?) arbeitete, fällt in dieses Alter und wird präkonventionelle Phase genannt und dauert bis ca. 10;0. Sie ist noch eine reine Strafvermeidungsmoral, vice versa werden Belohnungen angestrebt. Die Grundhaltung entwickelt sich zu einem naiven instrumentellen Hedonismus. (Loyalität entsteht aus dem Bedürfnis, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.) Die folgende Übersicht zeigt alle sechs möglichen, immer und in allen Kulturen in gleicher Reihenfolge auftretenden zunehmend komplexeren Stufen der moralischen Entwicklung im Laue des Lebens, wobei man gleichzeitig jeweils immer nur auf einer stehen kann:
|
Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg |
|
| Phase I: Präkonventionelles Stadium |
Stufe 1: Orientierung an
Strafe und Gehorsam Stufe 2: Orientierung an Kosten-Nutzen- und Reziprozitäts-Überlegungen. Dauer: etwa bis zum Ende der Volksschulzeit |
| Phase II: Konventionelles Stadium |
Stufe 3: Orientierung an
wechselseitigen zwischenmenschlichen Erwatungen, Beziehungen und
zwischenmenschlicher Übereinstimmung („Goldene Regel“) Stufe 4: Orientierung am sozialen System und am Gewissen („Recht und Ordnung“) Dauer: etwa bis zum Ende der Sekundarstufe I |
| Phase III: Postkonventionelles Stadium |
Stufe 5: Orientierung am
sozialen Vertrag oder an individuellen Rechten Stufe 6: Orientierung an universellen ethischen Prinzipien. Dauer: Dieses Stadium endet nie (wird allerdings auch selten erreicht). |
Vgl. Übersicht und 10min-Quiz zu den Moralphasen
* Erziehungsmittel: Erfolgreiche Erziehung erfolgt immer durch Beziehung. Trotzdem stellt sich spätestens in dieser Phase, in Wahrheit aber bereits zu jenem Zeitpunkt, ab dem ein Kind „böse“ oder „unrecht“ handeln kann, also immer dann, wenn es auch eine andere Variante des Verhaltens bewusst zur Verfügung gehabt hätte, die Frage nach Lohn und Strafe (die in Wahrheit nur zwei Seiten derselben Medaille sind). Aus grundsätzlichen pädagogischen Überlegungen sollte beides keinen Platz in der Interaktion mit Kindern haben, da kein innerer Zusammenhang zwischen Tat und Folge besteht und falsche Motive evoziert werden.
Es gibt drei mögliche Szenarien nach dem Setzen einer Strafe: das Kind ändert sein Verhalten nicht, das Kind ändert sein Verhalten, weil es nicht nochmals bestraft werden möchte, oder das Kind ändert sein Verhalten aus Einsicht, die es durch die Strafe gewonnen hat. Im ersten Fall war die Strafe sinnlos, im zweiten Fall wird das Ziel aus den falschen Gründen erreicht (Angst statt Einsicht) und im dritten Fall hätte man das erwünschte Ergebnis auch ohne Strafe (womöglich nachhaltiger) erzielt. Den Wert der Strafe bestimmt also der Bestrafte und nicht der Erzieher. Besonders sinnlos sind Strafen (und Belohnungen) dort, wo Kinder noch gar keine Einsicht haben können.
Von Lohn und Strafe strikt zu unterscheiden sind einerseits Lob und Tadel, da sie sich nicht wie Lohn und Strafe (und Dressur; s. u.) an niedere Instinkte, sondern situationsadäquat an die Vernunft des Kindes richten, und andererseits Sanktionen, die aus den natürlichen Folgen des Handelns des Kindes resultieren (und durchaus strafoid wirken können), da diese sehr wohl einen Zusammenhang mit dem Verhalten aufweisen.
* Sozialentwicklung: Am Beginn der Phase erfolgt im sogenannten Trotzalter ein erster Abgrenzungsversuch von den Eltern. Wenn sich das Verhalten nicht ändert, spricht man von fixiertem Trotz. Weitere Themen sind soziale Beziehungen außerhalb der Familie (Kindergarten) und allmählich das Erkennen und Be- (Ver)handeln unterschiedlicher Interessen von Eltern und Kindern. Dabei (und auch sonst) auf kurzfristige Vorteile verzichten zu können ist Voraussetzung für späteres kooperatives Sozialverhalten. (Diese Fähigkeit, sich - wie Spitzer formuliert - in seinen Handlungen „von der Unmittelbarkeit des Augenblicks“ lösen zu können, ist von der Reifung des orbitofrontalen Kortex abhängig.) Eine viel diskutierte Rolle spielen (nicht nur in dieser Phase) Vorbilder (Menschen, an denen man sich - aus welchen Gründen immer - orientiert). Jesper Juul (1948-2019): „Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun.“ (C. G. Jung, 1875-1961; s. a. u., wies schon 1942 in einem Vortrag darauf hin, dass „nicht das wirkt, was der Erzieher mit dem Mund lehrt, sondern nur das, was er ist“.) - Zum Einfluss anderer bzw. von Medien (Modelllernen) s. u.
Bekannt wurde das Belohnungsaufschubparadigma (delay of gratification) durch die von Walter Mischel (geboren in Wien; 1930-2018) in den 60er-Jahren an der Stanford University in den USA durchführten Marshmellow-Exe.:
| Der Versuchsleiter bietet einer Vpn. (einem Kind im Vorschulalter) ein Marshmellow an und verspricht unter der Bedingung, dass dieses nicht sofort aufgegessen wird, sondern erst dann, wenn der Vl., der für zehn bis fünfzehn Minuten den Raum verlässt, wieder erscheint, ein zweites. Man kann nun in den diese kurze Zeit abbildenden Videos beobachten, wie manche Kinder dem Impuls, die Belohnung sofort zu konsumieren, nicht widerstehen können, sich andere hingegen (zum Teil unter deutlich erkennbarer Anspannung, z. B. indem sie zur Seite blicken oder, wie sie später erzählen, sich die Süßigkeit gemalt vorstellen) den Zugriff verbieten und erst nach Rückkehr des Vl.s zu essen beginnen. |
Wie Nachuntersuchungen Jahrzehnte später ergaben, habe, wer mit ca. 4 Jahren eher in der Lage sei, Impulse zu unterdrücken (also in diesem Fall die Belohnung bzw. die Triebbefriedigung länger aufzuschieben), eine höhere Chance, lange Jahre danach frustrationstolerant und erfolgreich zu sein als „Low delayer“: Familiäres bzw. berufliches Glück wurden von diesen Kindern statistisch signifikant öfter erreicht, Grit (Entschlossenheit, die Fähigkeit zum beharrlichen Verfolgen langfristiger Ziele, Charakterfestigkeit) war stärker ausgeprägt. Es gebe aber keinen diesbezüglichen Automatismus. (Vgl. folgendes Video-Interview mit Mischel.) Auch Jerome Kagan (1920-2021) zeigte in Langzeitstudien (seine Lebensdauer prädestinierte ihn für solche), dass Temperamente über die Biographien hinweg erstaunlich stabil sind.
Gefahren für eine gesunde Sozialentwicklung drohen dann, wenn die oben angesprochenen sozialen Beziehungen nicht durch ausreichend vorhandene Lernfelder eingeübt werden können. Das Auslesen von Mimik, Gestik, Sprachmelodie und anderen Ausdruckselementen einer Person muss anhand Tausender Fälle erlernt werden, um später Personen und Situationen richtig einschätzen zu können. Wenn soziale Beziehungen zunehmend durch digitale Transaktionen ersetzt werden, findet kein realer Austausch, sondern (nach Rushkoff; s. u.) nur einer von Symbolsystemen statt. Die Folge davon ist, dass mit zukünftigen Fehlurteilen und Gefühlsfehlentwicklungen gerechnet werden muss. (Es ist nun einmal nicht dasselbe, Emotionen auf einem Bildschirm durch sogenannte Influencer oder Schauspieler vorgeführt zu bekommen oder sie tatsächlich in spontanen Reaktionen zu erleben.)
* Spiel und Sport: Das kindliche Spiel nimmt im Rahmen der Entwicklung als Medium des Lernens einen wichtigen Stellenwert ein. Kinder spielen zunächst allein, dann nebeneinander, dann miteinander. Unter „Spiel“ wird jene Beschäftigung verstanden, die der Mensch von sich aus beginnt und fortführt (sonst wäre es Ernst). Das Spiel ist zweckfrei und zwanglos und soll Vergnügen und Entspannung bereiten. Es ist - philosophisch-anthropologisch betrachtet - eine von zwei möglichen Weltaneignungen (Homo ludens versus Homo faber). „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (Friedrich Schiller, 1759-1804, im 15. Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen).
Als verwandtes Phänomen hat auch der Sport entwicklungspsychologische Aspekte, indem er Kindern und Jugendlichen Disziplin, Fairness, Charakterbildung, Ausdauer, Selbstwahrnehmung, Sozialverhalten etc. abverlangt.
Wesensmerkmale von Spielen bzw. Wettkämpfen bestehen in einer gewissen konzentrationsfördernden Abgeschiedenheit (Spiel und Sport sind zeitlich und räumlich beschränkt), die es nicht zulässt, gleichzeitig anderen Tätigkeiten nachzugehen, bzw. - im Unterschied zum Leben - darin, immer wieder eine neue Chance geboten zu bekommen, wenn man verloren hat. (Letzteres ist bei Nullsummenspielen möglich, in denen der Verlust der einen Partei gleichzeitig der Gewinn der anderen ist; z. B. Basketball.) Man unterscheidet folgende
Formen des kindlichen Spiels:
| ° | Funktionsspiel: spontane, sensumotorische Bewegungsspiele, die - körperbezogen, dann gegenstandsbezogen - schon in der 1. Lebensphase möglich sind |
| ° | Konstruktionsspiel: exploratives Zerlegen und zielgerichtetes Herstellen neuer Strukturen aus gegebenen Materialien; schult die Handlungsplanung |
| ° | Rollenspiel (Phantasiespiel): symbolisches „So-tun-als-ob-Spiel“, das das Einnehmen anderer Perspektiven schult und auftritt, wenn die Realitätsebene verlassen werden kann (vgl. a. u. theory of mind) |
| ° | Regelspiel: setzt gewisse soziale und kognitive Fähigkeiten voraus. Als Nullsummenspiel erzeugt es Gewinner auf Kosten von Verlierern, als Kooperationsspiel gewinnen oder verlieren (wie im Leben) alle Teilnehmer gemeinsam. |
| ° | Informationsspiel: meist im Zusammenhang mit Bildung und Schule gebrauchte, nicht zweckfreie Methode, Wissen zu fördern und Lernen zu unterstützen (z. B. Quiz) |
| ° | Bewegungsspiel: zweckfrei (auch allein) oder als sportlicher Wettkampf: hier ist der Verlust des/der einen immer der Gewinn des/der anderen - die Summe also (wie bei den meisten Regelspielen) Null. |
Gerald Hüther (*1951) und Christoph Quarch (*1964) unterscheiden in ihrem 2016 im Hanser-Verlag erschienenen Buch Rettet das Spiel die fünf Formen Geschicklichkeitsspiel / Wettkampfspiel / Schauspiel / Glückspiel / Kultspiel.
Einer der ersten Psychologen, der sich - indem er Kinder als Lehrlinge, die einen Meister brauchen, und nicht wie Piaget als Wissenschaftler betrachtete - mit der Rolle des Spiels bei der Entwicklung höherer psychischer Funktionen (vgl. hier) befasste, war 1933 der Weißrusse Lew Semjonowitsch Wygotski (Лев Семёнович Выготский, 1896-1934), ein Vertreter des soziokulturellen Ansatzes, der auch als einer der ersten den Begriff Internalisierung verwendete und für eine integrative Beschulung von Kindern mit „Defekten“ eintrat, da das soziale Umfeld deren einzige Chance zur Menschwerdung sei und man immer das Entwicklungspotential vor dem aktuellen Entwicklungszustand berücksichtigen müsse. Melanie Klein geb. Reizes (1882-1960) hat das Spiel in einer von ihr entwickelten Therapieform zur Analyse kleiner Kinder (auch unter 6 Jahren; s. u.) eingesetzt.
Die Frage, ob sich das kindliche Spiel geschlechterspezifisch unterscheidet (was in der Praxis - ungeachtet der Ursachen - aufgrund der Empirie offensichtlich ist), ist in die weiter reichende Frage zu integrieren, ob sich überhaupt geschlechterspezifische Differenzen im Verhalten ausfindig machen lassen (anatomisch lässt sich ohne Information über seinen Träger trotz statistischer Unterschiede mit herkömmlichen Methoden nicht eindeutig entscheiden, ob ein Gehirn männlich oder weiblich ist; s. a. o.) bzw. ob Eltern ihre Kinder (bewusst oder unbewusst) geschlechterspezifisch unterschiedlich behandeln, indem sie ihnen z. B. unterschiedliche Spielsachen zur Verfügung stellen. Phyllis A. Katz (*1938) u. a. wiesen 1975 genau das in ihrem Baby X-Experiment nach, in dem sich Vpn. in einem Spielzimmer mit einem wenige Monate alten Baby beschäftigen sollten. Sie wussten nicht, dass das von ihnen vermutete Geschlecht gar nicht zutraf. In überzufälliger Häufigkeit wurden vermeintlichen Buben Bälle, vermeintlichen Mädchen Puppen angeboten, ohne dass sich die Vpn. dieses Verhaltens bewusst waren. Eltern verstärken also eine möglicherweise vorhandene kongenitale Disposition.
- 5;6 bis 8;6: Phase der Schulfähigkeit:
* Ordnungsprinzip der vierten Phase: Wenn eine
Aufgabe
als Aufgabe erkannt und bewusst erfüllt werden kann, liegt Schulfähigkeit vor. Voraussetzung dafür
ist, dass Anfang und Ende
einer Handlung aufeinander bezogen werden können, sodass das Kind nicht nur im, sondern auch
über dem Zeitablauf steht. Die Zukunftsfähigkeit beginnt erst in dieser Phase
und ist Voraussetzung der Schulreife. - Zur Rolle von Lehrpersonen
s. u.
Akt Akt
=========================================> Zeit |
Abb. 2/6: Ordnungsprinzip 4. Phase
Die Reife eines Kindes lässt sich u. a. am selbst gewählten Anspruchsniveau (Aspirationsniveau; Begriff von Kurt Tsadek Lewin, 1890-1947, s. u.) erkennen, wenn es z. B. im Ex. aus mehreren unterschiedlich schweren Gewichten jenes auswählen soll, das es gerade noch zu heben imstande ist. (Unreife Kinder wählen oft völlig unrealistisch viel zu schwere oder auch lächerlich leichte Gewichte. Wer sich nicht oder nur knapp verschätzt, weiß seine Fähigkeiten gut einzuordnen und wird daher keine Schwierigkeiten haben, die Anforderungen einer für ihn/sie neuen Institution - der Schule - zu meistern.) Meist steigern Erfolge bzw. senken Misserfolge das Aspirationsniveau.
In Bezug auf den Schuleintritt (und später auch den Übertritt in die Sekundarstufe 1) sind vor allem die Bereiche Selbstständigkeit und Arbeitstempo jene, die die Kinder am ehesten über- oder unterfordern. Das Binetarium (s. u.) sollte schon am Beginn des 20. Jhdts. dazu dienen, Vorschulkindern Prognosen über deren zukünftigen Schulerfolg auf Grundlage ihrer Intelligenz zu erstellen. Die ebenfalls lange verwendete, eher populärwissenschaftliche Methode, das Kind mit seinem Arm über den Scheitelpunkt des Kopfes das gegenüberliegende Ohr berühren zu lassen, rekurriert auf die sich während der Reifung verändernden Körperproportionen (s. o.).
4. Identitätsstufe nach Erikson: Werksinn, Leistung vs. Minderwertigkeitsgefühl (je nachdem, ob Kinder ihre „Arbeit“ als positiven Beitrag erleben können oder Erfolgserlebnisse, die die Bezugspersonen zulassen bzw. ermöglichen und wertschätzen sollen, ausbleiben)
* Physische und motorische Entwicklung: Sowohl Grob- wie Feinmotorik entwickeln sich weiter, bis auch die Bewegungen des Bälle-Fangens, Laufens, Kletterns, Tennisspielens, Skifahrens, Balancierens, Schreibens etc. flüssig vonstatten gehen. In der Volksschulzeit erfolgt die 2. Dentition (der Wechsel auf das 32zahnige Erwachsenengebiss).
* Sprache und Lesen: Es werden immer öfter Passivsätze gebildet, der Wortschatz erweitert sich ständig. (Der diesbezügliche Höhepunkt liegt nach begründeten Schätzungen vermutlich erst zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr!) Das Prinzip der (bis auf die onomatopoetischen Wörter) willkürlichen Zuordnung von Lautbild und außersprachlicher Wirklichkeit (s. a. u.) kann gegen Ende dieser Phase allmählich auch intellektuell verstanden werden.
In den Beginn dieser Phase fällt auch das Erlernen des Lesens, unterstützt z. B. nach der von Carol Doris Chomsky, geb. Schatz (1930-2008; Ehefrau von Noam Chomsky - s. o.) entwickelten Repeated reading-Methode: Dabei liest das Kind zunächst einen Text einige Male still mit, während ihn gleichzeitig eine Tonaufnahme laut vorliest. Danach liest das Kind selbst vor. Diesbezügliche Ex.e weisen nach, dass die Vorlesegeläufigkeit durch dieses Verfahren deutlich gesteigert werden kann. (Zum Lesen s. a. u.)
* Moral- und Sozialentwicklung: Im Laufe der Kindheit (nicht nur in dieser Phase) erfolgt die Übernahme von gewissen Lebens- und Moralauffassungen, mit denen das Kind durch andere (v. a. die Eltern) bekannt gemacht wird (Internalisierung). Diese prägungsähnlichen Vorgänge sind sehr stabil und später auch bei rational gegenteiliger Einsicht schwer zu verändern. Voraussetzung für die Beurteilung von Handlungen (eigener und fremder) ist die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivübernahme (vgl. a. u. Theory of mind).
- 8;6 bis 10;0: Reife Kindheit:
* Ordnungsprinzip der fünften Phase: Verstehen der
Differenz zwischen Sittlichkeit und Sachlichkeit. Das Kind erkennt den Unterschied
zwischen Gut und Böse (Instanz: Gewissen) und Wahr und Falsch (Instanz:
Wissen).
Damit verbunden ist das allmähliche Aufbrechen der Einheit von Innenwelt und
Außenwelt, das ein Kind zu einem Jugendlichen macht. Allerdings versteht nicht jeder Mensch (auch nicht in höherem Alter), dass man
Tatsachen und Meinungen auseinanderhalten kann (und muss) bzw. dass zwar jede/r
ein Recht auf die eigene Meinung, aber niemand ein Recht auf eigene Tatsachen
hat. Fragen
nach einem letzten Prinzip tauchen auf. In dieser Phase können Kinder außerdem
erkennen, dass der Tod nicht ohne Ursache erfolgt, alle betrifft und mit einem
irreversiblen Verlust aller körperlichen Funktionen einhergeht.
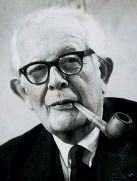 Abb. 2/7: Jean
Piaget
Abb. 2/7: Jean
Piaget
* Kognitive Entwicklung: Der Schweizer Kinderpsychologe Jean Piaget (1896-1980; s. a. u.: Phasen der Denkentwicklung) untersuchte (tw. schon in früheren Entwicklungsphasen) mit Invarianzaufgaben (Erhaltungsaufgaben) das Kausalverständnis. Dabei geht es darum, dass je nach Intelligenzniveau in unterschiedlichem Ausmaß verstanden wird, dass die Gesamtmenge (-größe) eines Elements (z. B. einer auf dem Tisch liegende Tafel Schokolade) invariant bleibt, wenn seine Anordnung oder Erscheinungsform verändert wird (z. B. dadurch, dass sie - in kleine Teile zerbrochen - über eine viel größere Fläche verteilt ausgelegt wird). Die Invarianz (vgl. hier S. 109) von Anzahl / Substanz / Länge / Fläche / Gewicht / Volumen wird nicht nur unterschiedlich gut, sondern auch unterschiedlich früh verstanden (die Invarianz des Volumens oft erst mit 14;0). Piaget untersuchte auch (auf frühere Phasen bezogen), ab welchem Alter ein Kind erkennt, dass ein z. B. durch ein Tuch abgedecktes Objekt trotzdem vorhanden ist, und prägte in diesem Zusammenhang den Begriff Objektpermanenz (s. a. u.).
Auch Piaget unterscheidet (wie Kohlberg; s. o.; zu den Unterschieden s. hier) nach der Beobachtung des Regelverständnisses und des Grades der Regelbeachtung bei Kindern drei Moralphasen:
|
Moralphasen nach Jean Piaget |
|
| Phase I: Moralischer Realismus |
Das Kind orientiert sich egozentrisch an den Folgen seiner Handlungen. Sind sie negativ, werden sie für verboten, sind sie positiv oder neutral, werden sie für erlaubt gehalten. (Beginn im Kleinkindalter nach Ende der amoralischen Phase der Frühkindheit) |
| Phase II: Heteronome Moral |
Das Kind orientiert sich an Autoritäten, deren Regeln für unveränderbar gehalten werden. Was diese gutheißen, wird als erlaubt, was sie missbilligen, als verboten akzeptiert. (Beginn vor der Volksschulzeit) |
| Phase III: Autonome Moral |
Das Kind orientiert sich an eigenen Überlegungen, die unabhängig von anderen angestellt werden. Erlaubt ist etwas dann, wenn gute Argumente dafür sprechen. Regeln gelten als Produkt sozialer Interaktion und damit als veränderbar. Absichten werden in die Beurteilung miteinbezogen. Laut Piaget erreichen alle diese Phase. (Beginn etwa ab 13, 14 Jahren) |
Vgl. Piaget (Entwicklungsdiagnostik), eine Seite der Piaget-Gesellschaft und die Piaget-Archive der Genfer Universität
- 10;0 bis 13;0: Vorpubertät:
* Ordnungsprinzip der sechsten Phase: Erlernen
des kritischen Stellungnehmens und Wertens. Erste, noch unsystematische Versuche
sind nicht
nur als Abgrenzung, sondern auch als (nach dem Trotzalter) zweiter Ablösungsversuch von
den Eltern zu verstehen. Sie dienen dem Erlernen des logisch aufgebauten Argumentierens
in der
Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. Valide Bewertungen können vor dieser Phase
schon deshalb nicht vorgenommen werden, weil die Myelinisierung (s. o.) den dafür notwendigen
orbitofrontalen Kortex als letzten Hirnteil erst jetzt zu erreichen beginnt. Die
„Werteerziehung“, die es im engeren Wortsinn gar nicht geben kann, erfolgt dabei
automatisch durch das Handeln in der Mitwelt und der Verarbeitung von deren
Rückmeldungen. „Ethik verhält sich zum richtigen Tun wie Grammatik zu richtigem
Sprechern“ (Spitzer), man lernt
sie durch Anwendungsbeispiele anhand der mentalen Repräsentationen, die
Vorbilder, Eltern, Erzieher und eine möglichst vielfältige Umwelt hinterlassen.
Nach Absolvierung dieser Entwicklungsphase sollte man bewusst darüber nachdenken
können.
* Moral: Das zweite Moralstadium nach Kohlberg wird erreicht: die konventionelle Phase (eine altruistische, aber noch heteronome und mehrheitskonforme Moral, die sich mit zunehmender Abstraktionsfähigkeit von der Orientierung am eigenen Ideal und der „Goldenen Regel“ der Lutherbibel - „Was du wilt, das man dir thue / das thu einem andern auch“ - zum Einhalten von Gesetz und Ordnung entwickelt). Vgl. Übersicht und Quiz zu den einzelnen Phasen
* Körperliche Entwicklung: Der zweite Gestaltwandel bewirkt (bei Knaben später als bei Mädchen) durch das voranschreitende Längenwachstum eine weitere Veränderung der Proportionen und eine Verlagerung des Körperschwerpunkts, was zu vorübergehenden koordinativen Schwierigkeiten führen kann. Am Phasenende (bei Mädchen zunehmend am Anfang) tritt die Geschlechtsreife ein, wobei Akzeleration (körperliche oder psychische Entwicklungsbeschleunigung, Vorverschiebung der sexuellen Reife) zu beobachten ist: Um 1850 setzte die Menarche durchschnittlich mit 17 Jahren ein (in früheren Jahrhunderten allerdings viel früher), 2020 oft schon mit 10-12 Jahren. (Die Ursachen dafür sieht man einerseits in den zunehmend besseren Lebensbedingungen, andererseits im Bewegungsmangel, da der durch Übergewicht im Fettgewebe entstehende Botenstoff Leptin die Pubertät vorantreibt.) Die durchschnittliche Körpergröße nahm in Österreich (ohne dass sich die genetische Ausstattung maßgeblich verändert hätte) seit 1900 um 10 cm zu. (Zum genetischen Einfluss auf die Körpergröße s. hier)
* Sprache: Zu beobachten sind eine schicht- und bildungsabhängige Zunahme abstrakter Begriffe und komplizierter Satzkonstruktionen (vor allem auch im schriftlichen Bereich) sowie eine zunehmende Beherrschung von Fremdsprachen.
- 13;0 bis 17;0: Pubertät:
* Ordnungsprinzip der siebenten Phase: Frage nach dem
Maßstab des Wertens und dem Logos der Psyche. Das unsystematische, emotionelle
Argumentieren wird systematisiert und in einen Wertekatalog eingebettet. Sinnfragen
entstehen. (Deren inadäquate Behandlung birgt die Gefahr, Sekten oder
Verschwörungstheoretikern zu verfallen bzw. Drogen als mögliche Antworten
misszuverstehen.)
* Physische Entwicklung: Der Abschluss der körperlichen Entwicklung zeigt sich z. B. im Längenwachstum, der vollen Ausprägung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale und dem zweiten Gebiss. (Der Zahnwechsel beginnt bereits in der Volksschule und endet mit den Weisheitszähnen). Planmäßige, biologisch bedingte und unvermeidbare Gehirnveränderungen betreffen die Zunahme der Aktivität im medialen, präfrontalen Kortex, die sich erst entwickeln muss, wodurch Teenager risikofreudiger als Inhaber einer „Erwachsenenweltsicht“ sind, weil sie Konsequenzen erst abschätzen lernen müssen. Die in dieser Phase erfolgende Umstrukturierung des Gehirns lässt äußere Einflüsse auf das ZNS (Drogen) in dieser Phase besonders schädlich erscheinen. Erst nach der Myelinisierung der entsprechenden Gehirnpartien können vernünftige Bewertungen und reflektiertes ethisches Handeln erwartet werden.
* Moral: Das dritte Moralstadium nach Lawrence Kohlberg heißt postkonventionelle Phase (eine auf abstrakten philosophischen Prinzipien beruhende Moral, die Autonomie voraussetzt und daher nicht von jedem erreicht wird). Werte (Moralgrundlagen) wie Gerechtigkeit, der Sozialvertrag, Schadenvermeidung und Autonomie können theoretisch hergeleitet werden. Universale ethische Prinzipien ersetzen aus persönlicher Betroffenheit abgeleitete Regeln, Wertekonflikte werden durch Abwägungen auf argumentativer Basis unabhängig von Einzelinteressen geklärt. (Ein Beispiel dafür ist Kants Kategorischer Imperativ, der im Unterschied zu hypothetischen Imperativen, die nur unter gewissen Bedingungen gelten, aufgrund der jeweils zugrundeliegenden maxima propositia allgemeingültig ist. Die beiden bekanntesten Formulierungen lauten: „Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ / „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“)
Die ethische Einstellung der meisten erwachsenen Menschen changiert zwischen Hedonismus (Lustgewinn bzw. Schmerzvermeidung), Utilitarismus (Erhöhung der Summe des Wohlbefindens für alle Betroffenen) mit der Variante Präferenzutilitarismus des aus einer Wiener jüdischen Familie stammenden australischen Philosophen und Tierrechtsethikers Peter Singer (*1946; will die Interessen aller als Person erkannten Wesen - aller, die ihrer selbst bewusst sind - berücksichtigen, wobei manche Tiere inkludiert und manche Menschen exkludiert sein können), einer Tugendethik (die als solche definierte positive Eigenschaften bzw. Werte anstrebt) und Deontologie (Pflichterfüllung im Sinne von Kant - s. o. - auch gegen eigene Neigungen).
Interessanterweise entsprechen unsere emotionalen Reaktionen nicht immer den moralischen Beurteilungen eines Sachverhalts, wie ein Ex.: zum Phänomen der Präferenzumkehr nachweist:
| Vpn. wurden in einer ersten Variante aufgefordert, in zwei voneinander unabhängigen Fällen die Höhe des Schadenersatzes zu bemessen, der Raubüberfallopfern zugute kommen soll, die durch deren zufällige Anwesenheit in einem von ihnen sehr selten (1. Fall) / sehr häufig (2. Fall) besuchten Geschäft jeweils identische Verletzungen davongetragen haben. Fast alle Vpn. bewerteten beide Fälle gleich, die zugesprochenen Summen waren identisch. Legte man neuen Vpn. allerdings in einer zweiten Variante der Studie nur einen der beiden Fälle vor (und anderen Vpn. den anderen), so war die zugesprochene Summe bei (1) im Durchschnitt signifikant höher als bei (2). Hintergrund: Die zweite Variante wurde ausschließlich von System 1 (s. u.), das das „Pech“ bzw. die geringe Wahrscheinlichkeit, an einem selten besuchten Ort überfallen zu werden, unsachlicherweise miteinkalkuliert, ohne dass dies den Vpn. bewusst wurde, die erste bewusst unter Zuschaltung von System 2 (s. u.) beurteilt. |
Zu diesem Abschnitt vgl. Übersicht und Quiz zu den Moralphasen Kohlbergs
* Mündigkeit: „Abschluss“ der psychischen Entwicklung (die in Wahrheit ein Leben lang anhält) ist (sollte sein) der am Ende dieser Phase anzustrebende Zustand der Mündigkeit. Diese besteht nach Immanuel Kant, 1724-1804, in der Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Anleitung anderer bedienen zu können („Sapere aude!“; vgl. Originalzitat). Entschuldigt sei nur, wem es an Intelligenz mangle, nicht aber, wer faul oder feig agiere.
Mündigkeit äußert sich z. B. darin, eigenständige Entscheidungen treffen, Meinungen von Tatsachen unterscheiden und angstfrei vertreten zu können, die Fähigkeit entwickelt zu haben, Informationen (die man nachschlagen kann) zu Wissen (das verstanden und integriert werden muss) transformieren zu können, oder in der Lage zu sein (was fast ausschließlich durch Vorwissen möglich ist), sinnvolle von sinnlosen oder falschen Informationen zu trennen bzw. deren Relevanz richtig einzuschätzen. (Zu Letzterem vgl. Archilochos / Ἀρχίλοχος, ca. 680-ca. 645 v. Chr.: „Πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ' ἐχῖνος ἕν μέγα.“)
- 17;0 bis 20;0: Adoleszenz:
Der Begriff Adoleszenz (abgeleitet von lat. adolescens =
heranwachsend) stammt von Granville
Stanley Hall
(1844-1924), einem Pionier der Jugendforschung und frühen Teilnehmer an Wundts
Experimenten (s. a. o.), der
annahm, dass auch Staaten diesen Zeitabschnitt durchlaufen würden (er sah die USA als gerade
heranwachsende Nation). Er bezeichnete allerdings die
gesamte Phase der emotionalen, moralischen und intellektuellen Entwicklung
inklusive der (Vor)pubertät als Adoleszenz. Eine erste
entwicklungspsychologische Sicht auf die Jugend lieferte
die Frau von Karl Bühler
(1879-1963; s. a. u.),
Charlotte Bühler
geb. Malachowski
(1893-1974; Sohn Rolf, 1919-1984,
war - aus der Art geschlagen -Professor für Raumfahrtantriebe), 1922 in ihrer Studie über Das Seelenleben des Jugendlichen,
die auch ein Beispiel für die frühe Tagebuchforschung ist. (Diarien dienten ihr
als auswertbare Quelle).
* Physische Entwicklung: Es beginnt die Phase der höchsten körperlichen Leistungsfähigkeit, die 10 bis 20 Jahre andauern kann. Bedeutend ist die nun erfolgende Ausreifung des präfrontalen Kortex, die das postformale Denken ermöglicht (enthält z. B. reflektiertes Denken, planen, Risiko- und Folgenabschätzung).
* 5. Identitätsstufe nach Erikson: Erwachsenenidentität vs. Identitätsdiffusion (das Selbstkonzept zerfließt; kaum Exploration, kaum Verpflichtung, negative Identität in einer von der Gesellschaft nicht anerkannten Rolle, Rollenkonfusion).
* Weitere Aspekte und Theorien zu dieser Phase: Temporär sind Identitätskonflikte genuiner Bestandteil der Adoleszenz. Hall (s. o.) bezeichnete sie als Sturm und Drang-Zeit, die vom anwachsenden Bewusstsein seiner selbst bzw. von der Umwelt verursachten emotionalen Turbulenzen gekennzeichnet sei und zu Empfindlichkeit, Depression und Draufgängertum in unterschiedlich starkem Ausmaß führe. Er meinte, dass man Menschen in dieser Phase in Ruhe lassen sollte.
Von James E. Marcia (*1937) wurde dieser Abschnitt Moratorium = Exploration noch ohne Festlegung genannt - s. Tabelle unten; die anderen drei Identitätsstatus heißen auf Englisch Identity Diffusion, Identity Foreclosure und Identity Achievement). Dauerhaft fehlendes Commitment (also Festlegung, Selbstverpflichtung bzw. Anerkennung bestimmter Werte) auch nach Phasen der Exploration führt zu Problemen. Commitment ohne Explorationsphase enthält die Gefahr einer nur übernommenen Identität, die man nicht für sich selbst verbindlich gemacht hat. Anzustreben sei „erarbeitete Identität“: Festlegungen erfolgen nach und aufgrund hoher Exploration. (Zu Identität s. a. o.)
| Identitätskonzept von Marcia: | Exploration | ||
| niedrig | hoch | ||
| Commitment | niedrig | Diffuse Identität | Moratorium |
| hoch | Übernommene Identität | Erarbeitete Identität | |
Ein Teilaspekt des Identitätsfindungsprozesses zeigt sich - beginnend mit der Pubertät und später nicht auf Jugendliche beschränkt - im sogenannten Geltungskonsum (conspicuous consumption; Begriff 1899 vom US-Soziologen Thorstein Bunde Veblen, 1857-1929, geprägt), einem auf Öffentlichkeit bedachten Güterverbrauch (bis hin zu demonstrativer Verschwendung) mit dem Ziel, den eigenen Status zu betonen oder anzuheben. (Noch) mangelndes Selbstbewusstsein führt dabei z. B. zu Identifikation mit Markenkleidung als Ersatz für Identifikation mit eigenen Qualitäten. (Privat- und andere Schulen versuchen dem manchmal durch Vorschreiben einer Schuluniform entgegenzuwirken.)
Weitere Entwicklungsaufgaben dieser Phase sind die Übernahme der Geschlechterrolle, die nicht nur biologisch, sondern auch sozial bestimmt wird (vgl. die Unterscheidung zwischen sex und gender in der englischen Sprache oder die ethnologischen Untersuchungen von Margaret Mead, 1901-1978, für die das Selbst Resultat sozialer Austauschprozesse ist; in Coming of Age in Samoa und anderen Werken argumentierte sie für einen Kulturrelativismus) und - wie schon oben erwähnt - die Sinnfindung durch Identifikationen. Störungen wirken sich hier z. B. in der „Null-Bock-Einstellung“, der Gefahr der Drogenabhängigkeit oder deviantem Verhalten wie der Kriminalität aus. (In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach dem freien Willen - s. a. o. -, da ja die Möglichkeit besteht, dass straffälliges Verhalten allgemein und daher auch Kapitalverbrechen durch genetische oder epigenetische bzw. in früher Kindheit erlernte Faktoren begünstigt worden sein könnten. Der englische Neurokriminologe Adrian Raine, *1952, fragt nach einer gerechten Beurteilung der angesprochenen Problematik: „War das Kind verantwortlich für diese Faktoren? Nein. Werden wir es später für die Verbrechen, die es begeht, zur Verantwortung ziehen? Ja.“ Ein Hinweis darauf, dass auch Außenfaktoren für Straftaten verantwortlich sein können, seien gewisse Störungen des präfrontalen Kortex oder der Amygdala, die sowohl abweichende Hirnscanbilder wie auch bei ungünstigen epigenetischen Einflüssen abweichendes Verhalten wie Gewalttaten erzeugen würden.)
- 20;0 bis 30;0: Frühes Erwachsenenalter:
* 6. Identitätsstufe nach Erikson: Intimität vs. Isolierung:
Phase des Aufbaus eines selbständigen Lebens. Die Fähigkeit zur Aufnahme tragfähiger Beziehungen
(commitment) und zur Übernahme von Verantwortung ist von geklärter Identität abhängig.
Hilfreich dabei ist auch, dass die Entwicklung des orbitofrontalen Kortex in
diesem Lebensabschnitt zu einem Ende kommt und damit Zukunftsorientierung und
planvolles Handeln nach den Kriterien der Vernunft begünstigt wird. Die
physische Leistungsfähigkeit erreicht ihren Lebenshöhepunkt (wie man an
zahllosen Spitzensportlerkarrieren ablesen kann.)
* Weitere Aspekte und Theorien zu dieser Phase: Das Konzept der emerging adulthood (Begriff von Jeffrey Arnett, *1959?) beschreibt seit dem Ende des 20. Jhdts. für die 20er-Jahre eine immer länger dauernde Phase der Ausbildung und damit Elterngebundenheit ohne Commitments, die durch Identitätssuche, Instabilität, Selbstfokussierung, das Gefühl, dazwischen zu sein, und eine Zeit der Möglichkeiten geprägt sei.
Beziehungsfragen: Von Helen Fisher (1945-2024) wurde zwischen Sexualität (von den Geschlechtshormonen gesteuert), Bindungsverhalten (oxytocin-, vasopressinabhängig) und romantischer Liebe (dopamin-, noradrenalingebunden, serotoninunterdrückend; aktiviert wie bei der Mutterliebe das Belohnungssystem und „macht blind“; s. o.) unterschieden. Einen günstigen Partnerschaftsverlauf begünstigt dyadisches Coping (die Partner erkennen die Belastungen des anderen und versuchen sie - einander unterstützend - gemeinsam zu meistern) und das Verhindern der von Guy Bodenmann (*1962) im Anschluss an John Gottman (*1942; vgl. Seite des Gottman-Instituts) so genannten
5 apokalyptischen Reiter:
| ° | Verallgemeinernde, destruktive und verletzende Kritik |
| ° | Bedienen der Eskalationsspirale durch Rechtfertigungen und Kontern der Kritik durch eigene Vorwürfe |
| ° | Verachtung durch Zynismus und absichtliche Verletzungen |
| ° | Rückzug und Mauern, Kommunikationsverweigerung |
| ° | Machtdemonstration ohne Interesse am bzw. Rücksicht auf den Partner / die Partnerin |
Demgegenüber weniger wichtig ist das Vorhandensein bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Der zusammen mit seiner Frau Julie Schwartz Gottman (*1951) als einer der führenden Paartherapeuten in den USA geltende John Gottman (Sohn eines Wiener Rabbiners) weist außerdem darauf hin, dass langfristiges Gelingen von Beziehungen eher vom Vermeiden negativer als vom Streben nach positiven Interaktionen abhänge. Das Verhältnis zwischen beiden Verhaltensvarianten (die Positivity Ratio) liege in einer stabilen, glücklichen Beziehung etwa bei 5:1 oder besser zugunsten der positiven Interaktionen („Gottman-Ratio“), bei Gleichstand würden sich die meisten Paare früher oder später trennen. Selbst 3:1 sei keine zufriedenstellende Ratio. Der Aufbau von Beziehungen, auch Freundschaften (die für Gottman die unverzichtbare Grundlage jeder Beziehung seien), dauert oft lang, ihre Zerstörung kann aufgrund der Negativitätsdominanz, s. a. u., sehr schnell gehen. Negative Erfahrungen haben deutlich mehr Gewicht als positive. Zusätzlich ist zu beachten, dass - wie immer im zwischenmenschlichen Bereich - negative Muster des / der einen weitere negative Muster des / der anderen provozieren und produzieren. (Die Gesamtscheidungsrate lag in Österreich 2020 bei 37,6%; die Trennungsrate ist natürlich weit höher, da ja in der Statistik nur gesetzlich verankerte Partnerschaften berücksichtigt werden können.) Gottman schlägt zur Sicherstellung glücklicher Partnerschaften vor, die „Partner-Landkarte“ immer auf dem neuesten Stand zu halten / Zuwendung und Bewunderung zu pflegen / einander zuzuwenden / sich vom Partner beeinflussen zu lassen / lösbare Probleme zu lösen / Pattsituationen zu überwinden / einen gemeinsamen Sinn zu schaffen.
Gegenpole zu den apokalyptischen Reitern sind die 5 Liebesformeln der Schweizer Psychologin Verena Kast, *1943: Zuwendung, Wir-Gefühl, Akzeptanz, positive Illusionen, Aufregung im Alltag. Zu beachten ist bei der Entwicklung einer geglückten Partnerschaft, die sich nach Otto F. Kernberg, *1928, immer in den drei Bereichen Sexualität, alltägliches Zusammenleben und Wertewelt realisiert, auch, ob die entstehenden Gefühle womöglich durch die Pathologie des Gegenüber ausgelöst werden und so die Partner wechselseitig ihre Neurosen „bedienen“. Auch die manipulative Kraft mancher Persönlichkeitsstrukturen erschwert das Auseinanderhalten echter und pathologischer Zuneigung.
Nach der Dreieckstheorie der Liebe von Robert Sternberg (*1949; s. hier) setzt sich Liebe aus den Komponenten Vertrautheit (intimacy), Leidenschaft (passion) und Verbindlichkeit (commitment) zusammen. Je nach Konstellation unterscheidet er (in einem auf seiner Basis stehenden gleichseitigen Dreieck darstellbare)
7 Arten der Liebe:
| ° | Neigung (liking): Vertrautheit allein (einzutragen am oberen Eck) |
| ° | Verliebtheit (infatuation): Leidenschaft allein (am linken unteren Eck) |
| ° | Leere Liebe (empty love): Verbindlichkeit allein (am rechten unteren Eck) |
| ° | Romantische Liebe (romantic love): enthält Vertrautheit und Leidenschaft (am linken Schenkel) |
| ° | Fürsorgliche Liebe (companionate love): enthält Vertrautheit und Verbindlichkeit (am rechten Schenkel) |
| ° | Verblendete Liebe (fatuous love): enthält Verbindlichkeit und Leidenschaft (an der Basislinie) |
| ° | Vollkommene Liebe (consummate love): alle drei Komponenten sind vorhanden (in der Mitte des Dreiecks) |
Zu den Bedingungen für interpersonaler Attraktion s. u.
- 30;0 bis 60;0: Erwachsenenalter:
* 7. Identitätsstufe nach Erikson: Generativität (Zeugende
Fähigkeit) vs. Selbstabsorption, Stagnation (Entscheidung darüber, ob man
das Gefühl erwirbt, etwas Geglücktes, für die Folgegeneration Wertvolles
hervorzubringen und über das Ich hinausgehende Interessen zu verfolgen oder sich
bei seinen Tätigkeiten - auf das eigene Ich konzentriert - selbst verzehrt.)
* Weitere Aspekte und Theorien zu dieser Phase: Für viele Menschen ist dies die Phase der ersten Jahre ihrer Kinder (wobei nach Gottman, s. o., zwei Drittel der Paare in den ersten drei Jahren nach der ersten Geburt mit ihrer Beziehung unzufriedener sind als davor), der Etabliertheit und später der „Mid-Life-Crisis“ (in der hormonelle Veränderungen stattfinden, die Unausweichlichkeit des - zumindest körperlichen - Verfalls erkannt wird und für Frauen durch die wechseljahrbedingte Menopause die Reproduktionsfähigkeit endet).
Weitere mögliche Teilaspekte sind das Empty-Nest-Syndrom (wenn nach dem Auszug der Kinder und damit dem Verlust eines wichtigen Lebenssinns der letzten 20 Jahre Gefühle der eigenen Bedeutungslosigkeit aufkommen) und das Problem der Arbeitslosigkeit, die in ihren Auswirkungen schon 1932, von Marie Jahoda (1907-2001), Paul Lazarsfeld (1901-1976) und Hans Zeisel (1905-1992) in der berühmt gewordenen Marienthal-Studie erfasst wurde: Verelendung fördere nicht einen politischen Veränderungswillen, sondern Apathie, z. B. weil die Zeitstruktur fehle. (Es wurden alle 478 Familien des titelgebenden niederösterreichischen Dorfes in der Gemeinde Gramatneusiedel nach der 1930 erfolgten Schließung der dortigen Textilfabrik mit 1300 Arbeiter/innen soziographisch erfasst.)
- ab 60;0: Reifes Erwachsenenalter, Alter:
* 8. Identitätsstufe nach Erikson: Ich-Integrität vs.
Verzweiflung, Lebensekel (Freude oder Verzweiflung im Rückblick auf das Leben).
Die Grundfrage dieser Lebensphase lautet: Kann ich mein Leben, so wie es
verlaufen ist, im Rückblick akzeptieren oder dominiert der Eindruck der vergebenen
Chancen und Misserfolge? (Vgl. Irvin D. Yalom,
*1931: „Je mehr wir bedauern, was wir nicht gelebt haben, desto mehr fürchten
wir den Tod.“)
* Weitere Aspekte und Theorien zu dieser Phase: Das psychologisch-medizinische Teilgebiet, das sich mit der letzten Lebensphase befasst, nennt man Gerontologie. (Charlotte Bühler u. a. wiesen darauf hin, dass der Prozess des Alterns das gesamte Leben umfasse.) Statistisch nimmt diese Bevölkerungsgruppe stetig zu: Die Hälfte aller Menschen, die jemals auf diesem Erdball älter als 60 Jahre wurden, lebte 2020 noch! Oft stehen die negativen Begleiterscheinungen des Alters im Zentrum der Betrachtung, es existieren aber auch positive: die durch den Rückzug aus dem Arbeitsleben gewonnene Zeit ermöglicht es, seinen Interessen nachzugehen und „sein Haus zu bestellen“. (Vgl, das Testament des Habsburgers Maximilian I., 1459-1519; ab 1508 römisch-deutscher Kaiser nach Jesaja 38,1: „Mensch, versieh dein Haus, denn du wirst sterben. Die Zeit, einem Menschen zugewiesen, ist nahend erreicht.“)
Negative Teilaspekte wären u. a.: das Absinken der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns durch den Verlust von bis zu 30 Volumen-% bis ins hohe Alter (wenn dies auch noch einige Zeit durch die angesammelte Erfahrung kompensiert werden kann), das Problem des physischen Abbaus (tw. durch Inflammaging; zusammengesetzt aus den englischen Ausdrücken für Entzündung und Altern) bis hin zur körperlichen Hinfälligkeit, ev. Pflegebedürftigkeit, das der Vereinsamung, eines Lebens unter dem Damoklesschwert des herannahenden Todes (vgl. Lebenserwartungsrechner, Seite über das Sterben). In jeder Phase des Lebens sind Nahtoderlebnisse möglich (Ausdruck vom Ehemann der 1. Schweizer Ärztin Marie Vögtin, 1845-1916, dem Schweizer Geologen und Kynologen Albert Heim, 1849-1937, der im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs 1891/92, S. 327f, Berichte abgestürzter Bergsteiger auswertete). Populär gemacht wurden Out of Body-Experiences, die meist mit dem Erlebnis der Ablösung des Bewusstseins vom Körper einhergehen - man sieht sich selbst von außen - und mit bestimmten Erinnerungen an das Leben, dem Empfinden eines angenehmen Weggezogen-Werdens durch einen Tunnel zum Licht bzw. dem Verlust der Todesfurcht verbunden sein können, vom US-amerikanischen Psychiater Raymond Moody (*1944) in seinem Buch Life After Life (1975). Beim Tod werden Herz- und (entscheidender) Hirntod unterschieden, der nach einer terminal spreading depolarization (einer wellenartig auftretenden Nervenzellenentladung) eintritt. Als Präventionsfaktoren gegen übermäßiges Erstarren im Alter benennt der österreichische Gerontologe Georg Wick (*1939) die Drei-L-Formel Laufen, Lernen, Lieben, die später um Lachen ergänzt wurde, als motivationale Tätigkeiten.
Seit einiger Zeit existiert die Hospizbewegung (s. a. Deutsche Seite, Interview mit Daniela Tausch-Flammer, der Tochter des Ehepaars Tausch - s. u. - und Internetprojekt) für unheilbar Kranke, die nicht mehr medizinische Interventionen, sondern das psychische Wohlergehen der Patienten im Schatten des Unausweichlichen in den Fokus rückt. Die sogenannte Sterbehilfe bei terminalen Erkrankungen bzw. in unerträglichen Lebenssituationen ist in den verschiedenen Staaten unterschiedlich geregelt. In Österreich erzwang ein oberstgerichtliches Urteil eine Neufassung des entsprechenden Gesetzes, das den assistierten Suizid unter gewissen Umständen nunmehr erlaubt und mit 1. 1. 2022 in Kraft trat (s. StVfG). Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) untersuchte (allerdings eher anekdotisch als datenbasiert) 1969 in ihrem Buch On Death and Dying (auf Deutsch 1971 Interviews mit Sterbenden; vgl. hier oder hier) die
5 Abschiedsphasen vor dem Tod:
| ° | Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens |
| ° | Phase des Zorns, der Emotionen |
| ° | Phase des Verhandeln-Wollens |
| ° | Phase der Depression |
| ° | Phase der Zustimmung |
(Nicht zu verwechseln mit den 4 Trauerphasen von Verena Kast, *1943: Schock, Verleugnung / Emotionsausbruch (Schmerz, Wut, Angst etc.) / Akzeptieren der endgültigen Trennung / Neuer Welt- und Selbstbezug, Rückkehr innerer Ruhe - s. hier - oder von Yorick Spiegel, 1935-2010: Schock / Kontrolle / Regression / Anpassung).
|
Statistisches Material zu Tod und Sterben in Österreich: |
| 2012 gab es in Österreich 79 436 Sterbefälle (etwas mehr als Geburten; am wenigsten im September, am meisten im März),
darunter ca. 33 931 (insg.
43%, bei Frauen 48%) an Herz-Kreislauf-Versagen, 20 226 = 26% an Krebs - beides
teilweise durch selbstzerstörende Lebensführung bedingt. (Der Tod lässt sich
allerdings auch bei gesunder Lebensführung zur Zeit bekanntlich noch
nicht dauerhaft verhindern.) An Verletzungen und Vergiftungen starben insgesamt
4.442 Personen. 1.275 Personen begingen Suizid (s. a. u.; 75% davon
Männer), 884 Personen verstarben aufgrund eines Sturzgeschehens, 554 an
Transportmittelunfällen (vorwiegend Verkehrsunfällen; damals historischer,
auf unter 400 weiterhin sinkender
Tiefststand). EU-weit starben nach einer
Studie von
Eurostat
2006 42% der EU-Bürger an Herz-Kreislauf-Krankheiten, 25% erlagen bösartigen
Tumoren. 27% der jungen Verstorbenen kamen durch „äußere Umstände“ ums
Leben, 50% davon durch Verkehrsunfälle.) Die fünf - direkten oder indirekten
- Hauptursachen des (verfrühten) Sterbens sind Rauchen, Alkohol, falsche (zu
fette und zu zuckerhaltige) Ernährung, zu wenig Bewegung und mangelnder
Schlaf. 51% sterben im Spital (in Wien deutlich mehr), 27% daheim, 17% in
Heimen (größter Zuwachs), 5% an sonstigen Orten. Die durchschnittliche
Lebenserwartung betrug 2012 in Österreich (am höchsten in Vorarlberg, am
niedrigsten in Wien) 83,3 Jahre für Frauen und 78,3 Jahre für Männer (bis
dahin historische
Rekordmarken; etwa ein halbes Jahr Zugewinn pro Jahr; der unverhältnismäßig hohe
Geschlechtsunterschied erklärt sich zu einem guten Teil durch die hohe alkoholbedingte Sterblichkeit
bei österreichischen Männern), sie stieg 2024 weiter auf 84,3 bzw.
79,8 Jahre. 9 von 10 Todesfällen
betreffen Über-60jährige. 2020 erhöhte sich die Anzahl der Sterbefälle wegen
der durch
die COVID 19-Pandemie bedingten Übersterblichkeit auf 91 599 (allerdings bei einer um
eine halbe Mio. höheren Einwohnerzahl als 2012), die Lebenserwartung sank erstmals
seit Jahrzehnten wieder um ein halbes Jahr (und erreichte erst 2023 wieder
das Vor-Corona-Niveau). 2021 gab es fast 92 000
Sterbefälle (34% kardiovaskulär verursacht, 9% wegen oder mit COVID 19). 2022 lag die Zahl der Sterbefälle
bei 93 332 (verursacht zu 34,3% kardiovaskulär, 22,7% Krebs,
6,8% COVID 19; vgl.
hier), die
Lebenserwartung sank auf das Niveau von 2014. 2023 verstarben 89 760
Personen (12 155 mehr als geboren wurden: =größtes Geburtendefizit
seit1945; durch Zuzug - vor allem aus
Deutschland, Rumänien, der Ukraine, Syrien und Ungarn - ergab sich dennoch
ein Bevölkerungswachstum). Zur Entwicklung von Morden, Suiziden und Femiziden in Österreich s. hier Berechnung der eigenen Lebenserwartung s. hier oder hier, Vergleich Ö - andere Staaten hier: Indikator „Lebenserwartung“ - Vgl. auch „Wann und woran Herr und Frau Österreicher sterben“, Mortalitätsmonitoring Euromomo (interessante Statistiken unter „graphs-and-maps“) |
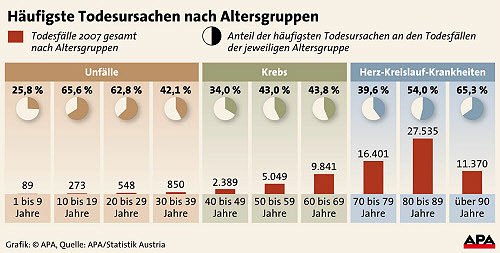
Abb. 2/8: Todesursachen in Österreich - Altersaufschlüsselung
„Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen.“ (Zürauer Aphorismen 1917/18 von Franz Kafka, 1883-1924)
ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN - GEISTIGE BEHINDERUNG
Die Frage, was als Störung bzw. Behinderung gilt, wurde im Laufe der Zeiten nicht immer einheitlich beantwortet. Die Terminologien veränderten sich in der Forschungsgeschichte genau so wie die Inhalte. (Die problematische Grenzziehung zwischen „normal“ / „behindert“ - s. a. u. - sei durch einige Fragen illustriert: Ist z. B. jemand behindert, der/die die Relativitätstheorie nicht versteht? Wenn er/sie das Einmaleins nicht erfasst? Wenn er/sie nicht 10 km durchlaufen kann? Einen Treppenlift benötigt? usw., oder sind nicht viele Unterscheidungen gradueller, nicht substantieller Natur?) Hier wird ein Überblick über das in Frage stehende Gebiet angestrebt, der auch neuere Erkenntnisse laufend einzuarbeiten versucht. Zu einzelnen Krankheiten oder Zustandsbildern vgl. auch das umfassend informierende MSD-Manual (Index A-Z, umschaltbar von Fach- zu Patienteninformationen; mit Quizmöglichkeit)
- Allgemeines:
* Definition: Entwicklungsstörungen sind
früh auftretende, meist neurologische Einschränkungen bzw. Verzögerungen von ZNS-Funktionen, deren
Verlauf sich (im Unterschied zu psychischen Erkrankungen;
s. u.) im Laufe des Lebens nicht rückgängig machen lässt. Als behindert
(das Wort, das ursprünglich Bezeichnungen wie „Idiotie“ ersetzen sollte, fällt immer mehr den PC-Sprachregelungen zum Opfer, ohne dass dadurch
automatisch die damit
verbundenen Benachteiligungen verschwinden würden)
sind nach einer WHO-Definition
„...alle zu bezeichnen, die in ihren körperlichen, psychischen, geistigen Fähigkeiten, in ihren Sinnesfunktionen, im Sozialverhalten, Lernen oder der sprachlichen Kommunikation vorübergehend oder dauernd so wesentlich beeinträchtigt sind, dass ihre Teilnahme am beruflichen oder sozialen Leben nicht ohne entsprechende Hilfe oder Hilfsmittel möglich ist.“
(In Österreich wären dies etwa 10% bis 15% der Bevölkerung bzw. noch mehr, wenn man etwa alle Brillenträger miteinbezöge.) Neurologische Entwicklungsstörungen, also geistige Behinderungen (engl. mental retardation), laut WHO
„eine signifikante Einschränkung im Bereich der geistigen Funktionen und in Bereichen des adaptiven Verhaltens, welches sich in den konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten widerspiegelt“,
machen nur einen kleinen
Bereich davon aus (sie betrifft weniger als 1% der Bevölkerung).
Zur Klassifikation von geistiger Behinderung s. ICD
10 F 70-79; vgl. zu diesem Thema auch Studie der
Universität Bochum und
für Wien den „Ratgeber Behinderung“.
* Statistik: Die Anzahl der behindert Geborenen (Morbiditätsrate) hat in den letzten Jahrzehnten in Österreich, bedingt durch den allgemeinen Geburtenrückgang (s. o.), die Fortschritte in der Medizin, die Einführung des Mutter-Kind-Passes sowie der 1975 erfolgten Straffreistellung der (nach § 96 StGB an sich verbotenen) Abtreibung in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft nach § 97 Abs. 1 deutlich abgenommen. (Nach Schätzungen - aus unerfindlichen Gründen gibt es in Österreich keine Abtreibungsstatistik auf wissenschaftlicher Basis - lassen bis zu 90% der Eltern nach einer entsprechenden Diagnose ihr behindertes Kind abtreiben, was in Österreich bei Vorliegen einer Behinderung nach § 97 Abs. 2 bis zum Geburtstermin möglich ist. Diese Ungleichstellung mit „gesunden“ Kindern wurde - auch von Behindertenorganisationen - manchmal kritisiert. (Nach der flächendeckenden Einführung kostenloser Pränataltests - s. u. - in Dänemark sank die Zahl behinderter Kinder drastisch. Es gab Kalenderjahre ohne eine einzige Trisomie 21-Geburt.) - Vgl. zu diesen Aspekten folgende tendenziöse, aber detailreich informierende Seite).
Heute zeigen bis zu 2% der Lebendgeborenen Anomalien, die mit einem selbständigen Leben unvereinbar sind. Etwa 15 von 100 Lebendgeborene sind durch Erbrisken, Störungen während der Schwangerschaft, der Geburt oder in den ersten Lebenstagen belastet, was jedoch keineswegs immer zu Dauerfolgen führt. Etwa 30% aller Keime sterben noch vor der Geburt (z. T. unbemerkt) ab, nach begründeten Schätzungen erreichen vielleicht nur etwa 55% aller Früchte ein fortpflanzungsfähiges Alter. Die Säuglingssterblichkeit (Mortalitätsrate) wurde zwischen 1972 und 1978 in Österreich um die Hälfte reduziert (auch hier sind der Fortschritt der Medizin und die Einführung des Mutter-Kind-Passes ursächlich): Sie betrug 1990 noch 0,8‰, seit 1997 liegt sie unter 5 Promille (2001 0,48‰, Steiermark 0,33‰!) Zum Vergleich: Am niedrigsten war sie 2002 in Schweden mit 0,3‰, gefolgt von Dänemark, Island, Norwegen und Singapur mit 0,4‰, am höchsten in Sierra Leone mit 28,4‰ gefolgt von Niger, Angola und Afghanistan), seit 2006 unter 4 Promille auf 0,36‰! Das bisherige Allzeitminimum wurde in Österreich 2022 mit 2,4‰ erreicht. (Weltweit sank die Säuglingssterblichkeit zwischen 2000 und 2022 um 51%!). Die Totgeburtenrate im Jahr 2001 lag in Österreich bei 3,7 auf 1000 Lebendgeborene, die Perinatalsterblichkeit (Totgeburten + 1. Lebenswoche) bei 6,2 auf 1000 Lebendgeborene. (In den Statistiken der WHO wird zwischen Fehlgeburt - bis 500 g - und Totgeburt - über 500 g - unterschieden.)
* Frühdiagnostik (Pränataldiagnostik PND; vgl. auch hier) und damit die rechtzeitige Einleitung von Maßnahmen ist z. B. (mit einem gewissen Fehlgeburtsrisiko) durch die invasive Amniozentese (Fruchtwasserspiegelung) möglich. Die im Fruchtwasser schwimmenden abgefallenen Körperzellen des Fötus können schmerzfrei durch die Bauchdecke entnommen und zytogenetisch analysiert werden (da ja jede Zelle eines Menschen den gesamten DNA-Satz enthält). Andere Methoden bestehen in der Ultraschalluntersuchung mit Nackenfaltenmessung (als nicht-invasiver pränataler Combined Test - NIPT - beim Ersttrimesterscreening mit einer Blutuntersuchung der Mutter zur Risikoabschätzung diverser Zustandsbilder) oder in der Chorionzottenbiopsie (invasive, sehr früh mögliche Entnahme genetisch aussagekräftigen extrafetalen Gewebes im Bereich des Nabelschnuransatzes).
Erfolgt die frühdiagnostische
Untersuchung (im Rahmen einer künstlichen Befruchtung im Reagenzglas) vor der
Einsetzung des Keimes in die Gebärmutter, spricht man von Präimplantationsdiagnostik PID. Da die daraus gewonnenen
Erkenntnisse zur Selektion der Embryonen verführen (nur ausgesuchte
„Designerbabys“ mit erwünschten Eigenschaften überleben), ist diese Methode
umstritten (und auch rechtlich nicht überall erlaubt). (Komplexere Merkmale oder Eigenschaften vorauszusagen, ist zur Zeit
allerdings noch nicht möglich.) Allerdings veranlasst auch die PND bzw. die
daraus folgenden Konsequenzen zu Diskussionen bezüglich der unterschiedlichen
Bewertungen genetischer Varianten.
Vgl.
https://www.fsw.at/p/adressen-ambulatorien-fuer-entwicklungsdiagnostik-und-foerderung
* Betrachtungsweisen: Die grundsätzliche Herangehens- und Sichtweise in Bezug auf „behinderte“ Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert, was sich nicht nur in „politisch korrekten“ (und manchmal verschleiernden bzw. euphemistischen) Bezeichnungen (z. B. „Einschränkungen“, „besondere Bedürfnisse“, „Herausforderungen“ etc. statt „Behinderungen“, „Inklusionsklassen“ statt „Sonderschulen“ usw.), sondern auch in der Medienpräsenz und -repräsentanz oder den aus Rücksicht auf bisher nicht beachtete Bevölkerungsgruppen vorgenommenen Veränderungen im öffentlichen Raum (z. B. Gehsteigabschrägungen, barrierefreien Zugängen in Amtsgebäuden etc.) ausdrückt. Die Abnahme struktureller Benachteiligungen, die dazu führen soll, dass, wer behindert ist, nicht auch noch behindert wird, wurde durch die manchmal nutzbare Möglichkeit zu Personal Assistance ergänzt, sodass die Lebensqualität für viele „Behinderte“ durch die Veränderung der gesellschaftlichen Einstellung im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich gesteigert werden konnte. Allmählich setzt sich die Einstellung durch: „Niemand kann alles, aber jede/r kann etwas.“ (Zum Normalitätsbegriff s. u., vgl. a. Index für Inklusion)
Die folgende Tabelle stellte 1993 defizitorientierte Haltungen gegenüber behinderten Personen ressourcenorientierten Haltungen gegenüber (nach Ines Boban, *1957, und Andreas Hinz, *1957, Geistige Behinderung und Integration, P. 4):
|
Tabelle: Polaritätenmodell zur Kennzeichnung unterschiedlicher Haltungen zur 'Geistigen Behinderung' |
|
|
Defektologische Haltung: |
Dialogische Haltung: |
| 'Geistige Behinderung' als Zustand | 'Geistige Behinderung' als Prozess |
| 'Geistig behindert' sein (und lebenslang bleiben) | 'Geistig behindert' werden (und sich dementsprechend entwickeln) |
| (Hirnorganischer) Defekt, ('IQ'-)Mangel, Defizite in der Entwicklung |
auf einander beeinflussenden inneren und äußeren Bedingungen basierende Entwicklung |
| Ticks, Stereotypien | sinnvolle, logische (Re-)Aktion |
| Theorie der Andersartigkeit | Dialektik von Gleich und Verschieden |
| Defizitorientierung, Arbeit an Problemen | Kompetenzorientierung, Unterstützung von Entwicklung |
| pädagogische Aggressivität | pädagogische Begleitung |
| Person als primär passives, heteronomes Objekt | Person als primär aktives, autonomes Subjekt |
| Wissen, was das Beste für die Person ist | Beobachten, auf der Welle der Person mitgehen |
| zweckgebundenes, lebenspraktisches Training | Schaffung eines Rahmens der Handlungsfähigkeit |
| individuelle optimale Förderung | individuelle Anfragen |
| Lernen nur von SpezialistInnen | Anregung auch durch das Umfeld |
| sonderpädagogischer Anspruch, totale Verantwortung | Akzeptanz ohne Herrschaftsanspruch der Betreuung |
| didaktische Reduzierung, 'Prinzip der kleinen Schritte' | Offenheit für gemeinsame Situationen und Erfahrungen |
| Förderpläne ohne Einbindung der Betroffenen | dialogische Entwicklung, Verabredung |
| Maßnahmen und Regelungen werden durch Professionelle gesetzt | individuelle Maßstäbe, die vom Kind ausgehen |
| Tabuisierung des Themas 'Geistige Behinderung' | Zeugenschaft für Bearbeitung des Themas 'Geistige Behinderung' |
| etc. | etc. |
* Verhalten gegenüber Behinderten: Sinnvollerweise sollte die Begegnung mit eingeschränkten Menschen so natürlich und „normal“ wie möglich ausfallen, schon deshalb, damit man nicht selbst einer der Behinderungsfaktoren wird. Sympathien und Antipathien werden sich genauso einstellen wie gegenüber gesunden Menschen. Die naturgemäß geringeren oder fehlenden sprachlichen Mittel werden oft durch Körpersprache kompensiert. Störende Distanzlosigkeit kann (und darf) kritisiert werden.
Ethisch zu klären ist die Frage der Sterilisierung, die genauso wie die der Abtreibung oder der sogenannten Euthanasie durch die Vorkommnisse in der NS-Zeit in Österreich (und Deutschland) mit besonderer Sensibilität diskutiert werden. Da womöglich grundlegende Eingriffe in Persönlichkeits- und Freiheitsrechte auf dem Spiel stehen, müssen alle Regelungen besonderer Sorgfalt unterliegen. (So ist z. B. in Österreich eine Zwangssterilisierung nur denkbar, wenn überhaupt eine Exposition zu sexuellen Kontakten vorliegt, die Person selbst - wenn dies möglich ist - oder ihr gesetzlicher Vertreter zustimmt und weitere Bedingungen erfüllt sind. - Vgl. § 90 StGB)
Das behinderte Kind sollte sich immer im Mittelpunkt des gleichseitigen „Heilpädagogischen Dreiecks“ (Begriff von Andreas Rett, 1924-1997, und Horst Seidler, *1944. Das hirngeschädigte Kind. Wien 1981; vgl. auch hier) befinden:
|
Abb. 2/9: Das „Heilpädagogische Dreieck“ |
Eltern (Erziehungsberechtigte)
Ärzte, Therapeuten Erzieher, Betreuer
|
* Organisation und Juristisches: Das Behindertenrecht ist eine Querschnittmaterie, die das Arbeitsrecht, die Sozialgegesetzgebung, Gleichstellungsangelegenheiten u. v. a. m. betrifft. In Österreich besteht auch für behinderte Kinder Schulpflicht, daher existiert seit vielen Jahrzehnten ein gut entwickeltes Sonderschulwesen mit von den Gemeinden finanzierten Fahrtendiensten. (Auch das Recht auf Schülerfreifahrt und manche Unterrichtsmittel stehen nicht nur gesunden Kindern zu.) Dadurch ergibt sich einerseits Erleichterung für die Familien, andererseits jedoch eine gewisse Absonderung, da das Benützen öffentlicher Verkehrsmittel nun nicht mehr notwendig ist. Nach Absolvierung der Schuljahre finden manche Klienten, wie sie meist genannt werden, Platz in Betreuungseinrichtungen, in Werkstätten und Wohnheimen öffentlicher oder privater Organisationen (z. B. der aus einer Eltern-Selbsthilfevereinigung entstandenen Lebenshilfe). Ein Problem besteht in der oft zu geringen Platzanzahl, wodurch manche Behinderte erst nach dem Tod ihrer Eltern in eine neue Umgebung kommen und dann zwei Umstellungen auf einmal zu bewältigen haben. Zusätzliche Hilfe bieten in Österreich heilpädagogische Zentren (z. B. das NOEHPZ Hinterbrühl).
Weniger bekannt ist, dass in Österreich alle geistig Behinderten das Wahlrecht haben. Man hat sich dadurch einerseits der ohnehin nicht entscheidbaren Frage entzogen, wo genau die Grenze zwischen zuzulassenden und gerade nicht mehr zuzulassenden Intelligenzniveaus liegt, andererseits einen gar nicht eintretenden Nachteil in Kauf genommen: dass nun wählen kann, wer die Konsequenzen seiner Entscheidungen nicht abschätzen kann. Einerseits besteht diesbezüglich zu vielen „gesunden“ Wählern möglicherweise kaum ein Unterschied, andererseits nehmen geistig Schwerbeeinträchtigte schon deshalb an Wahlen meist gar nicht teil, weil sie von deren Existenz nichts wissen bzw. nichts wissen können.
Behinderte Personen benötigen (zu ihrem Schutz) einen rechtlichen Vormund
(später „Sachwalter“ und seit 2018 in Österreich Erwachsenenvertreter - s.
hier - genannt), der notwendige Entscheidungen trifft, die geschäftlichen
Dinge regelt und für alle oder nur für ausgewählte Lebensbereiche zuständig ist.
Prophylaktisch kann auch eine Vorsorgevollmacht erstellt werden, die wirksam
wird, wenn man selbst nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte.
Vgl. Behinderten-Integrations-Dokumentation
Einteilung der Behinderungen:
* Nach dem Schweregrad:
Man unterscheidet - mit nicht immer klaren Abgrenzungen (s.
z. B. obige Tabelle) - je nach Symptomen (= Krankheitszeichen) bzw. Syndromen
(= Bündel von Symptomen, Krankheitsbild) verschiedene Behindertengruppen. Eine
der vielen möglichen Einteilungen stammt von der AAMD (American
Association on Mental Deficiency; heute
American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities); deren Definition: „Mental
Retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning
existing concurrently with deficits in adaptive behaviour, and manifested during
a developmental period.“
|
Tabelle: Grade geistiger Behinderung nach AAMD mit grob geschätzten Prozentzahlen |
||
|
Behinderungsgrad |
IQ-Bereich |
Häufigkeit |
| leicht behindert | 69 - 55 | ca. 60% |
| mittelstark behindert | 54 - 40 | ca. 25% |
| schwer behindert | 39 - 25 | ca. 10% |
| schwerst behindert | 24 - 00 | ca. 5% |
* Nach dem Zeitpunkt der Entstehung:
| ° | vor der Geburt: pränatal verursacht |
| ° | während der Geburt: perinatal verursacht |
| ° | nach der Geburt: postnatal verursacht |
- Pränatal verursachte Behinderungen:
Vgl.
Erbkrankheiten
bei onmeda.de,
Kurs
Molekulargenetik und Tutorial zur Genetik.
Zur Anlage-Umweltproblematik s. u.
* Chromosomenaberrationen (Schädigungen des genetischen Materials): Der
Karyotyp (also der regelrechte Chromosomensatz) des Menschen, somit auch der jedes
Vaters und jeder Mutter, hat 22 Chromosomenpaare (Autosomen), und 1 Geschlechtschromosomenpaar (Gonosomen,
aufgrund der unter dem Mikroskop erkennbaren Form w: „XX“, m: „XY“ genannt)
in einem diploiden
Chromosomensatz, das heißt, dass alle „Eigenschaften“ - die aber in Wahrheit oft
so komplex sind, dass sie von mehreren Genen gesteuert werden bzw. auch an- oder
abgeschaltet werden können - in zwei Genen
(die Allele genannt werden) repräsentiert
sind, von denen von jedem Elternteil nach dem Zufallsprinzip nur eines an das Kind
weitergegeben wird. Bei jeder Zeugung entstehen also (nach Gregor Mendel,
1822-1884; s. a. o.) durch die Kombination von je zwei Genen vier Möglichkeiten. Aus dieser „Lotterie“ entsteht dann ein neuer, noch nie
dagewesener Mensch (mit Ausnahme von eineiigen Geschwistern, deren Erbgut
identisch ist).
Die Entdeckung und Kartierung der Anordnung der Gene auf den Chromosomen gelang Thomas Hunt Morgan (1866-1945; Medizin-Nobelpreis 1933). Die (von Morgan noch nicht erfasste) Desoxyribonukleinsäure DNA (Desoxyribonucleic Acid) selbst besteht aus zwei in gewendelter Form individuell unterschiedlich vielfach aneinandergereihten Basenpaaren: Adenin / Thymin (das während des Vererbungsvorganges in der Messenger-RNA mRNA durch Uracil ersetzt wird) und Guanin / Cytosin (s. hier). Entschlüsselt wurde diese (pro Zelle fast 2 m lange) Doppel-Helix nach Vorarbeiten von Erwin Chargaff (1905-2002) von James Dewey Watson (1928-2025) und Francis Harry Compton Crick (1916-2004; Nobelpreis für letztere 1962). Insgesamt hat der Mensch, wie seit der Präsentation der Ergebnisse der ersten vollständigen Sequenzierung des menschlichen Genoms im Rahmen des 1990 bis 2003 durchgeführten Human Genome Projects (s. a. hier) am 26. 6. 2000 durch den 42. US-Präsidenten William Jefferson „Bill“ Clinton (*1946) klar ist, weniger als 30 000 Gene. (Es waren ca. 100 000 erwartet worden. Immerhin 15% der menschlichen Gene sind mit denen der Bananenstaude, etwa die Hälfte mit denen der Maus und ca. 99% mit denen des Schimpansen identisch.) Seit Mai 2021 glaubt man zu wissen, dass die Anzahl der Gene genau 19 969 beträgt (s. hier). Ob bzw. wie gewisse Veranlagungen auch ausgeprägt werden, kann von (An-/Ab)schaltgenen oder auch durch Genmanipulation auf nicht natürlichem Weg beeinflusst werden. Viele Genomabschnitte scheinen gar keine Funktion zu haben (Junk-DNA).
Außerdem sind immer epigenetische Phänomene (darunter versteht man durch Umwelteinflüsse induzierte, im Prinzip reversible Methylierungsmodifikationen, die ohne Mutation Veränderungen der Erbsubstanz ermöglichen, die weitergegeben werden können; s. u.) zu beachten. Dabei geht es darum, ob bzw. wann und unter welchen Umständen welche Gene abgelesen (oder eben nicht abgelesen) werden. Die Epigenetik ist sozusagen das „Abspielgerät“ für das „Tonband“ der Gene. Bekannt ist z. B., dass Väter, die im Alter von etwa 10 bis 13 Jahren Hungerperioden ausgesetzt waren, statistisch überzufällig gesündere und langlebigere Söhne und Enkelsöhne haben. Es ist also auch transgenerationale Vererbung möglich (s. hier), wenn z. B. die bereits im Mutterleib vorhandenen Eizellen eines weiblichen Fötus epigenetisch überformt werden und auf diesem Wege die Enkelgeneration beeinflusst wird.
Krankheiten (bzw. alle Eigenschaften), die auftreten, wenn die diesbezügliche Information auf nur einem der zwei vererbten Gene liegt, nennt man dominant (die Symptome können homozygot allerdings noch schwerer sein als heterozygot), solche, die erst auftreten können, wenn sie auf beiden Genen verankert ist (weil ansonsten das gesunde Allel das kranke kompensiert), rezessiv (und wenn keines von beiden zutrifft, weil z. B. eine rote und eine weiße Blume rosa Nachkommen hat, intermediär). Sind die Gonosomen betroffen, haben ausschließlich weibliche Menschen die Möglichkeit einer Kompensation, da bei Männern ja im Fall einer Schädigung eines Geschlechtschromosoms kein zweites gleichartiges vorhanden ist. Die auf dem X-Chromosom codierten Fehlfunktionen Farbenblindheit oder Hämophilie (Bluterkrankheit) treten deshalb fast ausschließlich bei Männern auf. Das geschädigte Gen kann jedoch von der Frau weitervererbt werden. (Die Trägerin wird zur Konduktorin. Sie selbst wäre nur erkrankt, wenn auch ihr zweites X-Chromosom geschädigt, also ihre Mutter Konduktorin gewesen wäre und ihr geschädigtes X-Chromosom weitergegeben hätte.) Aus demselben Grund können farbenblinde Väter keine farbenblinden Söhne haben (außer die Mutter ist Konduktorin). Prinzipiell kann jedes Chromosomenpaar geschädigt sein, fast alle Anomalien führen jedoch zu Fehlgeburten (m:w im Verhältnis 4:1).
Wahrscheinlichkeiten im Auftreten bestimmter Erbkrankheiten, besonders bei schon vorliegender familiärer Belastung, können in den Genetischen Beratungsstellen (z. B. in Wien) erfragt werden, Spontanmutationen sind allerdings immer möglich. Früchte mit Verlust eines Autosoms sind nie überlebensfähig. Immer öfter können aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts genetisch bedingte Erkrankungen aufgrund von Genanalysen entdeckt und erkannt werden. Dabei wird häufig nur das Exom untersucht (also alle Abschnitte, die Proteine codieren können - insgesamt nur 2% des gesamten Erbmaterials), da dort die meisten relevanten Mutationen entstehen.
Überlebensfähig sind z. B.
| ° |
Morbus
DOWN (auch inkorrekt
„Mongolismus“, korrekt Trisomie 21; benannt nach dem englischen Neurologen und Apotheker John Langdon-Down,
1828-1896, der das Syndrom 1866 zum ersten Mal beschrieb und darüber hinaus
auch erste Beobachtungen zum Prader-Willi-Syndrom
- s. u. - und zum Williams-Beuren-Syndrom
- s. u. - machte): 1959 entdeckte Jérôme
Lejeune, 1926-1994, erstmals
die genetische Ursache: das 3-fache (statt doppelte) Vorhandensein des 21.
Chromosoms, das im ø bei ca. 1 v. 600-700 Geburten auftritt. (In Österreich
lebten 2022 ca. 9000 Menschen mit Trisomie 21. Die Häufigkeit steigt - da die Eizellen nach der Pubertät nicht mehr neu gebildet werden
- mit dem mütterlichen Alter auf bis zu 1:45 bei über 45jährigen an;
es dürfte allerdings auch das Alter des Vaters bzw. das addierte Alter
beider Eltern eine Rolle spielen). Kennzeichen: große Zunge (Makroglossie), überstreckbare Gliedmaßen, Infektionsanfälligkeit, geringere Lebenserwartung, schuppige Haut, schräge Lidachsen (vgl. volkstümlicher Name), Tatzenhand, Vierfingerfurche, Sattelnase, gedrungener Körperbau, Sandalenlücke, oft angeborener Herzfehler, Oligophrenie (Schwachsinn): Zahlenraum meist eingeschränkt, dafür oft erstaunliche Lese- und Schreibfertigkeit. Im Alter sehr häufig Alzheimer-Demenz. (Die das Mentale betreffenden Merkmale haben sich in den letzten Jahrzehnten relativiert; es sind bereits Trisomie 21-Menschen mit höherer Schulbildung bekannt, vor allem solche, an deren Entwicklungsfähigkeit von ihren Eltern und Lehrern geglaubt wurde.) Ursache: Spontanmutation (begünstigt durch chemische Substanzen, ionisierende Strahlung etc.), elterliches Alter oder erbliche Belastungen. Zum Down-Syndrom vgl. auch die Infoplattform Österreich, die alle relevanten Informationen und viele weitere Links enthält. |
| ° | Andere überlebensfähige Anomalien
der Chromosomenzahl: + Edwards-Syndrom (Trisomie 18, 1:7000; nach John Hilton Edwards,1928-2007) + Pätau-Syndrom (Trisomie 13, 1:8000; nach Klaus Pätau, 1908-1975) |
| ° | Syngap1-Syndrom: autosomal-dominant bedingte Retardierung u. a. mit Schlafstörungen, epileptischen und autistischen Symptomen (Mutation des Syngap1-Gens auf dem p-Arm des 6. Chromosoms); geschätzte Häufigkeit 1:15 000 (s. a. hier) |
| ° | Angelman-Syndrom (nach Harry Angelman, 1915-1996): etwa gleich häufig wie Syngap1 wird diese kognitive Behinderung mit Hyperaktivität und einigen physischen Symptomen autosomal verursacht (aufgrund der Bewegungseigenarten und des unmotivierten Lachens der Betroffenen auch Happy-Puppet-Syndrom genannt). Ursächlich ist das Fehlen eines Teils des mütterlichen 15. Chromosoms. (Verschiebt sich das Gleichgewicht umgekehrt zu stark zugunsten dieses mütterlichen 15. Chromosoms, kann das Prader-Willi-Syndrom entstehen (eine nach den Schweizer Ärzten Andrea Prader, 1919-2001, und Heinrich Willi, 1900-1971, benannte Gehirnanomalie). |
| ° | Morbus Alexander (AxD): Nach dem neuseeländischen Erstbeschreiber William Stewart Alexander (1919-2013) benannter, sehr seltener neurodegenerattiver Gendefekt (dominante GFAP-Mutation), der im Kleinkindalter zu fortschreitender Teilerstörung des ZNS und stark verkürzter Lebenserwartung führt. |
| ° | Williams-Beuren-Syndrom (nach John Cyprian Phipps Williams, 1922-?/verschwunden, und Alois J. Beuren, 1919-1984): von einer Deletion des 7. Chromosoms verursachte kognitive Behinderung verbunden mit Minderwuchs und einer speziellen Gesichtsform („Elfen-“, „Koboldgesicht“) |
| ° | Gonosomale Anomalien: Diese Gruppe ist nicht notwendigerweise geistig retardiert. Für die meisten gonosomalen Anomalien gilt Infertilität (Unfruchtbarkeit), eine leichte Tendenz zu Oligophrenie, zu Missbildungen und z. T. (XYY) zu gewalttätigem Verhalten. (Der automatische Umkehrschluss - Männer mit XYY-Merkmal automatisch als gewalttätig zu bezeichnen, nur weil Gewalttäter überproportional das XYY-Merkmal haben - ist jedoch nicht zulässig.) Jedes Y-Chromosom bewirkt phänotypisch Männlichkeit, jedes X-Chromosom (außer das erste) bewirkt in der Chromatinanalyse einen „Drumstick“ und daher genotypische Weiblichkeit. Ohne X-Chromosom kann kein Embryo überleben. + Rett-Syndrom: ca. 1:15000; eine durch das mangelhafte, in der Region Xq28 auf dem X-Chromosom liegende Gen MeCP2 (oder - mit schwerer Epilepsie und verfrühtem Krankheitsbeginn - CDKL5 in der Region Xq22) ausgelöste, nur bei Mädchen auftretende schwere Entwicklungsstörung; erkennbar an stereotypen Knetbewegungen der Finger. Benannt nach dem Entdecker, dem Wiener Pädiater Andreas Rett (1924-1997). + Ullrich-Turner-Syndrom: X-Monosomie (X-Null-Syndrom), Häufigkeit 1:2500, häufigste Chromosomenaberration bei Spontanaborten (Fehlgeburten); von Otto Ullrich (1894-1957) 1930 und Henry Turner (1892-1970) 1938 erstmals beschrieben; die Ursache wurde erst 1959 von Charles Edmund Ford, 1912-1999, entdeckt. In Bezug auf die Intelligenz gibt es kaum Abweichungen von der Normalbevölkerung. Vgl. Österreichische Turner-Syndrom Initiative mit weiteren Links + Tripel-X- Syndrom („Superfemale“, XXX): ca. 1:1000, bei Anstalts-Schwachsinnigen 1:400 + Klinefeltersyndrom (XXY und damit drumstickpositiv): betrifft etwa 1 von 1000 phänotypischen Männern (benannt nach dem Erstbeschreiber - im Jahr 1942 - Harry Fitch Klinefelter jr., 1912-1990). Durch Testosteronsubstitution ab der Pubertät kann, wenn dies gewünscht wird, der männliche Eindruck auf die Umwelt aufrechterhalten bzw. erzeugt werden. Vgl. Klinefelterseite Ö und D + „Supermale“ (XYY): häufigste gonosomale Anomalie. (Innerhalb von Strafanstalten gibt es prozentuell mehr „Supermales“ als außerhalb.) |
| ° | Strukturanomalien: z. B. Cri-du-chat-Syndrom: ein Stück des kurzen Armes des Chromosoms Nr. 5 fehlt. Merkmale: geringer Kopfumfang, weiter Augenabstand, tiefstehende Ohren, maunzendes Schreien (Name!) |
| ° | Stoffwechselerkrankungen, z. B. PKU (Phenylketonurie; auf Deutsch Brenztraubensäureschwachsinn; s. a. PKU-Informationsseite): Autosomal rezessiv vererbt, kann das Phenylalanin, ein Bestandteil aller tierischen und pflanzlichen Eiweiße, nicht zu Tyrosin abgebaut werden, da das Gen, das das dafür nötige Enzym erzeugt, homozygot geschädigt ist. Häufigkeit: etwa 1:11 000. Es muss von Beginn an phenylalaninarme Kost verabreicht werden, da sonst durch die Vergiftung des Nervensystems schwerste Intelligenzdefekte die Folge sind. (Auch nach Abschluss der Hirnentwicklung ist Vorsicht geboten.) Ein solches präventives Vorgehen existiert seit 1963, als nach Forschungen von Robert Guthrie, 1916-1995, der selbst einen betroffenen Sohn hatte, im Rahmen eines Screenings ein PKU-Test bei allen Neugeborenen möglich wurde. (Vgl. Guthrie-Test) |
| Andere Beispiele (ebenfalls autosomal rezessiv vererbt): Galaktosämie (Milchzuckerunverträglichkeit, v. a. bei Afroamerikanern) und die Ahornsiruperkrankung (hier ist der Abbau von im Eiweiß enthaltenen Aminosäuren gestört; gehäuft z. B. bei den Mennoniten). | |
| ° | Lissenzephalie (vgl. Seite bei onmedia.de): Oberbegriff für genetisch (aber auch auf andere Weise) bedingte Baufehler im Gehirn. Die Großhirnrinde bleibt glatt (gr. λισσος;), was zu einer lebenslangen schweren Beeinträchtigung und Pflegebedürftigkeit führt. Beispiele: Miller-Dieker-Syndrom (nach James Quinter Miller, 1926-2005, und Hans Dieker, 19??-????) mit epileptischen Anfällen oder Walker-Warburg-Syndrom (nach Arthur Earl Walker, 1907-1995, und Mette Warburg, 1926-2015) mit kongenitaler Muskeldystrophie. |
* Embryopathien (intrauterin erworbene Schädigungen) aufgrund biologischer Noxen (Schädigungsfaktoren):
| ° | Rubeolae-Infektion: Eine (durch Viren verursachte) Rötelnerkrankung der Mutter während der Schwangerschaft kann zu Sinnesstörungen (Erblindung, Taubheit) und Schwachsinnigkeit führen. Als Vorbeugemaßnahme erhalten in Österreich alle Mädchen vor Eintreten der Geschlechtsreife die Möglichkeit einer Impfung. |
| ° | Toxoplasmose: An sich ungefährliche, aber beim Embryo Oligophrenie hervorrufende (durch Protozoen verursachte) Infektion, die v. a. durch rohes Fleisch (Beef tartar) und Haustiere (v. a. Hunde-, Katzen-, Vogelkot) übertragen werden kann. Ein Toxoplasmosetest am Beginn jeder Schwangerschaft klärt, ob die Mutter (oft ohne es bemerkt zu haben) bereits erkrankt war (und daher aufgrund der lebenslangen Immunität keine neuerliche Infektionsgefahr mehr vorliegt) oder Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss. - Vgl. diese Seite |
| ° | Zytomegalie: Das Speicheldrüsenvirus (nur pränatal ernst) infiziert die Plazenta und verändert die Leber und den blutbildenden Apparat, auch zerebrale Störungen kommen vor. (In Wien auf 1:1000 geschätzt) |
| ° | Lues: von Bakterien verursachte Geschlechtskrankheit (Syphilis); Hirnschäden können ev. sekundär im weiteren Verlauf der Erkrankung auftreten. |
| ° | AIDS: durch das HIV-Virus während des Geburtsvorganges verursachtes „erworbenes Immunschwäche-Syndrom“; Hirnschäden können ev. sekundär im weiteren Verlauf der Erkrankung auftreten (sind aber seit der Entwicklung wirksamer antiviraler Kombinationspräperate auf medizinisch unterversorgte Gebiete beschränkt). |
| ° | Zika-Virus: kann, wie am Wiener Institut für molekulare Biotechnologie IMBA anhand von Organoiden festgestellt wurde, beim Fötus Mikrozephalie bewirken, wenn sich eine Schwangere damit infiziert. |
* Embryopathien aufgrund physikalischer Noxen
| ° | Mechanische Einwirkungen: etwa durch Unfälle oder Misshandlungen während der Schwangerschaft |
| ° | Sauerstoffmangel: eher perinatal |
| ° | Ionisierende Strahlen:, Gefahr droht z. B. bei Reaktorunfällen oder Röntgenaufnahmen (nach Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-1923; 1901 erster Physiknobelpreisträger), da die Strahlung mutagen wirkt. (Dies wurde vom US-amerikanischen Genetiker Hermann Joseph Muller, 1890-1976; Medizin-Nobelpreis 1946, entdeckt. Die Erhöhung der Mutationsrate durch Röntgenstrahlen wurde später vom US-amerikanischen Agrarwissenschaftler Norman Borlaug, 1914-2009, in der „Grünen Revolution“ bewusst eingesetzt, um die Nahrungsmittelproduktion zu verbessern, wofür er 1970 den Friedensnobelpreis erhielt. Seit 2012 ist dies durch die von der Französin Emmanuelle Marie Charpentier, *1968, und der US-Amerikanerin Jennifer Anne Doudna Cate, *1964, entwickelten CRISPR-Genschere - Chemienobelpreis für beide 2020 - zielgenau möglich.) |
* Embryopathien aufgrund körpereigener sowie körperfremder chemischer Noxen
| ° | Morbus haemolyticus neonatorum
(Blutgruppen-/Rhesusunverträglichkeit): Trägt eine rhesusnegative Mutter ein
rhesuspositives Kind aus, so bilden sich aufgrund der fetomaternalen
Transfusion während des Geburtsvorganges Antikörper, die die Blutkörperchen
ihres nächsten Fötus angreifen können. Dies bewirkt Hirnschädigungen, was
durch Verabreichung einer Rhesusfaktorprohylaxe kurz nach der ersten Geburt
verhindert werden kann. Auch ein Blutaustausch noch im Mutterleib ist
möglich. Selten gibt es auch bei bestimmten Blutgruppen-Konstellationen
ähnliche Erscheinungen. (Das AB0-Blutgruppensystem wurde 1900 vom
ehemaligen Wasagymnasiasten Karl Landsteiner,
1868-1943, Medizin-Nobelpreis 1930, entdeckt. Fast 40 Jahre später fand er auch die
Rhesusfaktoren. Außerdem wies er nach, dass Poliomyelitis ansteckend ist.) Vgl. Seite bei onmedia.de |
| ° | Hormonelle Einflüsse: v. a. stressbedingt ausgeschüttete Hormone und Hormone diabeteskranker Mütter (die zu Hyperinsulinismus mit nachfolgender Hypoglykämie in den ersten 4 Stunden nach der Geburt und vermehrt zu Missbildungen führen können) |
| ° | Medikamente, z. B. die Contergan-Katastrophe 1958-1962: die gutgläubige Einnahme des unter den Namen „Contergan“ und „Softenol“ vom deutschen Pharmaunternehmen Grünenthal gehandelten Schlaf- u. Beruhigungsmittels Thalidomid (C13H10N2O4) in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten bewirkte Phokomelie (Missbildungen an Gliedmaßen). Das Medikament wurde nach der Entdeckung dieses Zusammenhangs in zivilisierten Staaten 1961/62 aus dem Verkehr gezogen. (Viel später wurde Thalidomid in der Krebsbekämpfung eingesetzt). |
| ° | Gifte: v. a. Nikotin, das durch die Verengung der Blutgefäße die Sauerstoffzufuhr reduziert. Kinder von Raucherinnen sind im Durchschnitt leichter als die von Nichtraucherinnen, eine ursächliche Beteiligung geistiger Behinderung konnte aber nicht nachgewiesen werden. Es gibt allerdings leichte Hinweise auf ein erhöhtes Auftreten von ADHS (s. u.). |
| ° | Alkohol: ruft schwerere Missbildungen im Rahmen des fetalen Alkoholsyndroms hervor (multipler Dysplasie-, Dysmorphiekomplex); häufig sind Herzschädigungen (etwa bei 1/4 der geschädigten Kinder) und Sinnesbehinderungen. Zur Zeit ist Alkohol in der westlichen Welt (und v. a. in Österreich) das wichtigste Teratogen (= Missbildungsverursacher) und betrifft bereits jedes 250. Kind. - Vgl. Alkohol in der Schwangerschaft |
| ° | Vitaminmangel: v. a. bei Mangelernährung (Problem der 3. Welt) |
| ° | Drogen: Der Konsum von Rauschmitteln während der Schwangerschaft (zu Cannabis s. u.) führt zu Abhängigkeit des Fötus, der nach der Geburt unter Entzugserscheinungen (s. u.) leidet (dem einzigen Fall von physischer ohne psychische Abhängigkeit). |
| ° | Neuralrohrdefekte: Aus nicht immer zuordenbaren Gründen (z. B. Folsäurenmangel, Epilepsiemedikamenteinnahme, Diabetes mellitus oder Virusinfektionen während der Schwangerschaft) kann es zu einer Anenzephalie (einem teilweise oder vollständigem Fehlen des Großhirns; oft nur kurz lebensfähig und auf jeden Fall mit der Entwicklung von Intelligenz unvereinbar; Prävalenz 1 Promille) oder einer Spina bifida (Spaltung der Wirbelsäule mit tw. offenem Rücken; ohne weitere Schädigungen normalerweise ohne kognitive Beeinträchtigungen) kommen. |
Einige der erwähnten Embryopathien führen nicht notwendigerweise zu geistiger Behinderung: Aufgrund der relativ kleinen beobachtbaren Zahlen sind nicht alle Differentialdiagnosen zwingend auszuschließen.
- Perinatal verursachte Behinderungen:
* Durchblutungsstörungen: Bei der Geburt kann es aus
mechanischen Gründen - wenn das Kind in der Austreibphase zu lange im Geburtskanal steckt
oder es durch einen Vorfall der Nabelschnur zu einer Abquetschung der Blutgefäße
und damit zu Durchblutungsstörungen und einem Sauerstoffmangel des Gehirns kommt
- zu
im Extremfall bleibenden Schäden, z. B. einer hemiplegischen (halbseitigen) spastischen
Lähmung, kommen.
* Hirnverletzungen: durch mechanische Einwirkung (z. B. während einer Zangengeburt) entstehende Gehirnblutungen o. ä. (Durch moderne Geburtsüberwachungsmethoden haben sich die Aussichten auf eine komplikationslose Geburt erheblich verbessert, es besteht aber ein erhöhtes Risiko zu intrakraniellen Blutungen, wenn das Kind aus der Beckenendlage geboren wird.)
* Atemstörungen: Schwierigkeiten beim In-Gang-Kommen des pulmonalen Gasstoffwechsels (der eigenständigen Lungenatmung) können gefährliche Folgen zeitigen, v. a. wenn eine verlängerte primäre Apnoe (eine Lähmung des Atemzentrums durch Sauerstoffmangel, oft bedingt durch Gabe von Narkotika während der Geburt) vorliegt. Eine Asphyxie (Sauerstoffmangel, eig. „Pulslosigkeit“) muss durch Reanimation behoben werden.
* Epilepsie (Zerebrale Krampfanfälle): Epilepsie (früher „Fallsucht“) ist nicht ausschließlich perinatal verursacht, manifestiert sich aber z. T. am Lebensbeginn. Betroffen sind zwischen 0,5% und 1% der Bevölkerung, wobei das erste Auftreten v. a. in den ersten beiden Lebensjahren oder ab dem 60. Lebensjahr liegt. Es existieren - abhängig vom betroffenen Gehirnareal (man unterscheidet fokale, nur ein Hirngebiet betreffende, und generalisierte Epilepsien) - zahllose Symptome und Erscheinungsformen vom Petit Mal (einer nur sekundenlangen Bewusstseinstrübung, auch Absence genannt) bis zum Grand Mal mit Zungenbiss, Schaum vor dem Mund, Sturz (Verletzungsgefahr! Gegenstände aus dem Weg räumen und stabile Seitenlage ohne Festhalten anstreben! Nichts in den Mund stecken!) und minutenlangem Toben („Krankheit mit 1000 Gesichtern“). Tritt ein sich nicht lösen wollender Status epilepticus ein, muss dieser, um neurologische Folgen zu vermeiden, medikamentös durchbrochen werden. Die vor dem Erwachsenenalter auftretende Rolando-Epilepsie (irrtümlich nach dem italienischen Anatomen Luigi Rolando, 1773-1831, benannt, obwohl sie erstmalig der deutsche Badearzt und Alchemist Martin Ruland der Ältere, 1532-1602, beschrieben hat) heilt oft von alleine aus.
Bei der Epilepsie entsteht durch Übertragungsfehler im Gehirn ein plötzliches, gleichzeitiges, unsynchronisiertes und daher vom Gehirn nicht mehr adäquat interpretierbares Feuern von Nervenzellen. Durch kurzschlussartige Entladungen (Spikes and Waves im EEG, s. o., weisen Epilepsie nach) werden chronisch wiederkehrend Anfälle ausgelöst und danach ein Neuaufbau der elektrischen Gehirnstrukturen ermöglicht. (Das Gehirn „fährt“ - wie ein abgeschalteter Computer - wieder „hoch“.) Mögliche Trigger sind Flackerlicht (manchmal Bildschirme), elektrische Schläge, Schlafentzug, Medikamente, Fieber etc. In manchen Fällen bewirkt eine Aura (griech. αὔρα „Lufthauch“; Begriff von Galenos / Γαληνός, ca. 130-210), dass Patienten einen bevorstehenden Anfall erkennen können. Etwa ein Drittel aller Epilepsieursachen bleibt ungeklärt.
Entgegen immer noch bestehenden Klischeebildern ist Epilepsie keine
geistige Behinderung, wenn sie eine solche auch manchmal begleitet. Gehirne
können allerdings durch hohe Anfallszahlen geschädigt und in ihrer Entwicklung
beeinträchtigt werden. Durch rechtzeitige Gabe passender, individuell
abzustimmender Medikamente (Antiepileptika, Antikonvulsiva) können jedoch bis zu zwei Drittel aller Patienten
anfallfrei gemacht werden. (Das erste wirksame Medikament war 1857 Brom.)
Weitere (seltenere) Therapiemöglichkeiten bestehen in der operativen Entfernung
des Anfallsherdes, einer Callosotomie (s. o.),
in Hirnschrittmachern oder Gentherapien und
mRNA-Behandlungen.
Vgl.: Epilepsie-Dachverband Österreich, Deutsche Gesellschaft für Epileptologie,
alles über
Epilepsie
und die seit 1979 im deutschen Sprachraum führende Klinik
Epileptologie Bonn
- Postnatal verursachte Behinderungen:
Vgl. folgendes
Video, das einige
Phänomene erläutert; Zustandsbilder, die sich erst nach dem 18. Lebensjahr
manifestieren, werden oft nicht unter dem Begriff „geistige Behinderung“
subsumiert.
* Unfälle (Schädel-Hirn-Trauma SHT; häufiger als Schlaganfälle): Unfallfolgen verursachen (zumindest bis zu den altersbedingten Ausfällen) die größte Gruppe postnatal Hirngeschädigter. Das Locked-in-Syndrom (mit Erhaltung des Bewusstseinszustandes, aber mit stark eingeschränkter Kommunikationsmöglichkeit; s. o.) und das Apallische Syndrom (längere Phase der Bewusstlosigkeit, „Wachkoma“ - Stammhirnfunktionen ohne Großhirnfunktionen; s. o.) bilden den Übergang zu einer oft nur teilweise glückenden Rehabilitation. Buben / Mädchen verunglücken im Verhältnis 4:1. Je jünger das Kind, desto besser die Chance auf eine Funktionsübernahme anderer Hirnpartien (s. o.); kaum mehr nach dem vierten Lebensjahr (der fixen Ausprägung der Händigkeit). Eine größere Rolle als vermutet spielen Misshandlungen. Viele SHTta bleiben ohne Langzeitfolgen, vor allem ihre Vorstufe: die Gehirnerschütterung (Commotio cerebri, oder - schwerwiegender - Contusio cerebri), die aber durch Häufigkeit ebenfalls zu einem Risikofaktor werden kann.
* Gehirn(haut)entzündungen: (Meningitis, Enzephalitis), können Dauerschädigungen hervorrufen, z. B. die durch das FSME-Virus ausgelöste und von Zecken übertragene Frühsommermeningitis/-enzephalitis
* Tumore: können Druck auf wichtige Hirnteile ausüben und müssen daher auch bei Gutartigkeit oft entfernt werden. Bösartig zerstören sie Hirnareale. Bei jeder Operation ist es notwendig, eine „Landkarte“ des Operationsgebiets zu erstellen und nach Möglichkeit nicht in essentielle Hirnteile hineinzuschneiden oder sie gar zu entfernen. Dieses Ziel ist aber häufig unerreichbar, vor allem dann, wenn der benigne oder maligne Tumor gerade dort lokalisiert wird.
* Schlaganfälle: Insulte (Hirninfarkte, Apoplexiae cerebri) aufgrund von Gehirnblutungen oder Gefäßverstopfungen können wegen der damit einhergehenden Sauerstoffunterversorgung des Gehirns und damit der Außer-Kraft-Setzung ganzer Partien durch Gewebszerstörung den Ausfall wichtiger Funktionen des ZNS verursachen; es gibt aber oft erstaunliche Remissionen. Schlaganfälle stellen durch die stetig steigende Lebenserwartung eine zahlenmäßig zunehmende Behinderungsursache dar. Ursache von Schlaganfällen bei jüngeren Menschen ist oft ein PFO (persistierendes Foramen ovale, also ein kleines angeborenes Loch zwischen den beiden Herzvorhöfen) . Spontane Hirnblutungen (ohne Unfall) ermöglichen weit mehr Organspenden als verunglückte Motorradfahrer.
Eine neuropsychologische Störung als Folge eines Schlaganfalls kann die
Einschränkung oder der Verlust der Bewusstseinseinheit sein (Neglect).
Dabei wird die der Läsion gegenüberliegende Körperhälfte bei fehlender
Krankheitseinsicht nicht mehr als die eigene wahrgenommen bzw. vernachlässigt.
Was dort passiert bzw. sinnlich wahrgenommen werden müsste, wird trotz intakter
Sinnesorgane ignoriert, da die Verarbeitung der Daten im Gehirn nicht mehr
funktioniert.
Vgl. Schlaganfall-Informationen
* Demenzerscheinungen: Wie zerebrale Insulte nehmen durch die immer höhere Lebenserwartung auch neurodegenerative Erkrankungen wie die Altersdemenz zahlenmäßig zu. In Österreich leben etwa 150 000 Menschen (etwas unter 2% der Gesamtbevölkerung) mit Demenzerkrankungen. („Der beste Weg, sich vor Demenz zu schützen, besteht darin, vorher zu sterben.“) Demenz bedeutet wörtlich „Abbau des Geistes“ (der umso länger braucht, je höher man oben war). Die wichtigste Erscheinungsform ist die durch das Vorhandensein des APOE4-Gens (das Eiweiß Apolipoprotein E liegt auf dem 19. Chromosom) begünstigte Alzheimer-Erkrankung (vgl. Test; nach Aloysius / Alois Alzheimer, 1864-1915, der 1906 die Erkrankung als erster beschrieb; zunächst Assistenz- und Oberarzt in der vom Struwelpeter-Autor und -Zeichner Heinrich Hoffmann, 1809-1894, gegründeten Städtischen Irrenanstalt Frankfurt, danach Habilitation bei Kraepelin, s. u.). Sind zwei Allele dieses Gens im Erbgut vorhanden (wie bei ca. 2% der Bevölkerung), konstituiert dies eine eigene Form der Alzheimer-Demenz. (Ab ca. dem 55. Lebensjahr erhöhen sich laufend die entsprechenden Biomarker im Blut.) 50-60% aller Demenzkranken, davon ein hoher Prozentsatz gealterter Trisomie 21-Patienten, haben Alzheimer (wenn auch nicht jedes Vergessen, das oft auf mangelnde Aufmerksamkeit zurückzuführen ist und in späteren Lebensjahren nicht pathologisch sein muss, Demenz ist). Beginnend als Mild Cognitive Impairment ist die Krankheit progressiv und irreversibel. Das Hirn, das durch seine Redundanz gegen Ausfälle relativ robust ist, sucht, wenn ihm manches nicht mehr möglich ist, noch lange nach anderen Lösungen, sodass oft bei vor Ausbruch ihrer Demenzerkrankung scheinbar gesund verstorbenen Menschen ein „Alzheimer-Gehirn“ präpariert werden kann. Der diesbezügliche Nachweis erfolgt postmortal neuropathologisch-histologisch anhand von Ablagerungen von extrazellulären Beta-Amyloid-Proteinen in der grauen Hirnsubstanz, sogenannten „senilen Plaques“, degenerativen nervalen Strukturen (durch Eiweiße geschädigten Nervenzellen), pathologischen Neurofibrillen, Neuropilfäden, vaskulärer Degeneration und hirnatrophischen Veränderungen. PET-Untersuchungen (s. o.), Nervenwasser- und Blutanalysen ermöglichen es immer früher, die Alzheimer-Erkrankung festzustellen, indem Biomarker im Blut oder die typischen Eiweißablagerungen detektiert werden.
Dies alles bewirkt (zumindest) eine anterograde Amnesie. Neue Bewusstseinsinhalte können nicht mehr gespeichert bzw. abgerufen werden. (Die von den Erinnerungen immer auch mittransportierten Bedeutungen und Gefühle bleiben meist länger erhalten als die Inhalte. Auch Gerüche, Geschmäcker und das musikalische Gedächtnis bestehen oft in erstaunlichem Ausmaß weiter.) Weitere Symptome können in einer frühen Beeinträchtigung oder gar dem Verlust der Körperwahrnehmung bestehen. Die Krankheit - oft als mild cognitive impairment MCI beginnend - führt notwendigerweise zu von den Angehörigen schwer zu akzeptierenden Persönlichkeitsveränderungen, da die Kontrollfunktion der Kognition bei aufsteigenden Gefühlen verloren geht. (S. o. zum Unterschied zwischen Persönlichkeit und Person.) Nicht-kognitive Symptome bei Demenzerkrankungen (z. B. Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Depressionen, Angstzustände, Apathie, Aggression) werden als Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) oder Neuropsychiatric Symptoms (NPS) bezeichnet.
Eine suffiziente Therapie steht nicht zur Verfügung. Hoffnungen weckt der 2023 in den USA zugelassene und 2024 von der EMA unter gewissen Bedingungen (s. hier) empfohlene Wirkstoff Lecanemab (das Medikament mit dem Handelsnamen Leqembi muss alle zwei Wochen gespritzt werden), der Antikörper enthält, die sowohl Verklumpungen der Amyloidproteine zu verhindern wie auch Immunzellen, die dieses Eiweiß zerstören können, zu aktivieren imstande sind.
Als Alzheimerprävention (die die Krankheit - wie auch Lecanemab - nicht verhindern, aber deutlich verzögern kann) gilt - neben ausreichendem Schlaf - das Aufrechterhalten kognitiver Fähigkeiten (z. B. durch Fremdsprachen), sozialer Beziehungen sowie von Bewegung und Sport (bis ins hohe Alter). Alle drei Komponenten werden z. B. im Tanzen vereint. Wichtig ist, dass die Nervenzellen aktiv bleiben; Sport und Bewegung sind dabei wichtiger als Denksport und Bildung (deren Rolle bei der Hirnalterung nicht überschätzt werden sollte, wiewohl sie eine „passive kognitive Reserve“ bilden, die trotz Hirnabbau noch einige Zeit wirksam bleibt) da die dadurch freigesetzten Endorphine die Stresshormone hemmen. Acetylcholinesterasehemmer scheinen die Krankheit ein wenig verzögern zu können, allerdings bewirken sie im Moment nicht viel mehr als einige Monate Aufschub. (Zum Vergleich: Zweisprachigkeit bringt fünf Jahre.) Auch ein medikamentöser Eingriff in den Serotoninhaushalt scheint ein Ansatzpunkt zu sein. (Zu Digitaler Demenz s. o.)
Die Lancet-Kommission (nach der bekanntesten medizinwissenschaftlichen Zeitschrift) definierte 2020 12 Demenz-Risikofaktoren, die gemeinsam 40% aller Ursachen abdecken würden (60% seien unbekannt): Hörverlust (8%), mangelnde Bildung in jungen Jahren (7%), Rauchen (5%), Depressionen (4%), soziale Isolation (4%), Schädel-Hirn-Trauma/ta (3%), Bluthochdruck (2%), Bewegungsmangel (2%), Luftverschmutzung (2%), Alkohol (1%), Übergewicht (1%) und Diabetes (1%). Viele dieser Faktoren sind deshalb so niedrig gewichtet, da sie mit einem frühen Tod (noch vor Ausbrechen einer Demenz) assoziiert sind. Davon unabhängig wurde das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, wenn dauerhaft weniger als sechs Stunden geschlafen wird, als 30% erhöht quantifiziert. Nicht unterschätzt werden sollten die negativen Auswirkungen von ELS (early-life stress; vgl. dazu die Studie Early-Life Adversity Predicts...).
Andere Demenzerkrankungen: die Lewy-Körperchen (Body)-Demenz (nach Friedrich H. Lewy, 1885-1950: eine Mischform aus Alzheimer und Parkinson, benannt nach James Parkinson, 1755-1824, die oft mit Halluzinationen, Depressionen und Bewegungsstörungen verbunden ist), der frontotemporal lokalisierbare und oft schon früh auftretende Morbus Pick (nach dem Prager Neurologen Arnold Pick, 1851-1924) und vaskuläre Demenzen, die auf Durchblutungsstörungen zurückzuführen sind (Multi-Infarkt-Demenz oder Mikroangiopathie bzw. SAE: subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie). Atrophische Prozesse (Hirnschwund in manchen Arealen) muss man im Laufe des Alterns unabhängig vom Bildungsgrad in Kauf nehmen, wenn auch geistige Beschäftigung einen kognitiven Vorsprung gewährleistet.
Zur Neuropathologie der Demenzen vgl. hier. Vgl. a. Video-Lecture von dem in Wien geborenen und von dort 1938 vertriebenen Eric E. Kandel (*1929; Nobelpreis 2000) über das Gedächtnis im Allgemeinen und seinen möglichen Verlust im Alter und die Seite des National Alzheimer’s Coordinating Centers (hier)
- Andere Entwicklungsstörungen:
Die im Folgenden erwähnten Zustandsbilder werden seit 2011, als in New York das
National Symposium of Neurodiversity stattfand, häufig unter dem als politisch
korrekter geltenden Begriff Neurodiversität zusammengefasst. Ziel dieser
Umbenennung ist es, den Anschein von Krankheit oder Störung zu vermeiden. Wie
häufig in ähnlichen Fällen erwartet man sich dadurch eine Verbesserung für die
Betroffenen, die aber womöglich höhere Forschungsgelder und konkrete Maßnahmen
eher zu schätzen wüssten als Euphemismen.
* Autismus: Der Begriff (früher irreführend manchmal als „Schizophrenie im Kindesalter“ bezeichnet) wurde 1911 von Eugen Bleuler (s. u.) geprägt und später erweitert und differenziert (vgl. ICD F 84 und Seite über Autismus). Es handelt sich um eine meist im ersten Lebensjahr mit einer Prävalenz (nach neueren Schätzungen und je nach Definition) von bis zu 1% auftretende tiefgreifende Persönlichkeits- und Kommunikationsstörung (es sind viel mehr Buben als Mädchen betroffen) mit folgenden Symptomen (die nicht immer alle auftreten): Verweigerung des Blickkontakts, schlechte Gesichtserkennung, die Kinder sprechen nicht, verweigern Kontaktaufnahme und Interaktion, setzen zwanghaft-repetitive, stereotype Bewegungen (sind z. B. von sich drehenden Gegenständen fasziniert), zeigen Detailfixierung, eingeschränkten Sprachgebrauch, mangelnde Flexibilität, Tunnelblick (Konzentration auf nur einen Sinn, ein Interessensgebiet, eine Problemlösungsstrategie etc.), häufiger logisch-rationale als ganzheitlich-intuitive Herangehensweisen, Schwierigkeiten bei differenzierter Gefühlswahrnehmung, -dechiffrierung und -kommunikation u. a. m. Eine Schiene ins Innere legen manchmal die Animal Assisted Therapy AAT oder die Musiktherapie, die auch bei Behinderungen oft erfolgreich sind; vgl. No problem Orchestra).
Das klinische Bild wurde 1943 von Leo Kanner (1894-1981; einem österreichstämmigen, Anfang der 20er-Jahre in die USA ausgewanderten Arzt) zum ersten Mal als „autistische Störung des affektiven Kontakts“ beschrieben. Der Wiener Pädiater Hans Asperger (1906-1980) erforschte fast zeitgleich im Unterschied dazu die oft erst mit 3;0 auftretende „autistische Psychopathie“. Mögliche Merkmale: Mangel an Empathie, die Unfähigkeit, Freundschaften zu schließen, Störungen in Blickkontakt, Gestik, Mimik und Motorik, ironischer und bildhafter Sprachgebrauch, Inselbegabungen bzw. intensive Beschäftigung mit einem Interessensgebiet bei durchschnittlicher bis hoher Intelligenz. Die ursprüngliche Zwei- (Drei)teilung in frühkindlichen Autismus (mit schweren Beeinträchtigungen), atypischen Autismus und Asperger-Autismus (mit guten Chancen auf ein selbstständiges Leben) wurde zugunsten der Vorstellung eines Autismus-Spektrums, das zahllose Varianten aufweisen kann, aufgegeben.
Die Ätiologieforschung ist nach wie vor im Gange. Ursprünglich machte man fälschlich emotional reduzierte „Kühlschrankmütter“ verantwortlich (so Bruno Bettelheim u. a.; s. a. u.). Heute geht man von 90% Genbeteiligung aus (z. B. durch NOVA1, das auch - s. o. - tw. die Sprachfähigkeit steuert), wobei die Umwelt den Ausprägungsgrad des nicht neurotypischen Zustandsbildes (also eines mit abweichender neurologischer Entwicklung) bestimmt. Die moderne Hirnforschung hat entdeckt, dass bei Autisten das Objekterkennungsareal im Gehirn auch dann aktiviert wird, wenn bei gesunden Menschen das Gesichtserkennungsmodul (sogenannte Face-Patches - s. a. o. - auf der Großhirnrinde; s. a. o.) arbeitet. Es scheint eine Störung im Bereich der Spiegelneuronen (s. o. und a. u.) vorzuliegen. Nach der Hypothese des zerbrochenen Spiegels (s. hier) von Lindsay Obermann (*1978?), Vilayanur Subramanian Ramachandran (*1951; s. a. o.) u. a. sei die Zusammenarbeit der Spiegelneuronen mit anderen Hirnteilen (v. a. im präfrontalen Cortex) gestört, was zu Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Situationen führe.
* ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung): In der frühen Kindheit (aber auch noch im Erwachsenenalter) bei einer Prävalenz von ca. 5% (3/4 Buben) auftretende Unfähigkeit zur Selbstregulation von Emotionen und Verhalten. Die Hauptsymptome sind Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität (ICD F 90.0). Eine Gefahr besteht (später) in der erhöhten Komorbidität mit Suchterkrankungen. Die Erkrankung ist großteils kongenital bedingt (ev. verursacht von Formveränderungen bestimmter Hirnteile, Schädigungen des ZNS durch Nikotin und/oder Alkohol während der Schwangerschaft oder minimal brain diseases anderer Ätiologie) und steht im Zusammenhang mit Störungen der Signalübertragung durch die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin (die zu schnell abtransportiert werden, sodass ein Mangel im synaptischen Spalt entsteht). Deshalb wirkt oft Methylphenidat (z. B. in Ritalin enthalten; hebt den Dopaminspiegel), das aber weltweit in verantwortungsloser Weise viel zu häufig und teilweise ohne ärztliche Begleitung verabreicht wird. (ADHS war früher als „minimale zerebrale Dysfunktion“, „hyperkinetisches Syndrom“, „Zappelphilippsyndrom“ etc. bekannt, kann aber heute aufgrund besserer Möglichkeiten genauer und häufiger als Hirnstoffwechselproblem, das nicht dem freien Willen unterliegt, diagnostiziert werden; vgl. folgende zwei Vorträge: 1 bzw. 2.)
* Weitere Entwicklungsstörungen: angeborene oder erworbene sprachliche, schulische, motorische bzw. nicht näher definierte Entwicklungsstörungen aller Art, wobei in allen Fällen der Diagnose keine allgemein (auch in allen anderen Bereichen) stark reduzierte Intelligenz zugrunde liegen sollte. Hierher gehören z. B. die Legasthenie (Lese-, Rechtschreibschwäche, deren Grundlage in einer Störung der seriellen Verarbeitung von Wahrnehmungsinhalten - s. a. u. - zu suchen sein dürfte; auch Dyslexie bis zur Alexie) und die Dyskalkulie (Störung des Zahlensinns; bei Rechenunfähigkeit - z. B. als Folge eines Schlaganfalls - spricht man von Akalkulie). Ein Zusammenhang zwischen rechnerischem Denken und Sprache zeigt sich z. B. darin, dass auch Personen, die nach ihrer Emigration jahrzehntelang eine andere Sprache verwendet haben, trotzdem in ihrer Muttersprache rechnen.
Vgl. Die Wissenschaft Pädagogik, Wörterbuch der Erziehung (7. Punkt; 11 Kapitel mit Abb.), Methodik der Erziehungswissenschaft, Manfred Spitzer, Medizin für die Bildung - ein Weg aus der Krise (2010)
* Pädagogik ist die Wissenschaft von den methodisch begründeten Erkenntnissen, die erzieherische (gewissensbildende) und lehrende (unterrichtliche) Einwirkungen (s. o.) im Verhältnis Erzieher-Zögling zum Gegenstand haben. (In jeder Praxis findet sich rudimentäre, unausgewiesene und unreflektierte Pädagogiktheorie. Aus dieser Tatsache rechtfertigt sich ein methodisches Vorgehen, um pädagogische Handlungen auch rational begründen zu können.)
* Methode ist nach Marian Heitger (1927-2012) letztlich der Gegenstand selbst, in der Prozesshaftigkeit seines Erkannt-Werdens gedacht.
* Methodik ist der Unterricht in seiner Prozesshaftigkeit, also die angewandte Methode im Hinblick auf die jeweilige
* Individuallage: das vom Zögling jeweils erreichte und vom Lehrenden bzw. Erziehenden zu berücksichtigende Niveau von Wissen („richtig - falsch“; Quelle: Unterricht) und Haltung („gut - böse“; Quelle: Erziehung).
* Bildung (das Wort stammt vom deutschen Mystiker Meister Eckhart, ca. 1260-ca. 1328): dieser in anderen Sprachen in dieser Form nicht existente Begriff bezeichnet den durch Unterricht und Erziehung erzielten Prozess der Entwicklung und Ausdifferenzierung ästhetischer, kognitiver und moralischer Strukturen bzw. dessen Ergebnis. Bildung hat seinen „Zweck“ in sich selbst (auch und gerade das vermeintlich Nutzlose hat seinen Platz) und ist ein Menschenrecht: Vgl. Art. 26 der (unverbindlich empfehlenden) Allgemeinen der Erklärung der Menschenrechte: „Jeder Mensch hat Recht auf Bildung“ und Art. 2 der (rechtsverbindlichen und beim EGMR einklagbaren) Europäische Menschenrechtskonvention: „Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden“.
* Ausbildung bezeichnet die zweckorientierte Aneignung von spezifischen Inhalten, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die an Rentabilität orientiert ist und spätere Anwendbarkeit in Handlungsketten anstrebt.
* Wissen (das auch ohne Bildung vorhanden sein kann) besteht in der Anhäufung von Bildungsinhalten, die dann zur Voraussetzung für Bildung werden, wenn sie der / die Lernende (im Gegensatz zu reiner Information) für sich selbst verbindlich gemacht hat.
* Lernen (s. a. o. bzw. u.) geschieht lebenslang permanent (auch informell und ohne Absicht) und bezieht sich auf den vom Zögling zu leistenden Anteil am didaktischen Geschehen.
* Erziehung bedeutet eine intentionale, pädagogische Führung mit dialogischer Grundstruktur, die auf den Erwerb einer Haltung abzielt. Sie appelliert an die eigene Einsicht und will kritisches Bewusstsein schaffen.
* Lehren bezeichnet eine absichtsvolle, planmäßige, meist institutionalisierte und verberuflichte pädagogische Führung, die auf den Erwerb von Wissen abzielt. (= Unterricht; vgl. Art. 26 der AEMR: „Der Unterricht muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein“ und Art. 2 der EMRK: „Der Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.“)
* Didaktik nennt man die Lehre von der Lehre: von ihren Möglichkeiten, Methoden und Inhalten, z. B. nach dem
6-Stufen-Modell von Heinrich Roth (1906-1983)
| ° | 1. Stufe der Motivation (Antrieb; Motivation kann intrinsisch oder extrinsisch sein; s. u.) |
| ° | 2. Stufe der Schwierigkeiten (widerstehendes Objekt) |
| ° | 3. Stufe der Lösungen (Einsicht in den Arbeitsweg) |
| ° | 4. Stufe des Ausführens (ein Tun, das diesen Weg als richtig bestätigt findet) |
| ° | 5. Stufe des Einübens und Behaltens (Verfestigung des Gelernten) |
| ° | 6. Stufe des Transfers und der Integration (Bereitstellen des Gelernten für zukünftige ähnliche Situationen) |
oder diesem Schema, einem der bekanntesten Ansätze zur Unterrichtsplanung und fester Bestandteil der Lehrerbildung in den USA:
9 Events of Instruction von Robert Gagné (1916-2002)
| ° | 1. Gain attention - Gewinne die Aufmerksamkeit der Lernenden |
| ° | 2. Inform learner of objectives - Informiere die Lernenden über Ziele |
| ° | 3. Stimulate recall of prior learning - Stimuliere Vorwissen |
| ° | 4. Present stimulus material - Präsentiere Anreizmaterial |
| ° | 5. Provide learner guidance - Sorge für Anleitung des Lernenden |
| ° | 6. Elicit performance - Lasse Lernende das Verhalten ausführen |
| ° | 7. Provide feedback - Sorge für Rückmeldung |
| ° | 8. Assess performance - Beurteile die Durchführung |
| ° | 9. Enhance retention transfer - Verstärke den Behaltenstransfer |
Als Neurodidaktik (zur Diskussion s. hier) bezieht die Didaktik Erkenntnisse der modernen Hirnforschung mit ein, um „gehirngerechtes Lernen“ zu ermöglichen. (S. z. B. hier; beispielsweise entspricht der alte Grundsatz: „Bene docet, qui bene distinguit“ dem „Hirnbedürfnis“ nach guter Gliederung des Lehr-/Lernstoffes.)
* Enkulturation ist das oft auf Nachahmungslernen beruhende unmerkliche Hineinwachsen in die (dann oft prägende, Werte und Richtlinien vermittelnde) Umgebungskultur ohne bewusstes Zutun anderer.
* Funktionale Erziehung bezeichnet im Unterschied zur oben erwähnten Intentionalen Erziehung ein Ausnutzen und Kombinieren der an sich nicht planbaren (immanenten), aber manchmal gleichgeschalteten Einflüsse der Um- und Mitwelt (vorgeblich zugunsten des Zöglings, oft aber im Dienste einer Ideologie, die über Jugendorganisationen Einfluss hat).
* Sozialisation nennt man die gesellschaftliche Formung des Menschen. Wenn man es dabei beließe und diesen Begriff mit „Erziehung“ gleichsetzte, entstünde die Gefahr, dass der gegenwärtige gesellschaftliche Zustand akzeptiert würde (was nur sinnvoll wäre, wenn er entweder perfekt oder unveränderbar wäre), die Gefahr der Manipulation sowie die der Anpassung oder zumindest der Gewöhnung, die zwar Sicherheit, aber auch Bequemlichkeit nach sich ziehen.
* Manipulation bezeichnet beabsichtigte Maßnahmen zur Verhaltensbeeinflussung, die Umwelteinflüsse miteinbeziehen können und - zugunsten der Manipulierenden - zur Anpassung an von diesen selbst gewählte Zwecke führen soll (s. a. u.).
* Nudging wird manchmal als besondere Form der Manipulation gesehen. Es ist ein „Anstupsen“, ein Nahelegen erwünschter Verhaltensweisen ohne direkten Zwang, eine Art „libertinärer Paternalismus“ (Thaler; s. u.), der aber bei Verhaltensökonomen (s. o.) positiv konnotiert ist, da er - zumindest vorgeblich - im Interesse der Gelenkten ist und die Freiheit der handelnden Personen nicht einschränkt, sondern stattdessen über die Gestaltung der Situationsarchitektur wirksam wird. (Der Begriff wurde 2008 im Buch Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness / Nudge - wie man kluge Entscheidungen anstößt vom Wirtschaftswissenschaftler Richard H. Thaler, *1945, und vom Rechtswissenschaftler und Präsidentenberater Cass Sunstein, *1954, geprägt.)
Beispiele: Bessere Präsentation gesünderer Speisen im Schulbuffet als ungesünderer, die Widerspruchsregel in Bezug auf die Organentnahme nach dem Tod (die in Österreich im Unterschied zu Deutschland bei gleichen kulturellen Bedingungen um ein Vielfaches bessere Transplantantionsvoraussetzungen schafft; vgl. u.) usw. - kurzum alles, was das Gewünschte gängig erscheinen lässt, das Unerwünschte aber nach wie vor als (manchmal anstrengendere) Möglichkeit anbietet. (Kahneman - s. a. o. - z. B. hält es, um Übertretungen zu verhindern, für wirkungsvoller, das Bewusstsein einer erwünschten sozialen Norm auf diese Weise zu stärken, anstatt zu drohen.)
* Dressur ist ein rein auf Verstärkerlernen ausgerichtetes Erzieherverhalten, das auf Lohn und Strafe aufbaut und mit der formalen Erfüllung der Vorgaben zufrieden ist.
In all den letztgenannten Fällen ist die prinzipielle Unabhängigkeit des Zöglings vom Erzieher, die dadurch konstituiert wird, dass beide in ihren Interaktionen in Wahrheit einer dritten Instanz verpflichtet sind, nämlich der Vernunft („Logosbindung“; wobei es Aufgabe des Erziehers ist, die unterschiedliche Individuallage des Zöglings in seine Interventionen miteinzurechnen), nicht gegeben. Zumindest die Überlegung, in wessen Interesse eine Intervention ist, sollte immer Beachtung finden. (Erstaunlich viele vorgeblich positive „pädagogische“ Interventionen bedienen in Wahrheit ausgesprochene oder unausgesprochene Interessen Dritter oder die des Intervenierenden selbst.)
EINIGE HISTORISCHE AUFFASSUNGEN VON PÄDAGOGIK
Im Folgenden findet sich eine (willkürliche) Auswahl einiger weniger, aber einflussreicher pädagogischen Konzepte von der Antike bis zur Gegenwart. Sie alle sind - ausgewiesen oder unausgewiesen - abhängig von dem ihnen zugrunde liegenden Menschenbild, das zwischen einer Tabula-rasa-Auffassung (s. u.) und der Vorstellung von Entwicklung als automatischer Sichtbarmachung von etwas bereits Vorhandenem (s. o.) oszilliert. Die Zugänglichkeit für pädagogische Interventionen wurde im Laufe der Geschichte in immer früheren Lebensaltern gesehen. (Bis ins 20. Jhdt. wurden Babys ohne Anästhesie operiert, da man ihnen das Bewusstsein absprach und annahm, sie könnten keine Reize - weder Schmerz- noch Lernstimuli - verarbeiten.)
- Sokrates:
Sokrates (Σωκράτης; 469-399 v. Chr.) war der Meinung, dass die Lehrenden die Lernenden unmerklich zur richtigen
Erkenntnis führen sollen. Letztlich machen die Lernenden die entscheidenden Schritte unter
(An)leitung der Lehrenden, die durch Fragen die richtigen Denkschritte provozieren, selbst
(z. B. Platon, Dialog Λύσις
/
Lysis). Diese Vorgehensweise vergleicht er mit der Arbeit einer
Geburtshelferin, die die Gebärende bei der letztlich selbst zu leistenden Arbeit
unterstützt, und nennt sie „Maieutik“ (Hebammenkunst). Sokrates
kann als Vorläufer (oder Begründer) der Idee einer dialogischen Grundstruktur der intentionalen pädagogischen
Führung gelten. - Vgl.
Video zur sokratischen Methode und eine
Sokrates-Seite
- Platon,
Πολιτεία (Politeia):
Nach Platon (Πλάτων; 428/7-348/7
v. Chr.) ist der Staat (s. hier) ein Abbild der menschlichen Seele, deren
Vernunft die Weisheit ermöglicht. Sie besteht aus einem herrschaftsbegründenden
vernünftigen („Die Philosophen sollen die Könige sein“), einem mutartigen
(dessen Vermögen Tapferkeit ist und der in guten wie in schlechten Zeiten
unbeirrt am Vernünftigen festhält und auch für die Kindererziehung zuständig
ist) und einem begehrlichen Teil (der sich freiwillig unterordnet). Erziehung
soll die Herstellung der richtigen Rangfolge, die nach gesellschaftlichen
Aufgaben verschieden ist, gewährleisten
(vernünftig - Herrschende, Könige; mutartig - Krieger, Wächter;
begehrlich -
Bauern, Handwerker, Gewerbetreibende). Jeder möge besonnen das ihm Zukommende
tun (Idiopragie-Formel) und dadurch für Gerechtigkeit sorgen.
- Menander:
Menander /
Μένανδρος (342/1-291/0 v. Chr.)
war ein griechischer Komödiendichter, dessen berühmtester Ausspruch (Monostichoi
422) eine
Erziehungsmaxime ist:
Ὁ μὴ δαρεὶς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται
(bekannt geworden als Motto der Autobiographie
von Johann
Wolfgang von Goethe,
1749-1832,
Dichtung und Wahrheit). Menander
hielt nicht nur das Geschunden-Werden, sondern auch das Unglück für eine
wichtige Erziehungsgrundlage.
- Comenius
(eig. Jan
Amos Komenský):
Der evangelische Bischof, Gymnasialdirektor, Schulreformer und
Schulbuchentwickler Comenius
(1592-1670)
war ein tschechischer Pädagoge, der als „Praeceptor Europae / Lehrmeister
Europas“ bezeichnet wurde.
In einer umfassenden, „pansophischen“ Weisheitslehre predigte er Gewaltlosigkeit
und Friedfertigkeit. Er wollte „omnes omnia omnino“ (alle alles
allumfassend) lehren.
Bekannt wurden seine Bücher Didactica magna und Orbus sensualium pictus, ein jahrhundertelang verwendetes Schulbuch, das die sichtbare Welt zum ersten Mal in umfassender thematischer Breite für Kinder enzyklopädisch darstellt, illustriert und erklärt und für Goethe das beste Kinderbuch seiner Zeit war (vgl. Video 13:18 bis 15:39). Das Werk erlebte Hunderte Auflagen und hat bis in unsere Zeit großen Einfluss (vgl. etwa Weltwissen der 7jährigen von Donata Elschenbroich, *1945; vgl. Interview und Zeit-Artikel).
- J. J. Rousseau:
In seinem 1762 veröffentlichten Erziehungsroman Emile ou de
l'Education (s. hier) vertritt Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) das Ideal der „Negativen
Erziehung“: Der Mensch sei von Natur aus gut und solle so wenig wie möglich
durch erzieherische Eingriffe „verbildet“ werden. Erziehung solle sich darauf
beschränken, schädliche Umwelteinflüsse fernzuhalten, dann würde sich der Zögling zu
einem guten Menschen entwickeln. (Prinzip des Wachsenlassens, das als
Vorläufer des Laisser-faire-Stils, s. u., gelten kann; Rousseau
prägte in diesem Zusammenhang die romantische Vorstellung des von der
Zivilisation unverdorbenen „edlen Wilden“ mit.)
In Deutschland wurden Rousseaus Ideen durch den Philanthropismus verbreitet, der eine vernünftig-natürliche Erziehung zur freien Entfaltung der menschlichen Natur und seiner nützlichen Ausstattung für das Leben forderte und in der Tradition des religiösen Toleranzgedankens stand. Johann Bernhard Basedow (1724-1790) gründete 1774 in Dessau eine Musterlehranstalt, das „Philanthropin“.
- Immanuel
Kant:
In seiner Schrift Über Erziehung (1803 als Zusammenfassung seiner
jahrzehntelangen diesbezüglichen Vorlesungen an der Universität Königsberg
herausgegeben vom als Waisenkind aufgewachsenen Orientalisten Friedrich
Theodor Rin(c)k,
1770-1811) versteht Kant (1724-1804)
Erziehung als „Kunst“,
die im Laufe der Generationen vervollkommnet werden müsse. Unter allen Lebewesen
müssten nur Menschen (in ihren Phasen Säugling - Zögling - Lehrling) erzogen
werden. Den großen Rahmen bildete für Kant
die Aufklärung mit ihrer Forderung nach
Mündigkeit (s. o.). - Einige Zitate: „Der Mensch kann nur Mensch werden durch Erziehung.“
- „Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu
wissen, was man vernünftigerweise fragen solle.“
- Johann
Heinrich Pestalozzi:
Pestalozzi
(1746-1827) war ein Schweizer Pädagoge und Sozialreformer und gilt
als Begründer der modernen
Volksschule.
Aus milieuoptimistischer Sicht
postulierte er drei Stadien, die der Mensch durchlaufe, ohne die vorigen hinter sich zu
lassen: Naturzustand, gesellschaftlicher Zustand, sittlicher Zustand. Aus der
Gleichzeitigkeit könnten psychische Konflikte resultieren, bei deren Vorbeugung und
Bewältigung Erziehung helfen solle. Anzustreben sei eine Harmonie von Kopf, Herz
und Hand.
Vgl. eine
Pestalozzi-Dokumentation (mit Links)
- Wilhelm
von Humboldt:
Humboldt (1767-1835) prägte den modernen Bildungsbegriff, der Bildung (im Unterschied zur Ausbildung)
als zweckfrei (bzw. als Selbstzweck) ansieht. Sie dient seiner Ansicht nach
dazu, die Freiheitsgrade zu erweitern (Freiheit sei ihre
„erste und unerlässliche Bedingung“) und den Menschen
(durch
„Mannigfaltigkeit der Situationen“) mit sich selbst bekannt
zu machen (und kann daher auch nur selbst „überprüft“ werden). Bildung
beschreibt den unabschließbaren Weg des Individuums zu sich selbst und wird zum
Programm der Vervollkommnung der Persönlichkeit erhoben, das - gemäß dem von Humboldt
erstellten Königsberger Schulplan (er
wirkte als Leiter der Unterrichtssektion im Innenministerium an der preußischen
Schulreform mit) - in einem
dreigliedrigen allgemeinbildenden System (Volksschule / Gymnasium /
Universität) jedem Bürger und jeder Bürgerin zur Verfügung gestellt werden solle, da die
Anlage dazu angeboren sei, aber geweckt werden müsse. - Zitate:
„Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen.“
„Der Zweck des Schulunterrichts ist die Übung der Fähigkeiten, und die Erwerbung der Kenntnisse, ohne welche wissenschaftliche Einsicht und Kunstfertigkeit unmöglich ist. Beide sollen durch ihn vorbereitet werden; der junge Mensch soll in Stand gesetzt werden, den Stoff, an welchen sich alles eigne Schaffen immer anschließen muss, teils schon jetzt wirklich sammeln, teils künftig nach Gefallen sammeln zu können, und die intellektuellmechanischen Kräfte auszubilden.“
Humboldts Ideal einer Einheit von freier Lehre
und Forschung ohne inhaltlichen Einfluss von Staat, Kirche oder Wirtschaft
(innerhalb der vier Fakultäten Philosophie, Jus, Theologie und Medizin) verwirklichte sich 1809 in der Gründung der Berliner Universität
(„Humboldt-Universität“). Humboldt
gilt als Begründer des modernen Gymnasiums. Seine
Theorie der Bildung des Menschen (1793) wurde später oft zitiert (vgl. Theodor
Adorno, 1903-1969: Theorie der
Halbbildung 1959, Konrad Paul
Liessmann, *1953: Theorie der
Unbildung 2006).
Zum Verblassen des humanistischen Bildungsideals vgl. ein
Interview mit Konrad
Paul Liessmann
(„Eine rein ökonomisch durchorganisierte Gesellschaft mag erfolgreich sein,
aber sie wird nichtsdestotrotz barbarisch sein.“)
- Johann
Friedrich Herbart:
Herbart
(1776-1841) gilt als Begründer der allgemeinen Pädagogik und war in seinem
Bereich für die Prüfung der Lehramtskandidaten zuständig. Er stiftete als
Königsberger Professor der Philosophie (auf dem Lehrstuhl Kants)
eine maßgebende „Pädagogische Übungsschule“, in der neben der Vermittlung von
Kenntnissen vor allem Charakterbildung betrieben wurde (Herbartianismus).
Der Schüler solle seinem Konzept nach zu sittlicher Selbstbestimmung geführt
werden, der Lehrer ohne autoritäre Anwandlungen als Unterstützer auftreten. In
diesem Zusammenhang prägte er den Ausdruck Pädagogischer Takt,
der zwischen Theorie und Praxis stehe. Er solle die Differenz
„zwischen Sein und Sollen, Faktischem und Normativem, Möglichem und
Vernünftigem“
überbrücken.
Die Ziele der Schule leiteten sich von der Ethik, die Mittel von einer von ihm
entwickelten psychologischen Mechanik, die gemäß seiner Philosophie alle
seelischen Vorgänge aus der Wechselwirkung der Vorstellungen erklärt, ab.
Seelisches und Geistiges seien in einem „flüssigen Wesen“ nicht zu trennen.
Herbart unterschied
4 formale Lehrstufen:
| ° | Klarheit (durch ruhende Vertiefung) - Der Unterricht soll „zeigen“. |
| ° | Assoziation (durch Fortschreiten von einer Vertiefung zur anderen) - Der Unterricht soll „verknüpfen“. |
| ° | System (durch ruhende Besinnung) - Der Unterricht soll „lehren“. |
| ° | Methode (durch Fortschritt der Besinnung) - Der Unterricht soll „philosophieren“. |
-
Friedrich
A. Fröbel:
Fröbel (1782-1852;
„Erziehung ist Beispiel und Liebe - sonst nichts“) gilt als Begründer der Institution des
Kindergartens. So
bezeichnete er 1840 eine 1837 von ihm und anderen in Thüringen gegründete
„Pflege-, Spiel- und Beschäftigungsanstalt“ mit pädagogischem Anspruch, in der
er großen Wert auf verwendete Materialien („Spielgaben“) und Naturverbundenheit
legte. Fröbel war vom
Philanthropismus beeinflusst und lokalisierte das in der Erziehung anzustrebende
innere Wesen des Menschen in den Gesetzen der Natur.
- Alfred
Adler:
Individualpsychologe, s. u.):
Erziehung soll ermutigen (wirkliche Erfolgserlebnisse ermöglichen), nicht
entmutigen (z. B. durch frustrationsintolerant machende Verzärtelung oder repressive
Autorität), um neurotische Verhaltensstörungen zu verhindern und ev. echte Kompensation
vorhandener Minderwertigkeiten zu bewirken. Adler untersuchte als einer der
ersten die Bedeutung der Stellung eines Kindes in der Geschwisterreihe (vgl.
hier).
- Reformpädagogik:
Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde eine „Pädagogik vom Kinde aus“
propagiert. Wichtige Figuren waren die Schwedin Ellen Key, 1849-1926,
die 1902 das Buch „Das Jahrhundert des Kindes“ schrieb, und die Italienerin Maria Montessori, 1870-1952,
deren eigentliche Leistung die Entdeckung des Kindes war und die durch die nach
ihr benannten Kindergärten und Schulen bis heute weithin bekannt ist. 1907
wurde die erste der in römischen Arbeitervierteln gebauten und ursprünglich nur
für beeinträchtigte Kinder gedachten Case dei Bambini
unter ihrer pädagogischen Leitung eröffnet. Entsprechende Materialien
sollten ein Lernen mit allen Sinnen ermöglichen (VAKOG-Methode: visuelle,
akustische, kinästhetische, olfaktorische und gustatorische
Verarbeitungsmodalidäten ergeben ein umfassendes Bild von der Welt).
Grundlegend waren auch die Arbeiten von John Dewey (1859-1952; v. a. Demokratie und Erziehung), der den Zusammenhang von Psychologie und Gesellschaft betonte. Er definiert Erziehung als „diejenige Rekonstruktion und Reorganisation der Erfahrung, die die Bedeutung der Erfahrung erhöht und die Fähigkeit, den Lauf der folgenden Erfahrung zu leiten, vermehrt“. Vorgang und Ergebnis von Erziehung, die kein Ziel außerhalb ihrer selbst habe und in einem Prozess der kontinuierlichen Enthüllung von Sinn und Bedeutung von Erfahrungen bestehe, seien dasselbe. Drillen und Büffeln hielt er für geisttötend. In diesen Zusammenhang gehören auch die 1952 im New York Times Magazine erschienenen
10 Gebote
eines Liberalen (Die beste Antwort auf Fanatiker)
von Bertrand
Russell (1872-1970; auch 10 Gebote für Lehrer):
| 1. Fühle dich keiner Sache völlig
gewiss! 2. Trachte nicht danach, Fakten zu verheimlichen, denn eines Tages kommen die Fakten bestimmt ans Licht! 3. Versuche niemals, jemanden am selbständigen Denken zu hindern; es könnte dir gelingen! 4. Wenn dir jemand widerspricht, und sei es dein Ehepartner oder dein Kind, bemühe dich, ihm mit Argumenten zu begegnen und nicht mit der Autorität, denn ein Sieg der Autorität ist unrealistisch und illusionär. 5. Habe keinen Respekt vor der Autorität anderer, denn es gibt in jedem Fall auch Autoritäten, die gegenteiliger Ansicht sind! 6. Unterdrücke nie mit Gewalt Überzeugungen, die du für verderblich hältst, sonst unterdrücken diese Überzeugungen dich! 7. Fürchte dich nicht davor, exzentrische Meinungen zu vertreten; jede heutige Meinung war einmal exzentrisch. 8. Freue dich mehr über intelligenten Widerspruch als über passive Zustimmung; denn wenn die Intelligenz so viel wert ist, wie sie dir wert sein sollte, dann liegt im Widerspruche eine tiefere Zustimmung. 9. Halte dich an die Wahrheit auch dann, wenn sie nicht ins Konzept passt! Denn es passt noch viel weniger ins Konzept, wenn du versuchst, sie zu verbergen. 10. Neide nicht denjenigen das Glück, die in einem Narrenparadiese leben; denn nur ein Narr kann das für ein Glück halten! |
Diese Entwicklungen führten letztlich in den 1960er-Jahren u. a. zu der Forderung nach Antiautoritärer Erziehung. (Weitere Vordenker waren Erich Fromm, s. u., und Theodor Wiesengrund Adorno, 1903-1969, der mit anderen 1950 das Buch Die autoritäre Persönlichkeit herausbrachte.) Autorität sollte frei von subjektiven Interessen und Herrschaftsansprüchen gehalten werden. Ein diesbezügliches Pilotprojekt war die als Reaktion auf die NS-Zeit postulierte Erziehung zum Ungehorsam (vgl. auch Hannah Arendt, 1906-1975: „Kein Mensch hat [...] das Recht zu gehorchen“) in der Summerhill-Schule von A. S. Neill (1883-1973), die allerdings bereits 1921 als Teil der internationalen „Neuen Schule“ in Hellerau bei Dresden gegründet, später nach Sonntagberg in Österreich und 1923 nach England verlegt wurde. Ab 1985 wurde sie von Neills Tochter Zoe Readhead (*1946) (tw. zusammen mit zwei ihrer Söhne) geleitet, dazwischen führte ihre Mutter Ena Neill (1910-1997) das Institut. (Vgl. Homepage dieser Schule)
Ein „Seitenast“ der Reformpädagogik ist die Waldorf-Pädagogik (ursprünglich benannt nach der Betriebsschule für die Arbeitnehmerkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart) des altösterreichischen Begründers der Anthroposophie, Rudolf Steiner (1861-1925), die Welterkenntnis durch innere Erfahrung ermöglichen will. In zahlreichen Kindergärten und Steiner-Schulen (oder von der Waldorf-Pädagogik beeinflussten Ablegern wie z. B. der w@lz in Wien) werden weltweit Kinder im Denken, Fühlen und Wollen geschult. Ihre Entwicklung wird in Sieben-Jahres-Abschnitten gesehen, der Unterricht erfolgt fächerübergreifend in „Epochen“.
Ziele der alternativpädagogischen Bemühungen waren - um Unterricht nicht unnütz erscheinen zu lassen - die Verringerung der Grenzen zwischen Unterricht und Leben (Gefahren: der kritische Distanzaufbau wird dadurch erschwert, die Anforderungen, die das spätere Leben an die Zöglinge stellen wird, sind zum Zeitpunkt des Unterrichts noch völlig unbekannt), die Auflösung des ausschließlichen Frontalunterrichts und des Lernmonopols der Schulbildung, die teilweise Verschiebung der Verantwortung vom Lehrpersonal zu den Unterrichteten und das Vermitteln von diversen sogenannten Kompetenzen neben den kanonischen Bildungsinhalten.
(Die berühmte Hattie-Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, *1950, eine 2009 veröffentlichte Metaanalyse mit dem Titel Visible Learning – Lernen sichtbar machen, die eine Rangliste verschiedener Einflussfaktoren auf den schulischen Lernerfolg in Bezug auf ihre Effektstärke erstellte, wies im Gegensatz dazu später nach, dass die Lehrperson unter Ceteris paribus-Bedingungen der wichtigste Faktor für den Bildungserfolg in der Schule - s. a. u. - und die häufige Kontrolle des Lernfortschritts mit anschließendem Feedback einer der effektstärksten Einzelfaktoren ist. Andere wären etwa Intelligenz, Motivation und Fleiß, die alle von günstigen frühkindlichen Bedingungen positiv beeinflusst werden. Erfolgreiche Länder - vgl. hier - folgen aufgrund der Erkenntnis, dass v. a. in der Grundschule die Lernniveaus der zu Unterrichtenden bis zu 3 Jahren auseinander liegen, dem in der Studie empfohlenen RTI-/Return to Intervention-Ansatz: Er besagt, dass bei lerndiagnostisch digital festgestelltem Nichterreichen zentraler Kompetenzstandards möglicht früh und möglichst bald eine passgenaue Intervention erfolgen solle. Man müsse damit rechnen, dass der Unterricht danach nur mehr zu 80% für alle stattfinden könne, zu 15% in „targeted small groups“ und zu 5% überhaupt individuell erfolgen müsse.)
- Frank
Fremont-Smith:
(1895–1974) „Erziehung soll einen Bezugsrahmen schaffen, innerhalb
dessen die freie Wahl erlaubt und erwünscht ist.“
- Carl R.
Rogers:
Rogers (1902-1987, s. u.)
fordert, folgende sieben Prinzipien in der
Kindererziehung zu berücksichtigen: Echtheit / Empathie / Wertschätzung /
Ungeschuldete Liebe / Autonomie / Anregung und Unterstützung / Zuverlässigkeit.
-
Alice
Miller:
Miller
(1923-Suizid 2010, aufgewachsen in Polen, später in die Schweiz emigriert) setzte sich als „Kindheitsforscherin“, ursprünglich von der
Psychoanalyse (s. u.)
kommend, v. a. in ihren Büchern Das Drama
des begabten Kindes,
Am Anfang war
Erziehung und
Du
sollst nicht merken
mit Erziehung auseinander.
Sie sieht den Grund für kindliche Verhaltensauffälligkeiten und spätere
psychische Probleme im Erwachsenenalter in den oft unbewusst erlebten
Auswirkungen elterlicher psychischer Einflüsse. Miller
kritisiert die erzwungene Anpassung des kindlichen Verhaltens an die elterlichen
Bedürfnisse und wendet sich gegen die Schwarzen Pädagogik
(Begriff von Katharina
Rutschky, geb.
Vier, 1941-2010),
eine
„Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen des Kindes zu brechen, es
mit Hilfe der offenen oder verborgenen Machtausübung, Manipulation und
Erpressung zum gehorsamen Untertan zu machen“
und die Einschüchterung und Erniedrigung oder gar Gewalt und Kindesmisshandlung (s. u.)
als Erziehungsmittel verwendet. Anhand der Biographien bekannter gescheiterter
Persönlichkeiten versucht
Miller nachzuweisen, dass die
Kindheitsgeschichten, auch die der erziehenden „Täter“ selbst, als Erklärung für
ihr Verhalten herangezogen werden müssen und dass oft in der Folge Verklärung
und Vertuschung von elterlicher Gewalt den Betroffenen eine Bearbeitung der
Situation erschwerten. Die Lösung würde in einer „Antipädagogik“ und darin
bestehen, den kindlichen Wunsch nach Zuwendung und Aufmerksamkeit zu erfüllen
(wobei begabte Kinder ein diesbezügliches Defizit noch stärker als andere verspüren
würden). Jedes Kind könne eine gesunde Entwicklung nehmen, wenn es sich nach
seiner Eigenart entfalten dürfe.
- Otto
Friedmann Kernberg:
(*1928) „Ich glaube, dass eine Erziehung realistische Strukturen
setzen muss. Eine Erziehung, in der es keine Schranken gibt, ist genauso
gefährlich wie eine, wo alles so gehemmt wird, dass es keine Möglichkeit für
Entwicklung gibt. Es ist wichtig, dass Kinder respektiert werden, dass Kinder
die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Wünsche zu entwickeln, aber es ist
genauso wichtig, dass ihnen die fundamentalen Prinzipien des Zusammenlebens
beigebracht werden [...] die Wahrheit zu sagen [...] anderen Menschen zu helfen
und sie nicht anzugreifen [...] dass sie ein Gefühl für die fundamentale
moralische Bedeutung von Werten entwickeln können.“ (Kernberg
im Gespräch mit Manfred Lütz,
*1965. Freiburg im Breisgau 2020; zu Kernberg
s. a. u.)
- MORE Life Experience Model:
Nach dem 2013 von Judith
Glück (*1969) und Susan
Bluck (*1958?) an der Universität
Klagenfurt entwickelten Modell sollte die Schule durch Vermittlung von
Meisterschaft, Offenheit, Reflexionsfähigkeit und Empathie verbunden mit
Emotionsregulierung die Grundlagen dafür schaffen, dass spätere
Herausforderungen im Leben zur Weiterentwicklung genutzt werden können: Life
challenges are catalysts for the development of wisdom, and that psychological
resources crucially influence how people appraise life challenges, how they deal
with them, and how they integrate them into their life story as time goes on.
Based on the literature on wisdom and growth from challenging experiences, we
proposed five resources as important for the development of wisdom: Mastery,
Openness, Reflectivity, and Emotion Regulation including Empathy – in short,
MORE. (Vgl. hier)
- Gegenwart:
Heute erscheint Pädagogik
* als empirische Wissenschaft (Erfahrungswissenschaft, die auf
Evidenzen und Sinnesdaten
basiert und Beobachtetes beschreiben will). Idee: Durch die Erforschung
der pädagogischen Praxis lassen sich Hinweise auf deren Verbesserung ableiten. Problem:
Aus dem Sein lässt sich kein Sollen ableiten, Sollensprinzipien sind a priori -
vor jeder Erfahrung - vorhanden.
* als Normen setzende Wissenschaft (daher
philosophisch beeinflusst, „kritisch“). Sie beruht auf Argumentation
und Begründungen. Idee: Erst die Offenlegung und Kritik jener Prinzipien,
die der pädagogische Praxis ausgewiesen oder unausgewiesen jeweils zugrunde
liegen, begründen eine Verbesserung dieser Praxis. Normen und
Beurteilungskriterien lassen sich nur aus
dem Vernunftgebrauch ableiten. Problem: Denken ist aufwändiger als
Beobachten.
* als hermeneutische Wissenschaft (insofern, als sie die
Geschichte der Pädagogik schreibt; Hermeneutik = Auslegung, Interpretation der
Wirklichkeit). Idee: Die im Laufe der Zeit entstandenen und praktizierten
pädagogischen Konzepte sollen verstanden werden. Problem: Unvermeidbar
tritt man in den
„hermeneutischen Zirkel“ ein, innerhalb dessen das Einzelne aus dem Ganzen
und das Ganze aus dem Einzelnen erklärt wird.
* Tendenzen und Entwicklungen im 20./21. Jahrhundert
Megatrends im Bildungs- und Schulbereich (die einander tw. widersprechen):
| ° | Ausweitung des Bildungsbegriffs auf alle Altersstufen und Bereiche (z. B. Erwachsenen-, Medien-, Freizeit-, Museumspädagogik) |
| ° | Tendenz zur Verwissenschaftlichung |
| ° | Tendenz zur Ökonomisierung |
| ° | Tendenz zu erhöhter Mobilität innerhalb des Bildungswegs |
| ° | Tendenz zur Verlängerung der Bildungslaufbahn (die Bildungsbeteiligung in der Sekundarstufe II steigt) |
| ° | Tendenz zur Konvergenz von Schul- und Berufsbildung (vgl. das österreichische BHS-System) |
| ° | Tendenz zu Internationalisierung (z. B. Bologna-System) und Globalisierung |
| ° | Immer größere Vielfalt an Schul- und Universitätsträgern |
| ° | Bildungssystem wird zum Gatekeeper für Sozialchancen (Zuteilungsfunktion) |
| ° | Tendenz zur Individualisierung und Differenzierung des Bildungsweges |
| ° | Tendenz zur Pluralität in Bezug auf Methoden und Organisationsformen |
| ° | Tendenz zur Autonomie der Bildungseinrichtungen (und damit zu externer Kontrolle) |
| ° | Neudefinition von Autorität |
| ° | Funktionsumkehr zwischen Eltern und Lehrern (Lehrer übernehmen immer häufiger Erziehungsaufgaben, Eltern „unterrichten“ durch Bezahlung von Nachhilfestunden) |
| ° | Tendenz, Schulen alle Zuständigkeiten zuzumuten (Sexual-, Verkehrs-, Medien-, Wirtschafts-, Gesundheitserziehung usw.) |
| ° | Tendenz zur Digitalisierung |
| ° | Tendenz zur Integration und Inklusion |
| ° | Zertifizierung ohne Qualifizierung (Zeugnisse werden wichtiger als die tatsächlich erbrachten Leistungen) |
| ° | Damit verbunden: schleichende Tendenz zur Besserbewertung bei der Leistungsbeurteilung |
| ° | Tendenz zur Instrumentalisierung (In-Dienst-Nahme) des Bildungssystems |
| ° | Tendenz zur Anpassung an gegebene Verhältnisse |
| ° | Tendenz zu Verrechtlichung und Bürokratisierung |
| ° | Tendenz zu inhaltlicher Beliebigkeit bei gleichzeitiger Überbetonung des Formalen |
| ° | Tendenz zu Ausbildung ohne Bildung |
| ° | Tendenz zur Schlagwortproduzierung in der Bildungspolitik (Jochen Krautz, *1966, erwähnt in Ware Bildung 2007 als Beispiele „Wissensgesellschaft“, „lebenslanges Lernen“, „Humankapital“, „Output-Orientierung“, „Qualitätsentwicklung“, „Effizienz“, „Kompetenzen“, „Bildungsstandards“, „Evaluation“, „Wettbewerb“, „Autonomie“ u. a.) |
In diesem Kapitel geht es um die Ausdifferenzierung des wissbaren Bereichs der Welt bzw. um dessen Bewertung, die darüber entscheidet, was sich als Bildungsinhalt im Rahmen der Kindererziehung bzw. später in Bildungsinstitutionen manifestiert. Wie die Geschichte lehrt, verändern sich diese Inhalte laufend (nicht nur, weil permanent neues Wissen generiert wird, sondern auch aufgrund der volatilen Entscheidung darüber, was davon als wichtig gilt).
- Allgemeines:
Die Frage, was beigebracht werden soll oder überhaupt beigebracht werden
kann, beschäftigt schon die antiken Philosophen (vgl. den Dialog Μένων -
Menon von Platon - Πλάτων,
428/7-348/7 v. Chr.,
in dem die Frage erörtert wird, ob Tugend lehrbar sei). Die Auswahl
erfolgt gemeinhin nach wegen ihrer Unterschiedlichkeit nicht immer vereinbaren
Unterrichtsprinzipien wie Lebensnähe, Anwendbarkeit, Anschaulichkeit, Exemplarität,
Nützlichkeit etc., sie hängt von den angestrebten Erziehungszielen ab (s. u.) und verändert sich daher im Laufe der Jahrzehnte (wenn auch oft erstaunlich
langsam). In Bezug auf den Unterricht erfolgt eine Verschriftlichung der Inhalte
in Curricula (also Lehrplänen), die häufig eher politisch-ideologischen
als pädagogischen Interessen folgen. Grundlegend für curriculare Entscheidungen
ist die Beantwortung der Frage, ob man inhaltsbezogenen materialen Bildungstheorien (sie wollen enzyklopädisch
Wissensinhalte anhäufen) oder formalen Bildungstheorien (sie wollen das
Lernen selbst lehren und das Beherrschen von Denkmethoden fördern) anhängt.
(Vgl.
Karl Kraus, 1874-1936:
„Es kommt nicht darauf an, dass man Eier und Fett nimmt, sondern dass man
Feuer und Pfanne hat.“)
Erfolg könnte in diesem Zusammenhang nach Wolfgang
Klafki (1927-2016) bedeuten,
„dass sich dem Menschen seine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat und dass
eben damit er selbst […] für diese Wirklichkeit erschlossen worden ist.“ Zum
Bildungsinhalt werde, was Bildungsgehalt habe.
- Bildungskanon:
Eine Jahrhunderte währende Diskussion dreht sich um den Bildungskanon
(den unabdingbaren Wissensbestand, der exemplarisch für das Ganze des Wissens
stehen soll; griech. κανών = Richtschnur, Maßstab). In unseren Breiten wird seit
dem Mittelalter - damals waren durch die septem artes liberales (die sieben
freien Küste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik = Trivium; Geometrie,
Arithmetik, Astronomie, Musik = Quadrivium) bereits jene Inhalte
definiert, die in den (Kloster)schulen weitergegeben wurden - darum gerungen, ob
ein verbindlicher Kanon sinnvoll sei bzw. welche Bildungsinhalte er enthalten
sollte. Als eine Antwort auf diese Frage kann die Gliederung der Wissensgebiete
in die Fakultäten der Universitäten (klassisch sind die theologische, die
philosophische, die juridische und die medizinische Fakultät) gesehen werden. In
der Kanondiskussion sind Widerspruch und Zustimmung unabhängig vom Ausgang der Diskussionen
erwartbar. Beispiele für Kanonbildungen: die 12 olympischen Gottheiten,
der Fächerkanon in der Schule, Listen zu
lesender literarischer und philosophischer Werke (z. B. die Anthologie von Marcel
Reich-Ranicki,
1920-2013), der biblische Kanon (also die biblischen Bücher ohne Apokryphen)
etc.
Schulen (von griech. σχολή = Muße) gibt es vermutlich seit den Sumerern, die in Mesopotamien bereits vor 3000 bis 4000 Jahren Kinder in einzelnen Gegenständen unterrichten ließen. Wo Bildungsvermittlung nicht als privater Einzelunterricht erfolgt (etwa bis ins 19. Jhdt. in höheren Schichten durch Hofmeister oder in Österreich bis heute dann, wenn die Unterrichtspflicht - es gibt hier keine Schulpflicht - durch die Eltern oder Privatlehrer erfüllt wird), geschieht dies in Bildungsinstitutionen, die seit jeher in allen politischen Systemen wegen der Einflussmöglichkeiten auf die heranwachsenden Generationen die besondere Aufmerksamkeit der jeweils Herrschenden auf sich gezogen haben. Für Österreich wurde 1774 von Kaiserin Maria Theresia eine allgemeine, 6jährige Schulpflicht (heute gesetzlich als Unterrichtspflicht interpretiert) eingeführt.
- Institutionen:
Die wichtigsten Bildungseinrichtungen sind Kindergärten, Schulen und
Universitäten (letztere thematisch eingeschränkt auch als Hochschulen, Akademien, Kollegs,
Fachhochschulen etc., wobei der Titel „Universität“ heute inflationär auch dann
vergeben wird, wenn spezifische und nicht universale Lehrinhalte angeboten
werden). Dieses dreigliedrige System findet sich in den meisten Ländern der Erde wieder.
Schulen sind in sich meist wieder dreigliedrig organisiert: in die Volksschule,
die Sekundarstufe 1 und die (allgemein- oder berufsbildende) Sekundarstufe 2. Im Laufe eines Schüler- bzw.
Studentenlebens kann man also vier so genannte Nahtstellen überschreiten (bei
Post-Doc-Ausbildungen sogar fünf). Volkshochschulen und andere Institutionen
bieten
Erwachsenenbildung an.
- Organisationsformen:
Man unterscheidet zwischen differenzierten
Schulsystemen und Gesamtschulsystemen (eventuell mit
Binnendifferenzierung), je nachdem, ob schon relativ früh spezifische
Bildungswege angeboten werden oder Kinder unabhängig von ihrer
Leistungsfähigkeit im selben Klassenverband sitzen (wie z. B. die 6- bis
10-Jährigen in Österreichs Volksschulen). Verpflichtend ist der Schulbesuch meist nur
zwischen dem 6. und dem 15. Lebensjahr, in manchen Ländern sind die Intervalle bzw.
die Grenzen anders gewählt. Je nach Trägerorganisation werden Bildungseinrichtungen privat
oder öffentlich organisiert. (Haben Privatschulen ein Öffentlichkeitsrecht, sodass
ihre Abschlüsse allgemein anerkannt werden, dann übernimmt die öffentliche Hand
manchmal einige Kosten, z. B. die Lehrergehälter.) Lehranstalten, die eine
handwerkliche Lehre begleiten, nennt man Berufsschulen. Lernen in
Bildungsinstitutionen kann im Klassenverband (Lehrer/innen unterrichten
eine gleichbleibende Schüler/innen- oder Student/innengruppe) oder in einem -
mehr oder weniger disponiblen - Kurssystem (Schüler oder Studenten wählen
die Themen und eventuell ihre Kurslehrer/innen in deren Räumen) erfolgen.
ERZIEHUNGSSTILE UND ERZIEHUNGSFEHLER
Zu beachten ist im Folgenden, dass einzelne Erziehungsstile nicht automatisch mit Werturteilen verbunden werden können und dass es unmöglich ist, im Laufe eines mehrjährigen (jahrzehntelangen) Erziehungsprozesses alle Erziehungsfehler zu vermeiden. Außerdem können nicht alle unerwünschten Phänomene auf Erziehungsfehler zurückgeführt werden. Dennoch ist wohl der Einfluss eines entspannten, liebevoll sorgenden, vernünftig und konsequent agierenden Elternhauses (bzw. das gewalttätige oder anderweitig negative Gegenteil) auf das spätere Leben des Kindes stärker als die meisten anderen diesbezüglichen Zusammenhänge (mit Ausnahme limitierender kongenitaler Behinderungen).
- Kategorisierung einzelner Stile:
In Untersuchungen zeigen sich schichtspezifische, v. a. bildungsabhängige
Differenzen in den gelebten (manchmal auch nur behaupteten) Stilen (vgl.
hier zu Kurt
Lewin
und s. u.
zu Schicht).
Die einzelnen Erziehungsstile wurden unterschiedlich kategorisiert. Am
ehesten lässt sich ein gemeinsamer Nenner finden, wenn man
bedürfnisorientierte Erziehung postuliert.
Zu Erziehungsmitteln s. o.,
zur Rolle von Lehrpersonen s. u., zur
Problematik der Faktorenanalyse
s. u.
* Kategorisierung nach Kurt Lewin (deutscher Sozialpsychologe, 1890-1947):
| ° | Autoritärer Stil: der Erziehende entscheidet allein; in seiner härteren Variante auch autokratischer Stil genannt. Der Begriff hat heute eine negative Konnotation - z. B. „sich auf angemaßte Autorität stützend“, „autoritäre Staaten“ - und wird manchmal durch „autoritativ“ ersetzt. In seiner Ausformung „Amtsautorität“ oder z. B. „Er/Sie genießt Autorität“ enthält er auch positive Schattierungen. |
| ° | Sozial-integrativer Stil: der Zögling wird an den Entscheidungsprozessen beteiligt; auch demokratisch oder - in radikalerer Form - egalitär genannt. |
| ° | Laisser-faire-Stil: Prinzip des Gewährenlassens; auch negierend (wenn Gleichgültigkeit gegenüber den Handlungen des Kindes bis zur Vernachlässigung - s. u. - bekundet wird) oder permissiv (wenn Kinder autonom entscheiden können) genannt. |
* Zweifaktorentheorie: Die Dimensionen Wärme vs. Kälte (Zuwendung - abweisendes Verhalten) und Dirigismus vs. nondirigierendes Verhalten (Autorität - keine Lenkung) sind in ein Quadrat mit vier Quadranten einzutragen. Jede/r Erziehende bzw. Lehrende hat seinen Platz: Die Eckpunkte würden die kalte, harte, desinteressierte Lehrperson (links oben), die an den Schüler/innen interessierte und zu deren Gunsten agierende, allein entscheidende Lehrperson (rechts oben), die ihre Schüler/innen vernachlässigende Lehrperson ohne Durchsetzungskraft (links unten) und die den Schüler/innen zugewandte, diesen aber zu viel Freiraum gewährende Lehrperson (rechts unten) bezeichnen. In der Realität verteilen sich die Lehrpersonen wohl über die gesamte Fläche. Interessante Ergebnisse zeigen sich oft, wenn im Ex. die Differenz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung erhoben wird. (Zur Problematik der Faktorenanalyse s. u.1 und u.2)
|
Abb. 2/10: Zwei-Dimensionen-Modell des Erziehungsstils |
||
| Zuwendung - | Autorität +
Autorität - |
Zuwendung + |
* Dimensionen des Erziehungsverhaltens nach Anne-Marie Tausch (1925-1983) und Reinhard Tausch (1921-2013): Im Buch Erziehungspsychologie (erstmals 1963, beeinflusst von Carl Rogers; s. u.) werden folgende Polarisierungen (Dimensionen) aufgestellt:
| ° | Achtung, Wärme, Rücksichtnahme vs. Missachtung, Kälte, Härte |
| ° | Vollständiges vs. kein einfühlendes, nicht wertendes Verstehen der inneren Welt eines anderen |
| ° | Echtheit, Übereinstimmung, Aufrichtigkeit vs. Fassadenhaftigkeit, Nichtübereinstimmung, Unechtheit |
| ° | Viele vs. keine fördernden, nicht-dirigierenden Tätigkeiten |
| ° | Keine vs. starke Dirigierung, Lenkung |
- Erziehungsfehler:
Als häufigste Erziehungsfehler gelten:
| ° | fehlende oder ungenügende Präsenz bzw. Begleitung (Desinteresse bis hin zu Vernachlässigung: s. u.; Kinder fühlen sich nicht gesehen oder werden zu früh sich selbst überlassen) |
| ° | Überfürsorge durch „Helikoptereltern“ (die ums Kind schwirren) |
| ° | kalte, unempathische Autorität (Liebesentzug statt liebevoller Konsequenz) |
| ° | Vernachlässigung der Schaffung einer ruhigen, anregenden, liebevollen Atmosphäre |
| ° | mangelnde oder fehlende Konsequenz (die Unberechenbarkeit und/oder Widersprüchlichkeit von Maßnahmen verhindert beim Kind das Gefühl, richtig handeln zu können) |
| ° | unklare bzw. widersprüchliche Kommunikation (z. B. durch zu viele Ausnahmen; erzeugt Verhaltensunsicherheit und Double-Bind-Situationen; s. u.) |
| ° | Vernachlässigung einer glaubwürdigen Körpersprache, mit der klare Ansagen kommuniziert werden können |
| ° | Missbrauch (s. u.; dazu zählen auch Situationen, in denen erziehende Partner einander in den Rücken fallen) |
| ° | dem Alter nicht angepasste erzieherische Handlungen bzw. Absenz erzieherischer Handlungen (z. B. fehlende Resonanz in den ersten Lebensjahren - s. o.) |
| ° | Vernachlässigung der Eigengesetzlichkeit des Kindes (z. B. im Timing oder dadurch, dass das Kind als kleiner Erwachsener behandelt wird) |
| ° | Orientieren am Negativen, Ignorieren des Positiven |
| ° | Defizitorientierung statt Ressourcenorientierung |
| ° | Überschätzung von Worten gegenüber dem eigenen Verhalten im Leben (dem mit Abstand wichtigsten „Erziehungsmittel“: s. o.) |
| ° | unrealistische Erwartungen der Eltern an ihr Kind bzw. ihr Erziehungsziel |
| ° | Kränkungen bis hin zu Gaslighting (s. u.) |
| ° | Überforderung (z. B. durch Reizüberflutung oder dadurch, dass Kindern Entscheidungen, für die die notwendige Reife fehlt, überlassen werden) |
| ° | Unterforderung (z. B. dadurch, dass „Rasenmäher-Eltern“ alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen) |
| ° | Berücksichtigung außerhalb liegender Zwecke und Interessen (Instrumentalisierung des Kindes, z. B. als Statussymbol, als Hoffnungsträger für das Erreichen eigener versäumter Ziele oder als Spielball in Beziehungskonflikten) |
| ° | Missverstehen der Elternrolle als gleichrangiges Kumpelverhältnis |
| ° | Missverstehen des Erziehungsprozesses als Wettbewerb und Konkurrenz mit anderen Eltern und Kindern |
| ° | Einsetzen von Lohn und Strafe statt Lob und Tadel (s. o.) |
| ° | Überschütten der Kinder mit Lob und/oder Tadel („Gießkannen-Eltern“) |
| ° | Überbewertung von Formalismen zuungunsten von Inhalten |
| ° | keine oder unpädagogische Materialien (z. B. elektronische Endgeräte im Kinderzimmer, Plastik statt hochwertiger Materialien etc.) |
| ° | Ignorieren der Notwendigkeit von Weltwissen (s. o.) |
| ° | Scheu vor Grenzsetzungen („Eine Mauer, die nachgibt, eignet sich nicht als Stütze.“ „Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.“) |
| ° | Setzen von (sinnlosen) Grenzen aus Machtbedürfnis und Ignorieren von Freiheitsbedürfnissen |
| ° | mangelnde Struktur, z. B. Tages- und Jahresstruktur durch Vernachlässigung von regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten und „Ritualen“ |
| ° | Vernachlässigung von (Zeit)räumen, in denen Sozialverhalten (Ausgleich von Ansprüchen, Mittragen von gemeinsamen Entscheidungen, Übernahme von Verantwortung, z. B. für Jüngere, richtiges Einschätzen von Nähe und Distanz etc.) erlernt werden kann |
| ° | Mangelndes Bewusstsein in Bezug auf die Verantwortung für die Erfahrungen, die Kinder machen |
u. v. a. m. (Zu Erziehungsmitteln s. o. - Vgl. a. Mit dem Kopf im Sturm und Der Job von Eltern - zwei Texte des Kinder- und Jugendpsychiaters bzw. Schriftstellers Paulus Hochgatterer, *1961)
Traditionell werden auf den pädagogischen „Spielfeldern“ der Ästhetik, des Kognitiven und der Moral folgende Erziehungsziele als anstrebenswert erachtet:
- Lebensaustattung:
Erziehung soll Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kulturtechniken) mitgeben, die im späteren Leben
nützlich oder sogar unumgänglich sind. („Ausbildung“)
- Identität:
Erziehung soll zur Entwicklung einer stabilen (frustrationstoleranten) Persönlichkeit beitragen,
die weiß, wer sie ist, und - emotional gefestigt - spätere Krisen zu bewältigen
und glücklich zu sein imstande sein wird. („Herzensbildung“)
- Mündigkeit:
Erziehung soll im Sinne Immanuel Kants (1724-1804; vgl.
Originalzitat)
die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Anleitung anderer bedienen zu können
-
also die zu vernünftiger Selbstbestimmung - hervorrufen, fördern und erhalten. („Bildung“)
|
|
Copyright © 1999-2026 Thomas Knob. All rights reserved. - Die Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten wird keine Verantwortung übernommen.