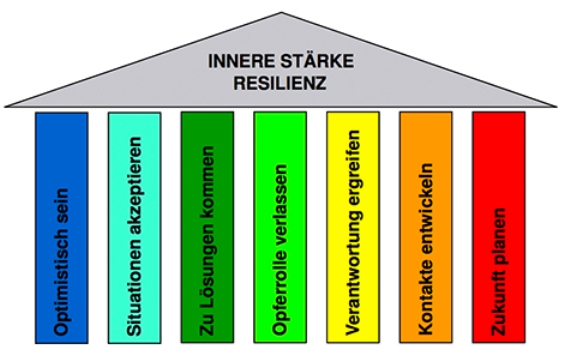
Abb. 4/1: Resilienzfaktoren nach E. Werner (vgl. z. B. hier)
Vorbemerkung:
Dieses unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kompendium diente dem Verfasser und seinen Schülerinnen und Schülern vor allem als Vorlage für den gymnasialen Schulunterricht im Unterrichtsfach „Psychologie“ und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Fehlerlosigkeit. Es ist hemmungslos eklektizistisch und will Hilfestellung für Lehrende und Lernende zur persönlichen Verwendung, nicht Wiedergabe eigener Forschungen sein. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) ohne Zustimmung des Autors sowie die Einbindung einzelner Seiten in fremde Frames bitte zu unterlassen! Alle Informationen werden unter Ausschluss jeder Gewährleistung oder Zusicherung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Der Verfasser übernimmt ferner keine Haftung für die Inhalte verlinkter, fremder Seiten.
Zur Bedienung: Die Darstellung der Webseiten kann auf allen Ausgabegeräten erfolgen. Der beste optische Eindruck sollte im Tablet-Format (senkrecht oder waagrecht) zu erzielen sein. Interne Links werden im selben Frame (Rückkehr meist mit ALT+Pfeil links oder über die entsprechende Schaltfläche), externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Die Volltextsuche verweist nur auf die Seite (führt nicht direkt zur gesuchten Textstelle), danach hilft die Seitensuchfunktion (meist STRG+F) weiter. Quellenangaben werden, soweit dies möglich ist, beigegeben. Sollten diesbezüglich (oder anderweitig) Fehler bemerkt werden bzw. Unterlassungen passiert sein, so möge dies bitte nachgesehen und über die beigegebene Mailadresse gemeldet werden. So bald wie möglich werden Korrekturen erfolgen. Um die letztgültige Version zu erhalten, ist eine Seitenaktualisierung (automatisch oder manuell) günstig.
|
KOMPENDIUM DER PSYCHOLOGIE, 4. TEIL (mit LINKS ins Internet)
|
Volltextsuche in allen 5 Teilen: |
|
|
Suchbegriffe bitte in Groß- oder Kleinschreibung,
ganz oder unvollständig Fragen und Kommentare an thomas.knob@chello.at
|
|
INHALT DES 4. TEILS:
VIII. TIEFENPSYCHOLOGIE UND PSYCHIATRIE (Definitionen - Das Unbewusste - Süchte, Persönlichkeitsstörungen, Geistes- und Gemütskrankheiten - Therapieformen) ⇘
Dieses Kapitel ist das umfangreichste des gesamten Kompendiums. Es wird nach Maßgabe der Möglichkeiten laufend überarbeitet und versucht auch neuere Erkenntnisse einzuarbeiten. Wie bei den Behinderungen (s. o.) verändern sich die Terminologien in der Forschungsgeschichte genau so wie die Inhalte. Auch die Krankheiten selbst verändern ihre Ausprägungsformen im Laufe der Zeit. („Wenn du die Antwort gefunden hast, ändert das Leben die Frage.“) Die Frage, ab wann ein Mensch überhaupt als „krank“ zu bezeichnen ist, beantwortete Freud etwa so: „Wenn er nicht mehr arbeiten und / oder lieben kann.“ Andere Antworten zielen auf den subjektiven Leidensdruck, ältere Herangehensweisen eher auf „abnormale Phänomene“ ab.
* Tiefenpsychologie: 1910 vom Züricher Psychiater Eugen Bleuler (1857-1939) geprägter Ausdruck für die Psychologie des Unbewussten (s. a. o.)
* Psychiatrie: ein medizinisches Hauptfach, dessen Forschungsgebiete Diagnose, Verlauf und Heilung von seelischen Erkrankungen sind (griech. ψυχή = „Seele“, ἰατρός = „Arzt“). Zunehmend an Bedeutung gewinnt durch die moderne Hirnforschung die Neuropsychiatrie, die die neurologischen Ursachen psychiatrischer Erkrankungen erforscht.
* Psychotherapie: entweder als Überbegriff für psychologische Verfahren (durch Psychologen ausgeführt) und medizinische Verfahren (durch Psychiater, die auch Medikamente verschreiben dürfen, ausgeführt) oder ausschließlich für die (sprachlich vermittelte) psychologische Behandlung mentaler Störungen gebraucht. (Vgl. folgendes Video; inzwischen existieren - s. u. - zahllose Schulen. In der Praxis werden häufig vermischte Verfahren angewendet; letztendlich entscheidet die Effektivität.) Das Wort ist von griech. ψυχή = „Seele“ und θεραπεύειν = „behandeln“, „sorgen“ abgeleitet.
Kaum ein psychologisches Konzept erlangte derartige Wirkmächtigkeit und strahlte weltweit in alle gesellschaftlichen Bereiche aus wie die von Freud (s. u.) entwickelte Theorie vom Unbewussten (fälschlich Unterbewussten). Gegner der Tiefenpsychologie (z. B. der Wiener Rohracher, s. o.) lassen nur physiologische Prozesse (z. B. Hormonausschüttung) als unbewusst gelten und halten die Tiefenpsychologie bzw. das Unbewusste für eine Hypothese, die zwar vieles erkläre, selbst aber weder widerlegt noch bewiesen werden könne.
-
Definition:
Dem Konzept vom „Unbewussten“ als hypothetischer Persönlichkeitsinstanz, in deren
Rahmen dynamische Prozesse ablaufen, liegt die Annahme zugrunde, dass es neben den bewussten Vorgängen
und Zuständen auch nicht wahrnehmbare („unbewusste“) seelische Komponenten gebe,
auf die man nur indirekt schließen könne (s. a. o.),
die aber dennoch das bewusste Erleben und Verhalten beeinflussen. Nach dem
Eisbergmodell finden weit mehr Prozesse im unbewussten als im bewussten Bereich
statt.
-
Zugangsmöglichkeiten:
Nach Sigmund Freud
(s. u.) gibt es vier Möglichkeiten,
Zugang zum Unbewussten zu finden (in dem allerdings laut heutiger Hirnforschung
nichts vorhanden sei, was theoretisch bewusst gemacht werden könne; abgedrängt
könne nach heutiger Terminologie höchstens ins Vorbewusste - s. o. - werden):
* Traumdeutung: Seit Aristoteles von Stagyros (Ἀριστοτέλης; 384-322 v. Chr.: „Traum ist Reaktion auf eine Störung“) wird der Traum psychologisch gedeutet. Artemidor (Ἀρτεμίδωρος ὁ Δαλδιανός; 1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.) unterschied in seiner Ονειροκριτικά („Traumdeutung“) zukunftsdeutende und Vorhandenes spiegelnde Träume. Freuds Hauptwerk Die Traumdeutung (s. hier; für ihn die „via regia der Psychoanalyse“) erschien - vordatiert - 1900. Darin betrachtet er den Traum als „Hüter des Schlafs“, der in codierten Botschaften, die interpretiert werden müssen, unbewusste Wünsche ausdrücke. Die Träume spielen für das Es dieselbe Rolle wie die Wahrnehmungen für das Ich (zu Freuds Instanzenlehre s. u.). Freud unterscheidet folgende
Trauminhalte:
| ° | manifester Inhalt: vordergründig, das Erzählbare; der von der Traumzensur metaphorisch erstellte Inhalt |
| ° | latenter Inhalt: der „wahre“, durch die Zensur verschlüsselte Hintergrund, der erschlossen werden muss |
Die Umwandlung vom latenten in einen manifesten Inhalt bewirke die „Traumarbeit“.
Mittel der Traumarbeit:
| ° | Verdichtung (z. B. Verschmelzung verschiedener Personen zu einer Traumfigur) = Agglutination |
| ° | Zerlegung: Merkmale einer Person können z. B. auf zwei oder mehrere Personen aufgeteilt werden = Deglutination |
| ° | Verschiebung (z. B. peinlicher Inhalte auf harmlose, vgl. a. u. „Abwehrmechanismen“) = Dilation |
| ° | Symbolisierung: Verwendung einer mehrdeutigen Bildsprache, von Freud z. T. entschlüsselt (z. B. stehe alles Ragende, Aufgerichtete, Lange für Männliches, alles Hohle, Ausgebreitete, Runde für Weibliches) = Permutation |
Weiteres zum Thema Traum: s. o.
* Fehlleistungen (von Freud in Zur Psychopathologie des Alltagslebens - s. hier - behandelt) treten v. a. im sprachlichen Bereich auf: „Freud'scher Versprecher“, aber auch Vergreifen, Verschreiben, Vergessen etc. (sog. Symptomhandlungen, s. a. u. „Abwehrmechanismen“). Fehlleistungen entstünden laut Freud keineswegs aus Unaufmerksamkeit oder zufällig, sondern seien Ausdruck unbewusster Konflikte. (Beispiele: „Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen.“ - „Bitte ziehen Sie ab.“) Oft (wie in den Beispielen, die tw. aus dem Buch Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten - s. hier - stammen) bestehen Versprecher aus Kontaminationen (Zusammenziehungen) zweier Redewendungen, die die eigentliche Redeabsicht entlarven.
* Hypnose: Versetzen in einen Trance-Zustand, in dem man Suggestionen, also einer Übertragung gefühlsbetonter Zustände oder Überzeugungen von einer Person auf eine andere (auch als Autosuggestion möglich) besonders leicht zugänglich ist. Vom Berliner (NS-)Psychiater Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) wurde die Hypnose zu Entspannungsübungen, die er Autogenes Training nennt, genutzt.
Technik: Freud hat die Hypnosetechnik in Paris von Jean-Martin Charcot (1825-1893; gilt als Begründer der modernen Neurologie und hat z. B. als Erster die Krankheit ALS beschrieben) gelernt. Fixieren eines meist glänzenden Gegenstandes in entspannter Ruhelage unterstützt die Müdigkeit, suggerierende Worte des Hypnotiseurs bewirken die verschiedenen
Hypnosestadien:
| ° | Stadium der Somnolenz (Schläfrigkeit) |
| ° | Stadium paralyticum (passives Zurückfallen der Gliedmaßen, wenn sie angehoben werden) |
| ° | Stadium der Katalepsie (Gliedmaßen behalten jede Stellung bei, in die sie gebracht werden). |
| ° | Stadium des Somnambulismus: In diesem letzten Stadium können Heilsuggestionen (z. B. bei hysterischen Lähmungen) durchgeführt oder posthypnotische Aufträge erteilt werden, die nach dem Aufwachen ausgeführt werden, wenn sie nicht moralischen Grundsätzen widersprechen (z. B. Mord) oder unmöglich durchzuführen sind. Die hypnotisierte Person sucht dann nach Scheinrechtfertigungen (z. B. dafür, warum sie gerade Papierschnitzel aus dem Fenster wirft). In diesem letzten Stadium, in das man nicht gegen seinen Willen gebracht werden kann, erwartet man, dass die Erinnerung weiter als im Wachzustand reicht und verdrängte Wunschvorstellungen sich zur Äußerung bringen lassen. |
Hypnose wird heute manchmal als Anästhesieersatz in der Medizin eingesetzt. Diese Analgesie-Anwendung wurde v. a. vom Amerikaner Ernest Hilgard (1904-2001) erforscht.
Weiteres zum Thema Hypnose: MEG-Gesellschaft für klinische Hypnose und hypnose.de
* Freies Assoziieren: Der Patient liegt (um Hemmungen - den Widerstand - auszuschalten) ohne Sichtkontakt zum Psychiater auf der durch Freud berühmt gewordenen Couch (das Original ist im Londoner Freud-Museum zu besichtigen) und muss rasch, von Stichwörtern geleitet, frei erzählen. (Eine Assoziation ist eine erlernte oder, wie hier, spontan auftretende Gedankenverbindung.) Da - wie bei den Fehlleistungen - laut Freud nichts zufällig passiert, lassen sich durch die Überlistung der zensurierenden Vernunft Rückschlüsse auf Verdrängtes ziehen.
Folgende Formen treten auf:
| ° | Gegensatzassoziationen (am häufigsten): z. B. groß-klein |
| ° | Ähnlichkeitsassoziationen: z. B. Hitze-Wärme |
| ° | Funktioneller Bezug: z. B. Vogel-Ei |
| ° | Logische Kategorie: z. B. Dogge-Hund |
| ° | Kontinuität: z. B. elf-zwölf |
| ° | Phonetische Assoziationen: z. B. Rose-Dose |
| ° | Spezifische Identifikation: z. B. Meer - Adria |
| ° | Persönlich Gefärbtes: z. B. auf Schule, Eltern |
Die letzten beiden Kategorien sind im angesprochenen Zusammenhang besonders wichtig. Prinzipiell treten Abweichungen von den durchschnittlich erwartbaren Antworten desto eher auf, je gebildeter bzw. geisteskranker jemand ist (Volksschulbildung 5%, Akademiker 12%, Schizophrene 25% Abweichung).
-
Abwehrmechanismen:
Auch Abwehrmechanismen gelten als
Fenster, die einen Einblick in den unbewussten Bereich des Menschen bieten. Sie ermöglichen einen Ausgleich der oft unerwünschten
Trieb-/Instinktforderungen mit den gesellschaftlichen Konventionen und stellen
Ersatzhandlungen für das Ausleben des Unbewussten dar. Freud
(s. u.; und andere, v. a. seine
Tochter Anna;
s. u.) unterschieden:
* Verdrängung: „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ der unerwünschten Triebansprüche oder unangenehmer Bewusstseinsinhalte. Das auf diese Art „Vergessene“ lässt sich durch die oben genannten Techniken wieder aktivieren, wobei der Bewusstwerdung Widerstand (der laut Freud von derselben Energie gespeist wird, die früher die Verdrängung bewirkt hat) entgegengesetzt wird. Ist der Energiebedarf nicht zu groß, gelingt die Verdrängung, sonst misslingt sie. (Ökonomisches Persönlichkeitsmodell, das die Verdrängung als eine Methode der „Unterbringung“ der Libido = Triebenergie ansieht). Verdrängung (z. B. einer sexuellen Misshandlung im frühen Kindesalter) kann manchmal ein Weiterleben erst ermöglichen.
* Isolierung: Im Gegensatz zur Verdrängung bleibt die abgelehnte Vorstellung bewusst. Ziel ist vielmehr sie zu isolieren, also - laut Freud ähnlich dem magischen Denken bzw. einem Berührungstabu -, eine psychische Assoziation durch scheinbare Abtrennung (z. B. durch Pausen, Unterbrechungen, aus dem Zusammenhang reißen, verbergen) bedeutungslos werden zu lassen.
* Rationalisierung: nachträgliche Scheinbegründung für in Wahrheit trieb- oder instinktbedingtes Handeln (z. B. Vorgabe wissenschaftlichen Interesses bei der Lektüre von Pornoheften; oft interpretierbar als Versuch einer Reduktion einer kognitiven Dissonanz: s. u.)
* Substitution: Ausrichtung der Trieb- oder Instinkttätigkeit auf ein Ersatzobjekt (z. B. Übertragung der Liebesgefühle für eine unerreichbare Person auf eine andere oder von Gefühlen für die Eltern auf den Analytiker)
* Reaktionsbildung: Umschlagen eines Verhaltens in sein Gegenteil, wenn die Triebwünsche unerfüllt bleiben (z. B. verdrängte Liebe in Hass)
* Sublimation: Überführen der für „primitive“ Regungen zur Verfügung stehenden Triebenergie in sozial höher bewertete Tätigkeiten. (Freud erwähnt als Beispiel das Malen nackter Männerkörper durch den homosexuellen Leonardo da Vinci, 1452-1519) Das Ich (s. u.) setzt der anstößigen Erregung eine Gegenbesetzung entgegen, die es als bleibende Veränderung aufnimmt. In einer dritten Phase kann das Verdrängte wiederkehren (Abnahme der Gegenbesetzung).
* Projektion: Die eigenen gehemmten Triebe oder unerwünschten Verhaltensweisen werden anderen zugeschrieben („von sich auf andere schließen“, Außenprojektion).
* Identifikation: Übernahme der Gründe der die eigenen Triebregungen unterdrückenden Autorität (z. B.: „Ich bin ja noch zu jung für eine sexuelle Beziehung“, wenn die Eltern eine solche torpedieren). Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Personen werden adoptiert (auch Introjektion, Internalisierung genannt). Die Übernahme der Eigenschaften der Angst einflößenden Autoritäten wirkt angstmildernd, da die Differenz vermeintlich ausgeglichen wird.
* Kompensation: Ausgleichen einer Minderwertigkeit durch Anstrengungen auf einem anderen Gebiet (z. B. Einschlagen der Militärlaufbahn bei physischer Unterentwicklung)
* Verschiebung: Die Affektbesetzung eines unerwünschten Bewusstseinsinhaltes wird auf einen harmlosen verschoben (s. a. o.: Traumarbeit), was sich als Phobie (z. B. Angst vor Mäusen statt vor einer peinlichen Neigung) oder Zwangshandlung (z. B. Pflastersteine zählen statt Ausleben von Geiz) auswirken kann.
* Regression: Das Zurückfallen in eine ontogenetisch (die Individualentwicklung betreffend im Unterschied zu phylogenetisch: die Stammesentwicklung betreffend) bereits überwundene Entwicklungsphase (z. B. Enuresis eines Dreijährigen bei der Geburt einer kleinen Schwester).
* Konversion: Überführen von psychischen Zuständen in physische Symptome (Psychosomatisches Syndrom, Somatisierung; bekannt ist z. B. der Zusammenhang von Stress: s. z. B. hier - zumindest von „schlechtem“ Disstress im Gegensatz zu „gutem“ Eustress; s. u. - und dem Verdauungssystem unter Beteiligung des vegetativen Nervensystems und des vom Hypothalamus ausgeschütteten Stresshormons CRF / Corticotropin Releasing Factor). Spezialfall: die artifizielle Störung des Münchhausen-Syndroms (nach dem Lügenbaron Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen, 1720-1797), das im Vortäuschen und künstlichen Hervorrufen von Krankheiten (als Münchhausen-Stellvertretersyndrom von solchen anderer, oft eigener Kinder) besteht.
SÜCHTE, PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN, GEISTES- UND GEMÜTSKRANKHEITEN
Zu einzelnen Krankheiten oder Zustandsbildern vgl. auch das (in seiner Suchfunktion) von A bis Z umfassend informierende MSD-Manual (Titel nach dem nach Friedrich Jacob Merck, 1621-1678, Alpheus Phineas Sharp, 1824-1909, und Louis Dohme, 1837-1911, einem Cousin des Backpulverproduzenten August Oetker, 1862-1918, benannten amerikanischen Pharmaunternehmen).
-
Allgemeines:
* Klassifikationen: Man unterscheidet
Abhängigkeiten
(Verlust der Selbstregulation), Neurosen (Verlust der Lebensfreude) und
Psychosen (Verlust der Realität). Bei den ersten beiden Gruppen herrscht meist
(zumindest potentiell) volle Krankheitseinsicht (auch wenn die Bedeutung ihrer
Zustände von den Patienten oft heruntergespielt
oder gar geleugnet wird), beim letzten Krankheitsbild wird der eigene Zustand nicht mehr
wirklichkeitsgemäß eingeschätzt. („Der Neurotiker baut ein Luftschloss, der
Psychotiker lebt darin. Und der Psychiater kassiert die Miete.)“ Häufig
besteht Kommorbidität im Verbund mit anderen psychischen Erkrankungen.
Eines der ersten Systeme der Klassifizierung psychischer Störungen (z. B. auch die Ausarbeitung des Begriffs „Dementia praecox“ oder „Manisch-depressives Irresein“) geht auf den deutschen Psychiater Emil Wilhelm Georg Magnus Kraepelin (1856-1926) zurück, der früh mit Wilhelm Wundt (s. o.) in Kontakt war. Schon weit früher postulierte der persische Universalgelehrte ابو زید احمد بن سهل بلخی / Abu Zayd al-Balkhi (ca. 850-934) das Gleichgewicht von Nafs (Psyche), Qalb (Herz) und 'Aql (Geist) als Voraussetzung für geistige Gesundheit. Die klinischen Anzeichen eines Krankheitsbildes nennt man Symptome (z. B. Kopfschmerzen; s. hier). Sie können subjektiv bemerkbar und / oder (nur) objektiv nachweisbar sein. Werden nur sie bekämpft, spricht man von symptomatischer Therapie, geht man auf die Ursache ein, von kausaler Therapie. Bündel von Symptomen heißen Syndrome (z. B. Alkoholsyndrom). Heute existieren
2 internationale Diagnoseklassifikationen:
| ° | die ICD 10 (International Classification of Deseases), eine Klassifikation der WHO, die auf den ersten internationalen statistischen Kongress in Brüssel 1853 zurückgeht, dessen Ergebnis der Beschluss war, eine einheitliche, internationale Nomenklatur der Todesursachen zu schaffen, und die alle, unter dem Buchstaben F auch psychische, Erkrankungen, umfasst. (Im Mai 2019 erschien die ICD 11 - auch in deutscher Entwurfsfassung -, die seit 1. 1. 2022 gilt.) |
| ° | das von der APA seit 1952 hgg. American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eine v. a. in den USA verbreitete Klassifikation der andauernden oder wiederkehrenden psychischen Störungen. 1980 hatte das DSM III zum ersten Mal der unzureichenden Nomenklatur durch Angabe expliziter Kriterien für die Diagnose psychischer Störungen Rechnung getragen. (2013 wurde das DSM IV vom DSM V abgelöst. Das erwünschte Ausmaß an Zuverlässigkeit der Diagnosen wurde aber auch dadurch nicht erreicht.) |
Die in Österreich verwendeten Diagnoseverschlüsselungen finden sich hier. - Vgl. auch „Onmeda - Krankheiten von A-Z“ und das umfassend informierende MSD-Manual (Suche A-Z).
* Ausgangslage in Österreich (Zahlen nach Psychosoziale Dienste Wien):
|
Zahlen zur psychischen Gesundheit in Österreich (tw. geschätzt): |
|
| ° | Jeder vierte Mensch wird zumindest einmal in seinem Leben ernsthaft psychisch krank. |
| ° | Davon nimmt etwa ein Fünftel professionelle Hilfe in Anspruch. |
| ° | Mindestens 20 % der Bevölkerung leiden innerhalb eines Jahres unter psychischen Störungen und davon ist etwa ein Viertel schwer betroffen. |
| ° | Etwa 2 – 3 % der Bevölkerung (für Österreich: ca. 200 000 Menschen) konsumieren an einem Stichtag wegen einer erheblichen psychischen Störung fachspezifische Hilfe. |
| ° | Etwa 1 % der Bevölkerung (für Österreich: ca. 90 000 Personen) wird jährlich erstmals psychisch krank. |
| ° | Die Depression ist inzwischen international auf dem ersten Platz, was „verlorene Lebensjahre durch Erkrankung“ betrifft. |
| ° | Das Suizidrisiko bei affektiven Störungen beträgt 15 %. |
| ° | Für 90 % der Sterbefälle in Folge von Suiziden werden psychische Erkrankungen und davon insbesondere Depressionen und Suchterkrankungen verantwortlich gemacht. |
| ° | In Österreich gibt es pro Jahr (mehr als) dreimal so viele Suizide wie Verkehrstote. |
| ° | Die Lebenserwartung psychisch kranker Menschen ist etwa um 10% verringert. |
| ° | Krankenstandstage und Frührente werden ca. zu 20% von psychischen Erkrankungen (mit)verursacht. |
| ° | Österreich weist 39 substanzbedingte Suchttodesopfer pro 1 Mio. Ew. auf (EU-Durchschnitt: 18) |
Weltweit litten nach WHO-Untersuchungen 2025 bei steigender Tendenz etwa eine Milliarde Menschen an psychischen Erkrankungen. Von 2011 bis 2021 wuchs diese Zahl (vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen) prozentuell schneller als die Weltbevölkerung. Betroffen waren überproportional der europäische und der (nord)amerikanische Raum. Der Westpazifik und Afrika wiesen geringe(re) Raten (aber möglicherweise - vor allem bei Frauen - eine höhere Dunkelziffer) auf. Die Bandbreite der Versorgung psychisch kranker Menschen schwankte, je nach Wirtschaftskraft eines Landes, zwischen 13 und 2 Spezialisten pro 100 000 Menschen; dabei wurden zwischen 65$ und 4 Cent pro capita aufgewendet.
* Normalitätsbegriff: Problematisch (da in Wahrheit eher eine graduelle Abstufung angenommen werden muss) erscheint - wie bei Behinderungen, s. o. - das Aufstellen einer exakten Trennlinie zwischen „normalen“ Menschen mit angemessener Realitätswahrnehmung und „psychisch kranken“ Menschen mit abweichendem Verhalten bzw. der Normalitätsbegriff überhaupt, der mathematisch-statistisch (im Sinn von durchschnittlich), funktional (im Sinn von aufgaben-, zweckerfüllend) oder sozial (im Sinne einer erwünschten Idealnorm, die letztlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist) aufgefasst werden kann. In der Psychiatrie werden Krankheiten und „Störungen“ (die leicht, mittel oder schwer ausgeprägt sein können) gemäß den in Lehrbüchern bzw. Diagnosemanuals beschriebenen Kriterien diagnostiziert bzw. Exazerbationen (Symptomverschlimmerungen), Remissionen (Zustandsverbesserungen) und Rezidive (Rückfälle) beobachtet.
Nach einer um 1995 entstandenen Terminologie nennt man Personen, die keine neurologischen Auffälligkeiten aufweisen und deren Befund somit der „Norm“ entspricht, neurotypisch. Innerhalb einer sehr breiten, wertneutral gedachten Neurodiversität befinden sich alle Krankheiten und Störungen als Varianten. (Diese Sichtweise soll Diskriminierungen verhindern und die positive Selbstsicht Betroffener fördern.)
Richard Bentall (*1956), der alle Gemütszustände auf einem Kontinuum angeordnet sah, in dessen Extreme jede/r abrutschen könne, schlug (um darauf hinzuweisen, dass Klassifikationen von Werturteilen verzerrt würden) vor, dass z. B. Happiness (Fröhlichkeit, Glücksgefühl) genauso wie eine Depression als mentale Erkrankung behandelt werden sollte, weil ihr Auftreten nicht „normal“ sei. (Vgl. auch Egon Friedell, 1878-Suizid 1938: „Gesundheit ist eine Stoffwechselerkrankung.“) Darüber hinaus bestimmen kulturelle Einflüsse, was als normal empfunden wird. Der Festinger-Schüler Elliot Aronson (*1932) wies darauf hin, dass „Menschen, die verrückte Dinge tun, [...] nicht unbedingt verrückt“ seien, da die Situation, in der sich Menschen befinden, enormen Einfluss auf sie haben könne, was konstant unterschätzt werde (vgl. fundamentaler Attributionsfehler; s. o.). Zu beachten ist auch die nicht immer leicht zu treffende Unterscheidung zwischen mad und bad (vgl. o.).
Ein 1972 veröffentlichtes Ex., das das Vertrauen in die Zuverlässigkeit psychiatrischer Diagnosen nachhaltig erschütterte, stammt von David L. Rosenhan (1929-2012):
| Rosenhan ließ sich unter Vortäuschung schizophrener Symptome in eine Psychiatrie, an der er unbekannt war, aufnehmen und wurde dort, obwohl völlig gesund, problemlos diagnostiziert. Danach verhielt er sich ganz normal, wurde letztlich aber nur gegen Revers entlassen, da alle seine Äußerungen und Verhaltensweisen als im Einklang mit der Diagnose stehend interpretiert wurden. Rosenhan machte diese Situation publik und kündigte an, dass in nächster Zeit ein weiterer gesunder „Patient“ versuchen würde, Einlass zu finden, der jedoch in Wirklichkeit gar nicht existierte. Daraufhin wurden zahlreiche echte Patienten der Simulation verdächtigt. Es gelang also professionellen Psychiatern nicht, „normale“ und „kranke“ Menschen einwandfrei voneinander zu unterscheiden. |
Schon 1964 hatte eine Studie enthüllt, dass die Übereinstimmung zweier psychiatrischer Diagnosen, die unabhängig voneinander am selben Fall erstellt werden, durchschnittlich nur 57% beträgt. Prinzipiell gibt es in der Psychopathologie so gut wie kein Phänomen, dass nicht auch im Normalbereich auftaucht. Die Quantität (Dauer) und zunehmende Intensität führt jedoch manchmal zu einer neuen (pathologischen) Qualität. (C. G. Jung, s. u.: „Alles, was uns an anderen stört, kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen.“)
* Drei Ursachengruppen werden nach dem biopsychosozialen Modell (1977 von George Engel, 1913-1999, propagiert und bald akzeptiert) immer wieder als Erklärung für psychische Krankheiten und Störungen genannt, können aber meist nicht eindeutig auseinandergehalten und identifiziert werden:
| ° | Biologie, v. a. Erbfaktoren:
die
genetisch-epigenetische Weitergabe einer Geisteskrankheit bzw. bestimmter
Veranlagungen als Voraussetzung dafür hängt möglicherweise mit allen
Ursachengruppen zusammen. Biologische und physiologische Faktoren betreffen
auch ev. noch nicht in allen
Einzelheiten bekannte biophysikalische und -chemische (hormonelle) Vorgänge
im Körper. (Die beliebige Beeinflussbarkeit der Stimmung durch
Psychopharmaka beweist ihre Mitbeteiligung.) Es geht wohl hauptsächlich um
neuromodulatorische Fehlregulationen bzw. strukturelle und funktionelle
Veränderungen des limbischen Systems. Die moderne Hirnforschung weist
hauptsächlich Störungen des serotonergen und des oxytocingesteuerten
Bindungssystems und eine Schwächung der Stress-Achse (HPA-
oder HHN-Achse, da die Hormone kaskadenartig einen endokrinologischen
Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde
durchlaufen) nach. (Zu Stress
s. a. o.)
Gerade im Vulnerabilitäts- (Diathese)-Stress-Modell zeigt sich die Wechselwirkung
zwischen angeborener Diathese (Krankheitsneigung) und schädlichen
Umweltfaktoren besonders gut. Bleiben letztere aus, kommt eine angelegte
Störung oder Krankheit manchmal gar nicht zum Ausbruch. (Dies betrifft u. a.
das Stresshormon
CRH - corticotropin releasing hormone -, das erst aktiviert wird,
wenn das bremsende Antistressgen, z. B. durch unsichere Bindung -
s. o. - epigenetisch -
s. o.
- deaktiviert wurde.) Umgekehrt verträgt ein von Vornherein gesünderer
Mensch denselben Stresslevel unbeschadet.
|
||||||||||||||
Walter Cannon (1871-1945) verwendete im Rahmen früher Theorien zum ersten Mal das Wort „Stress“. Die erste grundlegende Untersuchung zum Thema „Stress“ verfasste 1950 Hans Selye (1907-1982): The Physiology and Pathology of Exposure to Stress. In ihr beschreibt er die 3 Stadien Alarm - Widerstand - Erschöpfung. Besondere Beachtung verdienen in diesem Zusammenhang so genannte Life Events (unerwartete Todesfälle, Verbrechensopfererfahrungen, Kriegserlebnisse, Bankrott etc.), die 1967 von Thomas H. Holmes, 1918-1988, und Richard H. Rahe, 1936-2022, (s. hier) klassifiziert wurden. Diese Holmes-Rahe stress scale reicht von „Tod des Partners“ (100 Pt.) und „Scheidung“ (73 Pt.) bis zu „Weihnachten allein verbringen“ (12 Pt.) und „Geringe Gesetzesverstöße“ (11 Pt.). Mehr als 150 Pt. bedeuten Risiko, mehr als 300 Pt. hohes Risiko. |
|||||||||||||||
| ° | Psychologische Faktoren wie labile Persönlichkeitsstrukturen, der persönliche Lebensstil und seine Verhaltensmuster (die ihrerseits wieder auf biologische oder Umweltfaktoren zurückzuführen sein könnten) bilden die zweite Ursachengruppe psychischer Erkrankungen. Laut Reinhard Haller (*1951) ist die (weithin unterschätzte und oft durch Liebesvorenthalt verursachte) Kränkung (s. a. o.) einer der Hauptursachen psychischer Krankheiten (sowie für Terror, Mord und Krieg. Weltweit werden jährlich bis zu 20 000 Tote durch Ehrenmorde und Blutrache verursacht; vgl. a. u.) Als Kränkung wird nicht die Emotion, sondern eine Interaktion bezeichnet, die das Selbst (jenen Teil des Ich, dessen sich eine Person bewusst ist) und seine Werte nachhaltig erschüttert. Sie reicht von (der v. a. im Internet viel zu wenig ernst genommenen) Beleidigung über die Verbitterung (einer unheilbaren Kränkung, die Symptome wie bei PTBS, s. u., auslöst und zu psychogenem Tod führen kann) bis zur Demütigung (Entmenschlichung bei einseitiger Machtverteilung). Adelheid Kastner (*1962) definiert Kränkung als „Erschütterung des Selbstwerts durch eine relevante Person“. Es gebe allerdings kein Recht darauf, ungekränkt durchs Leben zu gehen. Die Entwicklung von Frustrationstoleranz sei eine Entwicklungsaufgabe (vgl. folgendes Interview). Positiv betrachtet können Kränkungen bei der Selbstkenntnis helfen, da sie (in völlig unzumutbarer Art und Weise) immer wunde Stellen treffen und damit nicht verarbeitete Probleme offenlegen. | ||||||||||||||
| ° | Umwelteinflüsse - sei es, dass
sie in der Familiensituation (gestörte Kommunikationsmuster innerhalb der
persönlichen Umgebung des Patienten; erfordert oft die Mitbehandlung der
Angehörigen) oder als fehlgegangene Lernprozesse, sei es, dass sie als (ev.
epigenetisch - bestimmte Gene aktivierend -wirksame) frühkindliche Gewalterlebnisse oder negative
Erfahrungen in späterer Kindheit oder Jugend, die zu psychodynamischen
Effekten führen, auftreten (Life Events, Traumatisierungen aller Art) - haben
ebenfalls Einfluss auf die spätere Verfasstheit der Psyche. Auch
wirtschaftliche Faktoren können eine Rolle spielen, wobei nicht nur Armut
psychische Probleme hervorruft, sondern die Kausalität auch umgekehrt gilt. Die frühkindliche
Bindungserfahrung (s.
o.) gilt als wichtigster Faktor für die spätere Entwicklung des
Menschen. Daher spielt eine besonders negative Rolle die
|
||||||||||||||
Zur sozialen Situation von Kindern und Jugendlichen s. OECD-Dashboard |
|||||||||||||||
* Resilienz: Mit der Frage, unter welchen Unständen manche Personen (bis zu einem Drittel) auch unter ungünstigsten Umständen ihre psychische Gesundheit und ein erfolgreiches Coping (= Reaktion auf Bedrohung, Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bzw. Belastungen aller Art; „mit etwas fertig werden“) aufrecht erhalten können (bzw. nicht süchtig, kriminell etc. werden), beschäftigt sich die Resilienzforschung. Als Begründerin gilt Emmy Werner, 1929-2017, die 1977 nach jahrzehntelanger Untersuchung von fast 700 in schwierigen Verhältnissen aufgewachsenen Kindern in Hawaii in ihrem Buch Die Kinder von Kauai deren unterschiedliche Reaktionen auf ihre Situation bzw. die zugrunde liegenden Faktoren beschrieb. (Ca. ein Drittel schaffte den Sprung in ein erfülltes Leben.) Resilienz (von lat. resilire = abprallen) ist die Fähigkeit eines Systems, innere oder äußere Störungen kompensieren zu können (im Gegensatz zu Vulnerabilität, also Verletzlichkeit). Diese Widerstandskraft gegenüber ungünstigen Einflüssen ist jedoch in der Bevölkerung ungleich verteilt und von einigen Faktoren abhängig. Laut Werner gehören dazu die Überzeugung, dass Krisen vorübergehen werden, die innere Zustimmung zu Unvermeidlichem, die Lösungsorientiertheit, die Überzeugung von Selbstwirksamkeit (ein von Albert Bandura, 1925-2021, entwickeltes Konzept von der Erwartung eines Menschen, gewünschte Handlungen auch in schwierigen Situationen aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich ausführen zu können), die Übernahme von Verantwortung, die Suche nach Bindungen und die Zukunftsorientierung:
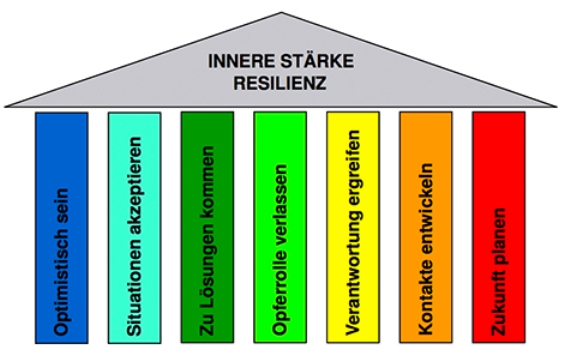
Abb. 4/1: Resilienzfaktoren nach E. Werner
(vgl. z. B.
hier)
Weitere wichtige Resilienzfaktoren sind „gute“ Gene (z. B. keine das Enzym Monoaminoxidase produzierende MAO-A-low-Genvariante, die aber - aufgrund der sie womöglich hemmenden Epigenetik - keinesfalls zu einem gescheiterten Leben verurteilt; vgl. die Video-Dokumentation Wie Gene unsere Persönlichkeit beeinflussen), Weiblichkeit, Fähigkeit zur Impulskontrolle, Intelligenz, soziale Kompetenzen und Anpassung (nicht nur als Ursache, sondern auch als Folge), interne Kontrollüberzeugungen (die im Unterschied zu den externen eine Stärkung nicht vom Schicksal, glücklichen Umständen etc., sondern von eigenen Anstrengungen erwartet), positive Selbstwahrnehmung, Interesse an der Umwelt, persönliche Beziehungen (am besten in sicherer frühkindlicher Bindung - s. o. - zu den primären Bezugspersonen, aber auch zu Lehrern, Großeltern etc., wenn dies nicht funktioniert hat) und Ähnliches mehr.
Ein ähnliches Konzept beschreibt Hans-Otto Thomashoff (*1964) mit den
4 Säulen des Lebensglücks:
| ° | erfüllende Beziehungen (beeinflusst von Kindheitserfahrungen) |
| ° | ausreichende Selbstwirksamkeit (das Gefühl, Einfluss nehmen zu können) |
| ° | ausgeglichener Stresshaushalt (Ruhephase und Anspannungsphasen stehen im Gleichgewicht) |
| ° | größtmögliche Kohärenz (Gefühl der Stimmigkeit in den Lebensvollzügen) |
Insgesamt geht die Resilienzforschung im Unterschied zu den Konzepten der Achtsamkeit (s. u.) oder Selbstsorge davon aus, dass die umgebende Welt schwierig, unsicher und bedrohlich ist (oder zumindest sein kann), ein gutes Leben in ihr aber bei entwickelter emotionaler Widerstandskraft, die eine Anpassung an die ungünstigen Verhältnisse ermöglicht, trotzdem möglich ist. (Zur unterschiedlichen Resilienz von Kindern in Bezug auf die Corona-Pandemie 2020ff s. folgendes Audiofile.)
Der Begriff Resilienz stammt ursprünglich aus der Materialienforschung. Resilienzfaktoren (wie die obigen von Werner oder die folgenden von Schulte-Markwort) sind solche, die in Untersuchungen - unter Ceteris-paribus-Bedingungen! (s. o.) - statistisch signifikant aufschlagen. Der Umkehrschluss (dass das Fehlen eines dieser Faktoren bzw. das Vorliegen eines Risikofaktors automatisch Probleme verursache) ist daher unzulässig.
|
Resilienzfaktoren nach Michael Schulte-Markwort (*1956; zit. nach einem Vortrag vom 11.11.2006 in Salzburg - ÖZBF) |
|||
|
|
|
||
| ° | mütterliche Berufstätigkeit im 1. Lebensjahr | ° | eine psychisch gesunde Mutter |
| ° | längere Trennung von der Bezugsperson im 1. Lj. | ° | eine stabile, positive Bezugsperson |
| ° | Geschwistergeburt in den ersten 17 Lebensmonaten | ° | gute Intelligenz |
| ° | körperliche oder seelische Erkrankung der Eltern | ° | positives Selbstwertgefühl |
| ° | chronische familiäre Disharmonie | ° | soziale Unterstützung |
| ° | väterliche Abwesenheit | ° | aktiv-problemlösendes Coping (s. o.) |
| ° | Armut | ° | internale Kontrollüberzeugungen |
| ° | Misshandlung | ° | liebevolle Beziehungen |
| ° | außerfamiliäre Unterbringung | ° | ein flexibles, annäherungsorientiertes Temperament |
| ° | Scheidung der Eltern | ° | sichere Bindungen |
| ° | ernste Erkrankungen in der Kindheit | ° | eine stabile Werteorientierung |
| ° | Geschwister mit einer Behinderung | ° | ein direktiver, aber liebevoller Erziehungsstil |
| ° | bei Mädchen: Schwangerschaft vor dem 18. Lj. | ° | das Fehlen von Risikofaktoren |
Vgl. a. das (außeruniversitäre) Mainzer Leibniz-Institut für für Resilienzforschung
-
Abhängigkeiten (Süchte):
Abhängigkeiten (das Wort „Sucht“ - „addiction“ - wurde 1964 von der WHO durch „Abhängigkeit - „dependence“ - ersetzt,
ohne dass dadurch die Problematik geringer geworden wäre)
sind Drangerlebnisse, die mit den Trieben (s. u.)
vergleichbar sind. Im Gegensatz zu diesen sind Süchte jedoch erworben und biologisch nicht sinnvoll. Die
verwendeten Suchtmittel bzw. Suchtsituationen können je nach kulturellem Hintergrund legal
(z. B. Alkohol) oder illegal (z. B. Heroin) sein. Die kombinierte
Abhängigkeit von mehreren Suchtmitteln (sie tritt mit zunehmender
Häufigkeit auf) durch Suchterweiterung nennt man Polytoxikomanie.
(Sie spielt bei Todesfällen eine große Rolle.) Die Schätzungen der
(substanzgebundenen) Konsumentenzahlen beruhen auf Abwasseranalysen, Umfragen
und Obduktionen. Die allermeisten Suchterkrankungen entspringen psychiatrischen
Grunderkrankungen. Jede Abhängigkeit hat
* Allgemeine Suchtmerkmale:
| ° | Der zwanghafte Drang zum Suchtmittelmissbrauch (Abusus) besteht über längere Zeit (Meidungsunfähigkeit) und zeigt einen phasischen Verlauf. |
| ° | Die Zuführung der euphorischen Dosis lässt sich nur schwer oder nicht beherrschen (Kontrollverlust trotz noch lange anhaltender Kontrollillusion). |
| ° | Es entsteht eine Toleranzentwicklung. (Das Suchtmittel wird eine Zeit lang immer „besser“ - in höheren Dosen - vertragen.) |
| ° | Es entwickelt sich eine starke Verdrängungsbereitschaft für die Gefährlichkeit des Suchtverhaltens bei gleichzeitigem Auftreten von Schuldgefühlen. |
| ° | Es entstehen relativ starre Suchtrituale bei relativ geringer Entspannung. Ohne Suchtmittel kommt es zum Entleerungserlebnis. |
| ° | Zum Suchtmittel wird eine quasipersönliche Beziehung aufgenommen; es erfolgt eine Funktionszuschreibung (z. B. Spannungsabbau). |
| ° | Es besteht Koartanz (Einengung der Handlungen und Gedanken auf die Beschaffung und den Genuss des Suchtmittels), das starke Substanzverlangen (Craving) ist unbändig. |
| ° | Eine Tendenz zur Dosissteigerung der die Lustgefühle herbeiführenden bzw. Spannungen abbauenden Stoffe bzw. Erlebnisse bis zu Exzessen (Progression) wird deutlich. |
| ° | Entzugssymptome (Unruhe, Schwitzen, Zittern etc.) und Versuche, diese durch den Suchtmittelkonsum zu vermeiden, treten auf. |
| ° | Die Schädlichkeit für den Einzelnen bzw. die Gesellschaft muss gegeben sein (daher keine „Sucht“ nach Salz, Sauerstoff, Schlaf, Zucker etc., wenn die Konsumation, die ja von der Natur erzwungen wird, nicht außerhalb des normalen Rahmens erfolgt - wofür jedoch im letzten Fall die in Supermärkten angebotene Produktpalette und die dazugehörigen Werbemaßnahmen sorgen). |
| ° | Suchterkrankungen bestehen lebenslang. Ähnlich einer Allergie kann die Krankheit nicht geheilt, sehr wohl aber abgestoppt werden, solange die Exposition zum Suchtmittel nicht gegeben ist. |
Die Grenze zwischen Sucht und Nicht-Sucht (bzw. Noch nicht-Sucht und Nicht mehr-Sucht) ist nicht immer leicht zu ziehen und bezieht sich nicht (ausschließlich) auf die konsumierte Menge des Suchtmittels (das substanzgebunden - z. B. Kokain - oder substanzungebunden - z. B. Glückspiel - sein kann). Wesentlich ist vor allem auch der Aspekt, ob der Stoff bzw. das Verhalten der Wirkung wegen konsumiert wird (und nicht nur des Genusses wegen). Man unterscheidet moderaten / erhöhten / problematischen / hochproblematischen Konsum. Um das Vorliegen eines Suchtverhaltens zu beurteilen, fragt man auch nach der durchschnittlichen Anzahl der Tage pro Woche, die ohne das Suchtmittel verbracht werden. (Liegt sie bei 0, 1 oder 2, ist eine problematische Abhängigkeit so gut wie sicher.) Letztendlich erreichen alle Suchtmittel die von den Konsumenten angestrebten Ziele nur kurzfristig bis gar nicht, langfristig verdammen sie zunächst zur (oft vergeblichen) Beschäftigung mit den Entzugserscheinungen bzw. zu Krankheit und Tod. (Zu Allgemeinem vgl. a. hier)
* Suchtpotential: Darunter versteht man die potentielle Gefährlichkeit eines Suchtmittels, also die Wahrscheinlichkeit, dass es Abhängigkeit erzeugt. Sie errechnet sich aus dem Verhältnis von suchtkranken Konsumenten zu nicht suchtkranken Konsumenten (z. B. bei Heroin vs. Orangensaft: nur wenige Heroinkonsumenten bzw. die meisten Orangensaftkonsumenten sind nicht süchtig).
* Probleme einer Legalisierung: Ob eine Droge in einem Staat legal oder illegal ist, kann nicht aus ihrer Gefährlichkeit für Leib und Leben abgeleitet werden (sonst wären Alkohol und Zigaretten in Österreich längst verboten), sondern ergibt sich aus den historischen Umständen und der Entwicklung der Politik, die dazu führt (geführt hat), dass Suchtgifte in unterschiedlichem Ausmaß „domestiziert“ werden (bzw. wurden). Die Verantwortungsträger sehen sich bei ihren diesbezüglichen Entscheidungen gezwungen, auf den „Volkswillen“ Rücksicht zu nehmen, der selbst wieder durch die bis dahin abgelaufene Geschichte geformt wurde. (In einer IFES-Umfrage 1993 hielten z. B. 90% der Wiener Bevölkerung Cannabis für gefährlich, 61% dagegen dosierten Alkoholkonsum für gesund.):
Die Subsumierung einer Substanz unter den Begriff „Droge“ erfolgt also nicht pharmakologisch, sondern politisch. Deshalb sind in den verschiedenen Staaten unterschiedliche Drogen legal bzw. tw. (durch das Zugeständnis einer persönlichen Mindestmenge) entkriminalisiert (Regelungen für Österreich im Suchtmittelgesetz und in entsprechenden UN-Abkommen). Der Nachweis eines vermuteten Drogenkonsums über die Haaranalyse ist nicht mehr alleiniger State of the Art, da eine Kontamination auch von außen erfolgt sein kann.
Die Vorteile einer Freigabe würden im Verschwinden der Subkulturen und damit der beim Erwerb entstehenden Kriminalität sowie in der Kontrollmöglichkeit und möglichen Verhinderung medizinischer Folgen durch verunreinigte Stoffe und / oder einer Drogeneinnahme unter unhygienischen oder gefährlichen Bedingungen bestehen. Zusätzlich würde der Staat Steuereinnahmen lukrieren. Nachteilig würden andererseits Zugang und damit Verfügbarkeit der entsprechenden Suchtmittel (auch für Kinder und Jugendliche) drastisch erhöht werden und die vom Staat durch eine Legalisierung ausgesendeten Signale womöglich zu unerwünschten Entwicklungen führen. Die Annahme, dass Prohibition den Reiz des Verbotenen befördere und ihren Zweck deshalb verfehle, lässt sich nicht erhärten. In Deutschland ergaben wissenschaftlich fundierte Schätzungen, dass durch drastische Einschränkung der Zugänglichkeit alkoholischer Getränke etwa ein Drittel der jährlich dort pro Kopf konsumierten 10 l reinen Alkohols nicht konsumiert würden (wie dies während der amerikanischen Prohibitionszeit oder heute in Skandinavien ja tatsächlich beobachtbar war/ist; die Rate der Leberzirrhosetoten ist in klassischen Alkoholländern wie Österreich oder Frankreich bei weitem höher als in solchen mit Restriktionen).
* Schulische Vorgangsweise: Das Vorgehen im österreichischen Schulwesen basiert (zumindest, was den Konsum, nicht, was den Vertrieb von Drogen anbelangt) auf dem Prinzip „Helfen statt Strafen“. Im Vordergrund steht das Überführen der Betroffenen in professionelle Betreuung. Nur wenn dies verweigert wird, folgen weitere Maßnahmen. - Vgl. Handlungsleitfaden und folgende Graphik:
Abb. 4/2: Vorgehen bei Suchtmittelverdacht in Schulen Österreichs
* Verlauf: Die wichtigsten Gründe, einer Sucht nachzugeben, liegen in folgenden nur kurzfristig erreichbaren, langfristig jedoch vergeblich erhofften oder erwarteten Effekten: Stressabbau, Entspannung, Stimmungsaufhellung, Gefühlsintensivierung, Enthemmung, Betäubung, Verdrängung, Steigerung von Leistung und Ausdauer, Sinneserweiterung und ähnlichen Auswirkungen. Dazu werden Suchtmittel über die Nase, das Blut, die Lunge oder den Magen aufgenommen und dem Gehirn zugeführt, das die Hauptrolle in diesem Geschehen (auch bei Süchten ohne Substanzen) spielt, da dessen Belohnungszentren aktiviert werden. Alles, was rasch zu einem Dopaminkick führt, drängt aus biologischen Gründen zur Wiederholung. Wenn im weiteren Verlauf Abhängigkeiten (die zunächst meist übersehen werden) entstanden sind, beginnt ein meist jahr(zehnt)elanger Leidensweg für die Suchtkranken und deren persönliches Umfeld.
Der Beginn besteht meist in einem langsamen (unmerklichen) Erlernen von Routinen, die den Suchtmittelkonsum beinhalten. Das alte Spiralmodell (der/die Süchtige gerät in eine sich selbst verstärkende Spiralbewegung vom Genuss zur Abhängigkeit „nach unten“) wurde durch das Korridormodell vom Hamburger Suchtforscher Peter Degkwitz (*1948) abgelöst: Der/die Süchtige betritt, aus der Abstinenz kommend, einen Korridor, an dessen beiden Seiten Zimmer liegen, aus denen eine Rückkehr eventuell noch möglich erscheint: links „Konsum“ und „regelmäßiger Konsum“, rechts „Genuss“ und „missbräuchlicher Konsum“. Erst am Ende des Ganges liegen die Zimmer „Gewöhnung“ und „Sucht“, die man ohne Hilfe nicht mehr verlassen kann.
* Wirkung: Die Wirkungsweise einzelner Suchtmittel ist unterschiedlich (s. u. „Süchte im einzelnen“). In den meisten Fällen liegt eine biochemische Beeinflussung des ZNS vor. (Die Hirnchemie kann auch durch Sekten, Kriminalität, Meditation etc. verändert werden.) Prinzipiell geraten Substanzen über den Blutkreislauf in das Gehirn und docken dort, z. B. mittels Dopamin, an die Belohnungszentren an, sodass der Wunsch nach Wiederholung dieses Vorgangs ausgelöst wird. Zu beachten ist, dass Ursache und Wirkung (z. B. Drogenprobleme / soziale Probleme oder Gehirnarchitektur / Suchtverhalten) nicht immer auseinandergehalten werden können (Henne-Ei-Problematik).
Es käme darauf an, die entsprechenden Neurotransmitter auf natürlichem, unschädlichem Wege zu stimulieren, wie dies zahllose isländische Kommunen bei Kindern und Jugendlichen ca. seit dem Jahr 2000 durch die Investition von ca. 10% der Haushaltsbudgets in „Natural Highs“ wie Sport-, Musikunterricht, gesunde Ernährung etc. mit Erfolg versuchen: Risiko- und Schutzfaktoren - z. B. wenig / viel emotionale Unterstützung, kein Wissen über den Verbleib der Kinder / positive Beobachtung der Kinder, wenig / viel gemeinsame Eltern-Kind-Zeit, keine / viele gemeinsame, von allen anerkannte Regeln, über die nicht diskutiert werden muss etc. - werden erhoben und die entsprechenden Maßnahmen unter Wirkungsnachweispflicht implementiert, was z. B. den auch gesellschaftlich bedingten Alkoholkonsum bei 15-Jährigen von 52% auf 5% reduziert hat.
| ° | Physische Abhängigkeit: nicht bei allen Süchten vorhanden (vgl. u. z. B. Spielsucht). Führt im Extremfall zum Tod bei übergangslosem Entzug, sonst zu Entzugserscheinungen. (Ausschließlich körperlich ist die Abhängigkeit nur bei neugeborenen Süchtigen.) |
| ° | Psychische Abhängigkeit: immer vorhanden, letztendlich wirkmächtiger als die physische Abhängigkeit; liegt v. a. im Erlebnis der Zwanghaftigkeit. Entzugserscheinungen können sich trotzdem z. T. physisch (z. B. im Zittern, Schwitzen etc.) äußern. |
* Ko-Abhängigkeit: Darunter wird die Situation der Angehörigen der Suchtkranken bzw. deren Rolle bei der Entstehung und v. a. der Aufrechterhaltung der Sucht verstanden. Die Reaktionen der Umwelt schwanken zwischen Bagatellisierung und Dramatisierung bzw. Stigmatisierung. Oft entwickelt sich ein negatives Froschkönigsyndrom: Der geküsste (umsorgte) Frosch wird trotz der Bemühungen um ihn nicht zum Prinzen, man selbst aber womöglich zum Frosch, der in die Situation hineingezogen wird und selbst in Nöte gerät (ein Beweis dafür, dass externe Hilfe angefordert werden muss). Beobachtbar ist in betroffenen Familien nach Thomas von Villiez (*1943; Sucht und Familie 1986) oft die zentrale, organisierende Kraft, die z. B. das Alkoholismus-System verleiht, die Familiensucht der Suchtfamilie, die Kohäsion durch Selbstdestruktion bei gleichzeitiger Taubheit für außerfamiliäre Informations- und Hilfsmöglichkeiten. Nach Joan K. Jackson (1922-2016) erfolgt der Verlauf einer Ko-Abhängigkeit in
7 Phasen:
| ° | Verleugnung der Erkrankung des/der Angehörigen |
| ° | Soziale Isolierung der Familie, im Inneren (untaugliche) Kontrollausübung |
| ° | Kapitulation (Aufgabe des Versuchs, die Abhängigkeit des Kranken zu kontrollieren) |
| ° | Rollenverschiebung; Familienmitglieder kompensieren die Rolle des/der Abhängigen |
| ° | Trennung von der abhängigen Person |
| ° | Reorganisation der Familie, jetzt Veränderung auch bei dem/der Abhängigen möglich |
| ° | Neubeginn durch Wiederaufnahme des/der Abhängigen oder getrennte Entwicklung |
Die richtige Vorgangsweise gegenüber suchtkranken Angehörigen bestünde darin, eine Vertrauensbasis herzustellen, Empathie zu zeigen, sich selbst Hilfe zu holen, keine Diagnosen zu stellen und vor allem den Kranken dazu zu bringen, seine Krankheit als solche anzuerkennen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. (Bei Alkoholkranken beträgt z. B. der Zeitraum vom Auftreten der Symptome bis zur ersten Therapie im Durchschnitt 8 Jahre; viele Betroffene haben sich in diesem Zeitraum bereits suizidiert.)
* Ursachen: Eine Prädisposition zu einer in früheren Zeiten vermuteten „Suchtpersönlichkeit“ scheint es nicht zu geben. Meist treffen mehrere, in ihrer Gewichtung nachträglich nicht mehr quantifizierbare Faktoren zusammen (s. a. o.: Ursachengruppen; vgl. dazu auch die informative Seite der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren). Die gängigsten der dieser Frage zugrundeliegenden Theorien verwenden den kognitiven Ansatz (ursächlich seien dysfunktionale kognitive Prozesse), den biologischen Ansatz (ursächlich seien genetische Faktoren und/oder dysfunktionale Neurotransmitter), den lerntheoretischen Ansatz (ursächlich seien fehlerhafte Lernprozesse und falsch konditionierte Verhaltensweisen) und den psychodynamischen Ansatz (ursächlich seien unbewusste Kindheitskonflikte und unterdrückte Triebimpulse). Sie beziehen sich auf folgende Faktoren:
| ° | labile Persönlichkeit (Frustrationsintoleranz, bedingt durch verzärtelnde oder Scheinanpassung hervorrufende autoritäre Erziehende oder Unsicherheit erzeugende wechselnde Erziehungsstile, in denen Kinder nicht mehr wissen bzw. „ausrechnen“ können, ob sie für bestimmte Verhaltensweisen Lob, Ignoranz oder Strafe erwarten können (oft auch Ursache für die Entwicklung krimineller Energien etc.). Wenn Kinder keine Orientierungsmöglichkeit angeboten bekommen, so schädigt dies ihre Entwicklung nachhaltig. (Sogar übermäßige, aber konsequente, gewaltlose Strenge hat bessere Prognosen.) Süchte gelten als (in einer sinnentleerten und Angst machenden Umwelt zunehmend auftretende) Abwehrversuche bei Hoffnungs- und Interesselosigkeit, Sicherungsangst, Verdecken uneingestandener Unterlegenheit, Tarnung von Depressivität und ähnlichen Phänomenen. |
| ° | äußere Umstände (z. B. frühkindliche Traumen, Gewalt-, Misshandlungserfahrung, Entbehren oder Verlust einer Bezugsperson, Versagen in Beruf oder Schule, depressive Mutter, tyrannischer Vater etc. etc.) Auch die Verfasstheit der umgebenden Gesellschaft (und der Peergroups) mit ihren Einstellungen und Werten und suchtkranke Angehörige als „Vorbilder“, von denen man „lernt“, haben Einfluss auf das Abhängigkeitsverhalten. |
| ° | Erbfaktoren (kongenitale Disposition) oder physische / biochemische Ursachen (z. B. Defizite in der Verarbeitung von Alkohol, der dann eine Triggerfunktion hat, wegen fehlender oder schadhafter Enzyme; die Alkoholdehydrogenase, die Ethanol in Ethanal umwandelt, funktioniert z. B. allgemein bei Frauen oder manchen indigenen Völkern schlechter als bei Männern oder weißen Europäern). In letzter Zeit wird die Aktivierung gewisser Neurotransmitter untersucht, die das Gehirn „belohnen“. Das Nervensystem beeinflusst nach Theorien des US-Hirnforschers Jon-Kar Zubieta (*1961?) je nach dem Spiegel der körpereigenen Opioidrezeptoren, der auch die Schmerzverarbeitung und Stimmungen steuert, die Neigung zum Drogenkonsum. Chronisches Suchtverhalten wird von der Suchtforscherin Nora Volkov (*1956), einer Urenkelin Trotzkis, (eig. Лев Давидович Бронштейн, 1879-Eispickelmord 1940) auf fehlerhaft arbeitende Rezeptoren für Dopamin (das Belohnung, Selbstkontrolle, Entscheidungskraft und Urteilsvermögen signalisiert) zurückgeführt. |
* Behandlung: Süchte werden mit Entziehungskuren (in Österreich z. B. im 1956 von Hans Hoff - s. u. - und seinem „Verein Trinkerheilstätte“ gegen den Widerstand der Sozialversicherungsträger als „Genesungsheim Kalksburg“ gegründeten Anton Proksch Institut, benannt nach dem unterstützenden damaligen Sozialminister Anton Proksch, 1897-1975, einer der größten europäischen Suchtkliniken), die z. T. ambulant, z. T. stationär durchgeführt werden, behandelt. Das Suchtmittel wird
| ° | abrupt abgesetzt (das Entzugssyndrom wird mit Beruhigungsmitteln abgefangen) oder |
| ° | ausschleichend dosiert (z. T. mit dem Ziel des kontrollierten Konsums) und / oder |
| ° | durch ein weniger stark wirksames Suchtgift ersetzt (Substitution; z. B. Methadon oder Substitol statt Heroin) bzw. medikamentös bekämpft (z. B. mit Naltrexon - C20H23NO4 - oder Semaglutid - C187H291N45O59 - bei Alkoholismus; beide Medikamente dienen auch zur Gewichtsreduktion bei adipösen Patienten). |
Die Methode der Wahl hängt von der Art der Abhängigkeit, der Ausrichtung der Therapeut/innen und der Persönlichkeit der Patient/innen ab und beginnt mit der Kontakt- und Motivationsphase. Ambulante Therapien scheitern oft an der Rückkehrmöglichkeit in das gewohnte Suchtmilieu. Ein Entzug besteht immer aus der oft unangenehmen, aber im Verhältnis zum Kommenden relativ unproblematischen Entgiftungsphase und der weit schwierigeren Entwöhnungsphase. Die Dauer einer Therapie beträgt meist mehrere Jahre, die Rückfallquoten sind hoch. (Mark Twain, eig. Samuel Langhorne Clemens 1835-1910: „Eine schlechte Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muss sie die Treppe runterboxen, Stufe für Stufe.“) Eine begleitende psychotherapeutische Betreuung - vor allem eine Nachsorge- und Rehabilitationsphase zur Rückfallvorbeugung - ist notwendig.
Erfolgreich hat sich das von Michael Musalek, *1955, entwickelte Orpheus-Therapieprogramm erwiesen. Es beruht darauf, dass andere Quellen von Dopaminduschen als die der Suchtmittel genutzt werden. (Die Analogie besteht darin, dass Ὀρφεύς / Orpheus den Gesang der Sirenen als attraktiv, jedoch lebensbedrohend erkennt, aber letztlich mit seiner Leier etwas entgegenzusetzen hat, das die Verführungskraft der Fabelwesen besiegt.) Die Therapie durchläuft nach der Motivationsphase, der Entzugsphase und der Stabilisierungsphase, in der Begleiterkrankungen behandelt werden, eine lebensnahe Gestaltungsphase, die mit dem Ziel neue Schwerpunkte setzt, das Leben lust- und sinn(en)voll zu machen und mit soviel Schönem anzureichern, dass das Suchtmittel seine prominente Rolle verliert.
Besser als Therapie ist vorausschauende Problemvermeidung, also Prävention bzw. Prophylaxe (vgl. Fachstelle für Suchtvorbeugung Niederösterreich oder Informationen zur Suchtprävention bei Schüler/innen), die am wirksamsten (durch Erziehung mit liebevoller Konsequenz in einem wohlwollenden Umfeld) in den ersten drei bis sechs Lebensjahren erfolgt.
* Einige Übersichten und Graphiken (Zahlen und Grahiken zu einer europaweiten Studie über Drogenkonsum auf Basis von Abwasseranalysen finden sich auf der Seite der EUDA (European Union Drugs Agency
|
Suchtfördernde Faktoren im Jugendalter: |
|
| Droge: | |
| Verfügbarkeit | |
| Erreichbarkeit | |
| Wirkungsweise | |
| Suchtpotential (s. o.) | |
| Umwelt: | |
| Elternhaus: | Erziehungsstil |
| Einstellung zu Suchtmitteln | |
| Ressourcen (Geld) | |
| Freundeskreis: | Kommunikationskompetenz |
| Einstellung zu Drogen | |
| Konsument: | |
| Selbstwertgefühl | |
| Belastungsfähigkeit | |
| Frustrations-/Spannungstoleranz | |
| Kontakt-/Beziehungsfähigkeit | |
| Zukunftsperspektiven | |
| Einstellung zu Rauschmitteln | |
|
Folgende Substanzen wurden von Österreicher/innen
mindestens einmal konsumiert |
|||
| Alkohol | 97% | Aufputschmittel | 7% |
| Nikotin | 76% | Abmagerungsmedikamente | 6% |
| Schlaftabletten | 15% | Ecstasy | 4% |
| Beruhigungsmittel | 14% | Kokain | 6% |
| Illegale Drogen (ohne Cannabis) | 10% | LSD | 2% |
| Cannabis | 25% | Opiate | 2% |
| Cannabis bei Unter-24-Jährigen | 45% | Amphetamine | 1% |

Abb. 4/3
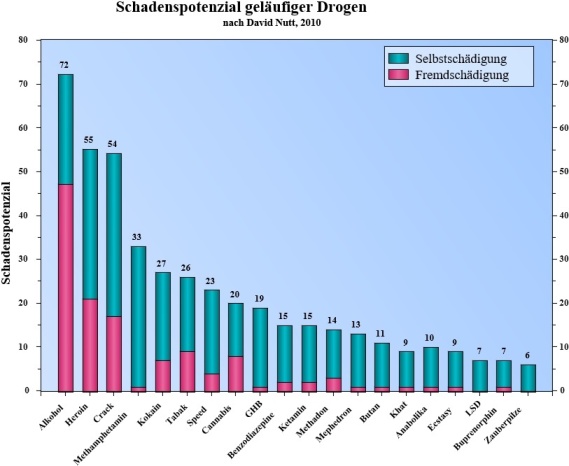
Abb. 4/4 (Quelle: David
Nutt, *1951, u. a.,
Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis
zit. nach https://de.wikipedia.org/wiki/Droge)
| ° |
Alkoholismus: Vgl.
Anton
Proksch-Institut,
What are the effects of alcohol on the brain?,
BBC
Seite 1, Seite der Suchthilfe Wien und
ein „Metareferat“
zum Thema Alkohol. In der westlichen Welt ist Alkohol eine der führenden
Drogen. Gemessen an volkswirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden
verblassen in vielen Staaten der Erde andere negative Einflüsse. Laut
WHO waren 2016 weltweit 2,6% aller Über-14-Jährigen alkoholabhängig
+ Typischer Verlauf: Der Weg in den Alkoholismus beginnt, wenn das Genusstrinken vom Wirkungstrinken abgelöst wird. (Die euphorische Dosis übersteigt die Rauschdosis, man trinkt „um zu“, z. B. um sich für einen anstrengenden Tag zu belohnen.) Der schädliche Gebrauch geht fließend in die Sucht über. Typische Stadien sind: gelegentliches Entlastungstrinken - Steigerung der Toleranzdosis - Trinken zu unüblichen Zeiten, heimliches Trinken - Leugnen des Alkoholproblems (das kein bewusstes Lügen, sondern eine anders wahrgenommene Realität oder Wunschvorstellungen darstellt, die Teil der Erkrankung ist) - Erinnerungslücken, Korsakow-Syndrom (s. o.) - Zunehmender Kontrollverlust und soziale Probleme - Schuldgefühle - Hochtrabendes, aggressives Imponierverhalten - Trinken mit sozial „Tieferstehenden“ - Vernachlässigung der Nahrungsaufnahme, körperlicher Verfall - Zittern - Alkoholverträglichkeit nimmt ab - Vorrat an Ausflüchten der Umwelt (die oft lange gutgläubig bzw. naiv agiert) gegenüber ist erschöpft - Auffälligkeit im öffentlichen Raum - Alkoholhalluzinose, Delirium tremens (mit herabgesetzter Bewusstheit, Orientierungsstörungen, Situationsfehleinschätzungen, oft Fieber, Halluzinationen; Übergänge Entzugssystematik - Prädelir - Delir sind fließend) - Eingeständnis völliger Hilflosigkeit (Voraussetzung für Beginn einer erfolgreichen Therapie; oft erst nach Zusammenbruch von Familien- und Berufsleben). + Wirkung: Alkohol kann aufgrund seiner Fettlöslichkeit barrierelos die Blut-Hirn-Schranke passieren. Binnen Minuten werden GABA und Serotonin ausgeschüttet, Dopamin, Noradrenalin und körpereigene Opiate steigen an Alkohol wirkt zunächst leicht stimulierend, dann aber bald dämpfend bis narkotisierend, langfristig im schlimmsten Fall psychotisierend. Am Folgetag des Abusus kann aufgrund der Hirndehydrierung ein hyperästhetisch-emotionaler Schwächezustand (Himleistungsschwäche mit dynamischer Verschiebung, neuroasthenischer Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, Schreckhaftigkeit, Verstimmbarkeit, vegetativer Labilität etc.; „Kater“ genannt) entstehen. + Erscheinungsformen (tw. Stadien) nach Elvin Morton Jellinek (1890-1963): Er beschrieb 1951 folgende Typologie der Trinkgewohnheiten (vgl. Seite über Jellinek).
+ Probleme und Gefahren: Omnipräsenz des Alkohols, „gesellschaftliches Trinken“, Missbrauch von Alkohol als „Medikament“, zahlreiche Folgeschäden (Unfälle, Gewaltdelikte, Partnerschaftsprobleme etc.) und vor allem der Verlust des Verantwortungsbewusstseins. Im Unterschied zu anderen psychotropen Substanzen hat Alkohol eine Vielzahl von Wirkungen und schädigt alle Körpersysteme: in niedriger Dosierung wirkt er euphorisierend, schmerzstillend, enthemmend und anxiolytisch, in höherer Dosierung bewirkt er kognitive Beeinträchtigungen, wirkt aggressionsverstärkend, Dysphorien hervorrufend oder gar depressiogen (was in Verbindung mit der Dämpfung der Hemmungen manchmal im ungeplanten Suizid endet; zum Suizidrisiko s. u.). Die körperliche Vergiftung kann von der Leber bald nicht mehr verarbeitet werden. Als Folge treten Leberzirrhose und zahlreiche Krebsformen auf. Weitere Gefahren: Durch die Plazentagängigkeit von Alkohol negative Beeinflussung von Schwangerschaften (fetales Alkoholsyndrom; s. o.), negative Beeinflussung der noch anhaltenden Gehirnentwicklung bei unter 20-25-Jährigen, negative Beeinflussung des Schlafrhythmus, Herabsetzung der Reaktionsfähigkeit und veränderte Zeitwahrnehmung, was zu (Verkehrs)unfällen führt, Wegfall der Aggressionshemmung (führt zu Gewaltdelikten, Misshandlungen, Mord...; vgl. auch den Gewaltausbruch im australischen Outback nach Aufhebung des Alkoholverkaufverbots 2022), Senkung der Krampfschwelle (und damit Erhöhung der Wahrscheinlichkeit für epileptische Anfälle), Beeinflussung des Herzmuskels (dilatative Kardiomyopathie) und anderes mehr. Durch das Absterben von Nervenzellen in der Peripherie ist die Polyneuropathie eine der häufigsten Folgeerscheinungen. Weiters betroffen sind z. B. die Haut, die Bauchspeicheldrüse, das Verdauungssystem und die Knochen. Über das GABA-, das Glutamin- und andere Systeme wirkt Alkohol zudem negativ auf das Gehirn ein, was bis zur Atemlähmung führen kann. Weltweit sterben jährlich über 3 Mio. Menschen an Alkoholmissbrauch (alle 10 Sekunden einer; mehr als durch Gewaltverbrechen, Verkehrsunfälle und illegale Drogen zusammen). In der EU gibt es ca. 23 Mio. Abhängige. Der weltweite Umsatz der Alkoholindustrie, deren enormer Einfluss auf die Torpedierung des Ziels der Verminderung des Alkoholkonsums sich dadurch erklärt, wurde 2024 auf 1.591 Mia. € (ca. 8% durch den Verkauf an Minderjährige; allein in China 198 Mia. € häuslicher Umsatz) geschätzt. Nach der 2021 erstellten Global Burden of Disease Study (s. hier) muss inzwischen jede positive Wirkung von Alkohol ausgeschlossen werden (vgl. auch den treffenderen englischen Ausdruck „intoxication“ für Rausch), im besten Fall kommen (bei Nicht-Süchtigen und geringen Mengen) keine negativen Wirkungen zum Tragen. Alkohol verantwortet als psychoaktives Zellgift mehr als 200 gesundheitliche Folgen (Krankheiten bzw. Unfälle), jede konsumierte Menge ist risikobelastet und gilt als potentiell gesundheitsschädlich. (In diesem Zusammenhang sind auch die sogenannten Harmlosigkeitsgrenzen - Männer 24g reiner Alkohol, Frauen 16g - zu verstehen. Ein gesunder, nicht vorgeschädigter Körper verträgt nach neueren Schätzungen durchschnittlich höchstens 15g Alkohol pro Tag, und auch das nur dann, wenn diese Menge nicht regelmäßig konsumiert wird.)
|
||||||||||||||
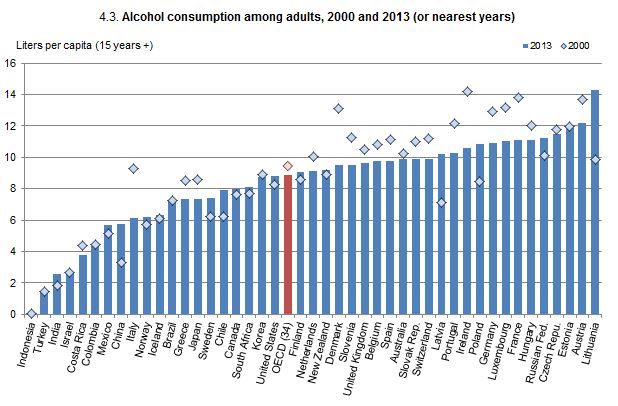
Abb. 4/5a: Grafik der
OECD 2000/2013
Seit den
2020er-Jahren liegt Österreich nach Lettland, Litauen, Tschechien, Bulgarien und
Estland an 6. Stelle
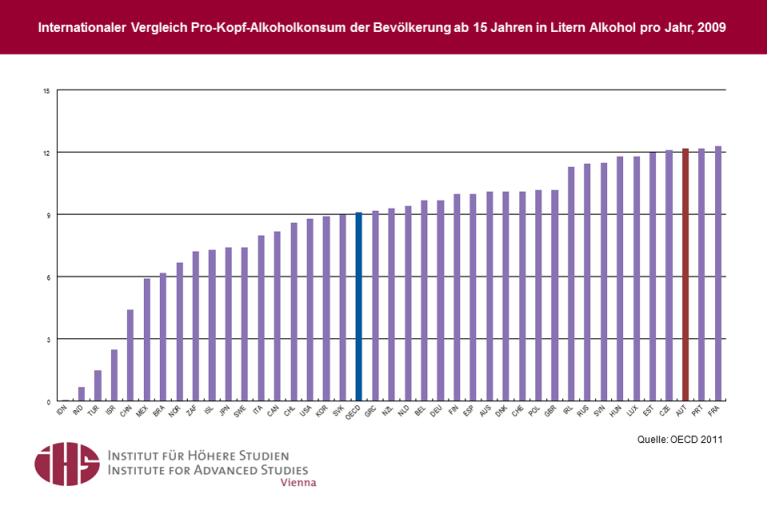
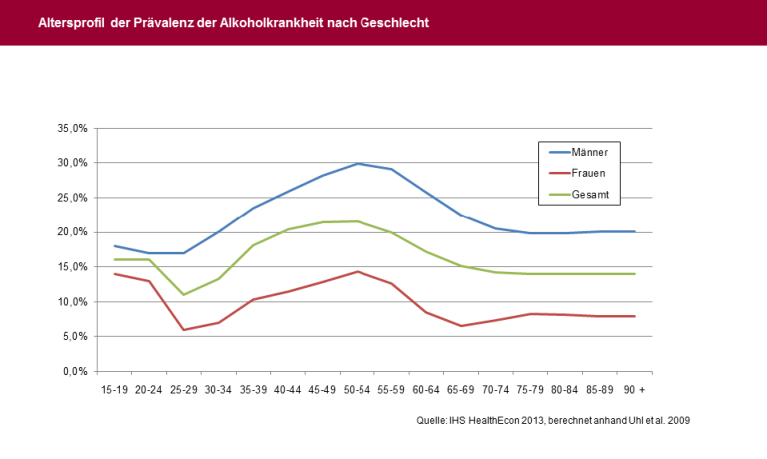
Abb. 4/5b: Zwei Grafiken des IHS zum Thema „Alkohol in Österreich 2011“
| ° | Nikotinsucht: Die Zigarettensucht ist die trotz einer
seit einiger Zeit recht starken Gegenbewegung, die gesetzliche Maßnahmen
provoziert hat, häufigste Abhängigkeit in Österreich
(20-25% der Erwachsenen über 16 rauchen;
s. u.). Legal darf Tabak (von Christoph Kolumbus,
1451-1506,
populär gemacht), der das - nach dem frz. Gesandten Jean
Nicot (1530-1604) benannte - Gift
Nikotin
(ein Alkaloid) enthält, geraucht werden. International versucht man seit
geraumer Zeit, den Nikotinkonsum durch diverse Maßnahmen (wie z. B. den
Aufdruck von Warnhinweisen) zu bekämpfen. Neuseeland hat Ende 2022
beschlossen, das Rauchen aufsteigend ab dem Jahrgang 2009 zu verbieten.
Neben Zigaretten kursieren (vor allem unter Jugendlichen) zunehmend alternative
Nikotinprodukte wie Pouches (Beutel, die man unter die Lippe schiebt;
tw. tabakhaltig = Snus), Heets (Tabaksticks), Shishas
(Wasserpfeifen) und E-Zigaretten (Vapes = Vaporizer, deren Konsum sich bei
Jugendlichen in kurzer Zeit vervierfacht hat), die ebenfalls hohes Suchtpotential
aufweisen. Das TNRSG (Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz; s.
hier) regelt Tabak und E-Zigaretten, nicht jedoch Nikotinbeutel. Vgl. z. B. Rauchen 1, 2, Nikotinsucht-Test + Verlauf: Durch Gruppendruck meist schon sehr früh Erstkontakt zu Zigaretten (in Österreich oft schon im Alter von 9 bis 12 Jahren). Schon bald starke psychische Abhängigkeit. Ursache ev. Fixierung der oralen Phase (s. u.). Entwicklung im Extremfall zum Kettenraucher mit chronischem Nikotinismus, einer Vergiftung. (60 mg Nikotin sind für den Menschen tödlich.) Begleitende Symptome: Appetitlosigkeit, Blutgefäßschädigungen (Herzkranzgefäße!), Magen-, Darmgeschwüre, Pankreaskrebs etc. + Wirkung: Nikotin wirkt anregend, macht wach, unterdrückt das Hungergefühl und verursacht einen massiven Dopaminkick. Die oft angestrebte erhöhte Leistungsfähigkeit besteht aber nur kurz und wird durch die Folgeerscheinungen hart erkauft. + Gefahren: Nikotin ist ein Nervengift, das die Blut-Hirn-Schranke (die das Gehirn vor schädlichen Blutproteinen schützt, aber hinderlich ist, wenn Medikamente eingeschleust werden sollen) rasch passiert. Es stört die Schlafarchitektur, senkt die Hauttemperatur (bewirkt schnelleres Frieren), steigert die Atemfrequenz und wegen der Übererregung der entsprechenden Rezeptoren auch die Schmerzempfindlichkeit. Die Rauchinhaltsstoffe, z. B. Teer, sind kanzerogen (ca. 90% aller 3500 Lungenkrebstoten, die es jährlich in Österreich gibt, waren vor ihrem Ableben Raucher). Eine Hauptgefahr liegt im frühen Einstiegsalter und dem hohen Suchtpotential (s. o.) des Zigarettenrauchens. (Darüber hinaus sind E-Zigaretten Elektroschrott, der oft nicht sachgemäß entsorgt, sondern nachlässig weggeworfen wird, wodurch Brände verursacht werden können.)
|
||
| ° |
Koffeinsucht (Koffeinismus):
ist die dritte (und am wenigsten gefährliche) der drei (in Europa) so
genannten Alltagssüchte. Koffein - ein Purinalkaloid mit der
Summenformel C8H10N4O2
- ist in Kaffee, Tee, Cola, Guarana, Schokolade, Energy Drinks usw.
enthalten. + Wirkung: Koffein ist psychoaktiv und aufputschend. Es verbreitete sich in Europa im 17. Jhdt. im Zusammenhang mit den Türkenbelagerungen. Die Halbwertszeit der Substanz im Körper beträt etwa 5 Stunden. + Gefahren (vor denen schon Carl Gottlieb Hering, 1766-1853, in seinem Kanon „C-A-F-F-E-E / trink nicht Caffee, Caffee / nicht für Kinder ist der Türkentrank / schwächt die Nerven, macht dich blass und krank / sey doch kein Muselmann / der ihn nicht missen kann“ warnte) bei Überdosierung: Verwirrung, Unruhe, Herz- und Kreislaufprobleme, Magenprobleme, Schlafprobleme etc. |
||
| ° |
Medikamentensucht: entsteht oft durch Vorbildwirkung: Kinder sehen, oft täglich,
ihre medikamentenschluckenden Eltern und einen immer vollen Arzneischrank,
der auch ohne ärztliche Vorschreibung und auch dann, wenn der Körper
seine Beschwerden selbst bewältigt hätte (also in den meisten Fällen)
benutzt wird.
In ihrer Bedeutung wird diese „stille Sucht“ unterschätzt. Die Sensibilität
ist bei leistungssteigernden Substanzen in Bezug auf den Sport relativ hoch, in
Bezug auf das Alltagsdoping (unter empfundenem Erfolgsdruck hauptsächlich
bei Freizeitaktivitäten, in geringerem Ausmaß auch in der Arbeit angewendet)
jedoch erstaunlich gering. Ursache der zugrunde liegenden Überforderungs- und Überlastungssituationen sind nach Günter Ropohl (1939-2017; ausgeführt 2014 im Buch Besorgnisgesellschaft) neben Gründen, die im persönlichen Umfeld liegen, zeittypische Phänomene wie die von ihm identifizierten 4 Hauptbesorgnisse: + Sekuratismus (Sicherheitswahn) + Sanitarismus (Gesundheitskult) + Ökologismus (Naturvergötterung) + Paternalismus (Bevormundungsdrang) Sie lösen Ansprüche aus, die durch ihre Unerfüllbarkeit Stresssituationen und damit Überlastung und Reizbarkeit (s. o.) zur Folge haben. (Wie oft überschätzt der Mensch die Möglichkeiten, die Grundlage aller seiner Besorgnisse verschwinden lassen zu können, und wird daher - öfter, als es bei einer realistischen bzw. pragmatischeren Weltsicht der Fall wäre - enttäuscht.)
Als Suchtmittel verwendet werden v. a. folgende, z. T. ärztlich verschreibbare, durch ihre Nebenwirkungen gefährliche und (zumindest) psychische Abhängigkeit erzeugende Psychopharmaka: + Hypnotika: Barbiturate und andere, das Aktivierungssystem blockierende Schlafmittel = Sedativa, Analgetika (z. B. Epivan, Luminal, Veronal oder das in der Suchtszene verbreitete injizierbare Narkosemittel Ketamin, das - ähnlich wie das Hustenmittel Dextromethorphan - einen dissoziativen, realitätsverändernden Zustand bewirkt). Auch das Anästhetikum Lachgas (Distickstoffmonoxid N20) wird aufgrund leichter Verfügbarkeit von Jugendlichen als Partydroge verwendet. Durch die Unterbrechung des Vitamin B12-Stoffwechsels kommt es dadurch bei häufigem Konsum zu Auswirkungen auf das ZNS, die neurologische Schäden und motorische Beeinträchtigungen nach sich ziehen, sodass 2024 ein europaweites Vertriebsverbot diskutiert wurde. + Tranquilizer: durch rasche Toleranzbildung zu starker Abhängigkeit führende Beruhigungsmittel, „Downer“ mit angst- und spannungslösender = anxiolytischer Wirkung (ohne stimmungsaufhellenden Effekt); z. B. Meprobamat - 1950 synthetisiert -, Valium, Equanil, Librium. Wirkstoff: Benzodiazepin + Neuroleptika: dämpfen das ZNS, vermindern Aktivierung und Aufmerksamkeit („Chemische Zwangsjacke“) (= desaktivierende Psychopharmaka) + Stimulantia: Aufputschmittel, die Schlaf und Hunger unterdrücken; am häufigsten konsumierte Pharmaka; Weckamine, Psychotonica; auch das in Kaffeebohnen und Teeblättern enthaltene Koffein und der Kakaobestandteil Theobromin stimulieren. Sie scheinen aber gleichzeitig die funktionelle Konnektivität, also das Zusammenspiel einzelner Hirnregionen, im Ruhezustand zu senken. + Antidepressiva: stimmungsaufhellend (Thymoleptica) oder hemmungslösend (Thymerethica) + Amphetamine: nach dem Suchtgiftgesetz verbotene, synthetische Stoffe, die zu scheinbarer Leistungssteigerung, in Wahrheit aber zu unproduktiver Geschäftigkeit, Reizbarkeit, Unruhe und Misstrauen führen. Sie bewirken starke psychische Abhängigkeit. Beispiel: Captagon; als Derivat existiert das euphorisierende und stimulierende MDMA (Methylendioxymethylamphetamin; es führt zur Ausschüttung von körpereigenem Serotonin im Gehirn, das dann die Rezeptoren stimuliert. Als (im Labor erzeugte) Designerdroge Ecstasy wurde es vom „Godfather of Ecstasy“, dem Chemiker Alexander Shulgin (1925-2014) populär gemacht; vgl. dazu folgende Review. (Das Patent für die erste Synthetisierung von MDMA, das Anton Köllisch, 1888-Kriegstod 1916, als Vorstufe für den Blutstiller Hydrastinin entwickelte, wurde bereits 1912 von Merck, der weltweit ältesten pharmazeutisch-chemischen Firma, - benannt nach nach Friedrich Jacob Merck, 1621-1678 - eingereicht.) In Österreich konsumiert etwa jeder 200.ste Amphetamine. (= aktivierende Psychopharmaka) + Psycholytica: haben psychotomimetische Wirkung, rufen also toxisch Halluzinationen und künstliche Psychosen hervor Die verarbeiteten Substanzen und Wirkstoffe sind häufig dieselben wie bei manchen illegalen Suchtgiften. Nur durch die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen (vgl. z. B. das Oxycodon, ein Opioid, das als Schmerzmittel in extremen Fällen verschrieben werden kann, obwohl es stark suchterregend ist) ergibt sich der terminologische Übergang zur |
||
| ° | Drogensucht: (vgl.
Drogenabhängigkeit,
UNO-DC) in Österreich seit 1966 beobachtet. (Davor war das
Problem fast ausschließlich auf die medizinischen und pharmazeutischen
Berufe bzw. die von diesen versorgten Personen beschränkt.) Vor 1919, als Österreich im Rahmen des
St.Germain-Vertrages die Drogenächtung mitunterschreiben musste, gab es
überhaupt keine gesetzlichen Beschränkungen. 1926 wurde das erste „Giftgesetz“
verabschiedet. Heute ist die Materie im 1951 entstandenen
Suchtgift-/mittelgesetz
(danach mehrfach novelliert) geregelt. + Probleme: Durch psychische und tw. physische Abhängigkeiten ergeben sich diverse medizinische und juristische Folgeprobleme. Durch Illegalität entsteht Beschaffungskriminalität und Subkultur; die Reinheit des jeweiligen Stoffes ist deshalb nicht gewährleistet. Die Besitzgrenzmengen (vgl. Suchtgift-Grenzmengenverordnung), die ein Vergehen vom Verbrechen trennen, betrugen 2020 in Österreich 3g (Heroin), 15g (Kokain), 20g (Cannabis) und 30g (Ecstasy). + Wirkung: Drogen docken oft an das Belohnungszentrum im Gehirn an und erzeugen dadurch eine starke Abhängigkeit, die oft mit der Zerstörung der eigenen Existenz (und der der Angehörigen) oder gar tödlich endet.
Folgende Suchtgifte werden konsumiert: + Cannabis: die am häufigsten (in manchen Personengruppen häufiger als Alkohol) verwendete und sichergestellte illegale Droge. (In Österreich rauchten 2007 geschätzte 70% aller Oberstufenschüler und 30% der Gesamtjahrgänge manchmal Cannabis. Während der Coronakrise 2020 stieg der Cannabiskonsum - wie der anderer Suchtmittel - aufgrund von Langeweile, mehr freier Zeit und tw. erhöhter psychischer Belastung etwas an. Insgesamt „kifften“ nach Schätzungen in Österreich 2024 etwa 6% der Gesamtbevölkerung und ca. 30% aller Unter-25-Jährigen regelmäßig.) Die Mischung der Blütenblätter der weiblichen Hanfpflanze mit Harz heißt Haschisch, das Gemisch aus getrockneten Blättern und Blütenständen Marihuana („Gras“). Es wird geraucht („Joint“), als Tee getrunken oder gegessen. Auch synthetisierte Cannabinoide mit dem Wirkstoff HHC sind in Österreich verboten. Wirkung: Alle „Aggregatzustände“ enthalten den psychoaktiven, psychische Abhängigkeit erzeugenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), der - wie die vom Körper selbst produzierten Endocannabinoide - an spezifische Rezeptoren des endocannabinoiden Systems im Gehirn andockt. (Körpereigene Substanzen werden also imitiert, um direkt Bewusstseinsveränderungen auszulösen.) Der THC-Anteil im Cannabis hat sich seit 1995 in 25 Jahren auf bis zu 35% mehr als verdreifacht - um 1970 betrug er noch unter 10%! -, unter Einfluss von Butan kann er auf bis zu 90% hochgezüchtet werden („BHO Butane Hash Oil“, „Wax“, „Shatter“). Der ebenfalls in der Hanfpflanze enthaltene Wirkstoff Cannabidiol (CBD) hat im Gegensatz zu THC keine berauschende, sondern nur eine entspannende Wirkung und unterliegt daher auch nicht dem Betäubungsmittelgesetz. In den Handel kommt Cannabis in Platten gepresst oder als Pulver in den Farben grün-braun-schwarz - je dunkler, desto harzreicher und wirksamer, daher ist das - allerdings oft „gestreckte“ - Haschisch 5 bis 10mal so wirksam wie das harzlose Marihuana. Cannabis (s. a. BBC-Seite) wirkt zunächst (nach ca. 20 Minuten) stimulierend, nach bis zu 4 Stunden sedierend. Langfristig gerät das Gehirn „außer Tritt“, der IQ sinkt nach Studien im Laufe der Jahre um bis zu 8 Punkte, wenn der Konsum bereits im jugendlichen Alter begonnen wird. Im medizinischen Bereich kann die Droge unter ärztlicher Aufsicht manchmal sinnvoll eingesetzt werden. Auch der Körper selbst produziert cannabisähnliche Substanzen (Endocannabinoide), die z. B. für das Langstreckenläufern bekannte Flow-Phänomen des Runner's High verantwortlich sind. Problem: Cannabis dient häufig als „Einstiegsdroge“ (wie auch Nikotin, Alkohol) und wird daher oftmals schon sehr früh von Jugendlichen konsumiert, deren noch im Umbau begriffenes ZNS vulnerabel ist, sodass langfristig Hirnschäden entstehen können. Cannabinoide (v. a. solche vom unkontrollierten Schwarzmarkt ohne Qualitätsnachweis) können psychische Probleme bis zu psychotischen Symptomen verursachen. (2019 waren in Österreich 15% aller stationär psychiatrisch Behandelten Cannabiskonsumenten.) Es besteht ein deutlich erhöhtes Schizophrenierisiko (s. hier). Eine unterschätzte Gefahr liegt im Konsum während der Schwangerschaft, die (zumindest) einen erhöhten Cortisolspiegel im Kind und die Beeinträchtigung seines Immunsystems zur Folge hat. Als mögliche Folgen wurden 2021 in einer Studie des New Yorker Mount Sinai Hospitals Ängstlichkeit und/oder Aggressivität und/oder Hyperaktivität angegeben. Weltweit besteht eine leichte Tendenz zur Legalisierung (zunächst für medizinische Zwecke) oder zumindest zur Entkriminalisierung von Cannabis, wodurch die Zugänglichkeit (auch für Pubertierende und Adoleszente) stark ansteigt. (2013 wurde z. B. in Uruguay Handel und Produktion von Marihuana erlaubt und tw. vom Staat organisiert. Einige Bundesstaaten der USA und Kanada haben nachgezogen, in Deutschland, dessen Drogenkriminalität zu diesem Zeitpunkt zu 50% aus Cannabisdelikten bestand, legalisierte diese Droge 2024 unter gewissen Auflagen: erlaubt wurden der Besitz von bis zu 3 Hanfplanzen, 25g Cannabis außer Haus und 50g zuhause. In Österreich sind Besitz, Verkauf, Anbau und Konsum von THC-haltigem Cannabis verboten, wenn auch geringe Eigenbedarfsmengen toleriert werden.) + Opiate: In Österreich 2007 ca. 10 000 Konsumenten (2019 geschätzt 28 000 Abhängige, 2020 35 000, über 50% in Substitutionsbehandlung). Ausgangsprodukt ist der getrocknete Milchsaft des Schlafmohns, aus dem Rohopium (enthält Morphin, das auch isoliert in den Handel kommt, Codein, Narkotin, Papaverin und andere Alkaloide, in Kugel- oder Laibform im Handel) gewonnen wird. Opium wird durch Kochen oder Gärung erzeugt und geraucht oder gegessen. Halbsynthetisch werden die Morphinbase (hellbraunes, aus Rohopium extrahiertes Pulver, das injiziert wird) und aus ihr auf chemischem Wege das Heroin (Diazethylmorphin C21H23NO5) hergestellt. (Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 war man bestrebt, ein dem Morphin gleichwertiges Analgeticum, das aber nicht suchterregend wirkt, herzustellen. Ironischerweise führte dies zum Suchtgeschäft des Jahrhunderts. Als Erfinder gilt wie bei der Acetylsalicylsäure = Aspirin - vgl. Plakat vor dem US-Verbot von Heroin 1924 - der deutsche pharmazeutische Chemiker Felix Hoffmann, 1868-1946). Heroin ist je nach Reinheitsgrad weiß bis braun und schmeckt bitter. In den Handel kommt es oft gestreckt und wegen der Feuchtigkeit in Folien verpackt. Heroin ist zur Zeit die gefährlichste harte Droge. In der Medizin wird Opium als schmerzstillendes Mittel und das Codein, das ebenfalls von Süchtigen konsumiert wird („Wiener Mischung“ = Hustensaft mit Alkohol) z. B. in Hustensäften verwendet. Gefahr: Die Abhängigkeit kann sehr rasch eintreten, die Rückfallquote ist hoch, die Begleitkrankheiten (Obstipation = Verstopfung, Nieren-, Leberleiden etc.) entkräften den Körper, der bei Fehlen von Heroin (engl. „H“) stark reagiert („Turkey“). Das mit den „Fixerutensilien“ erhitzte und gelöste Gift wird nach Abbinden der Venen injiziert, wobei die tödliche Dosis oft überschritten wird („Goldener Schuss“). Wirkung aller Opiate (die schon im alten Ägypten verwendet worden sein sollen): sedierend, entspannend, Apathie erzeugend. + Kokain (Benzoylecgoninmethylester; „Schnee“, „Koks“, „Cola“; der Name „Kokain“ für ein Alkaloid der Cocapflanze wurde 1860 vom Chemiker Albert Niemann, 1834-1861, geprägt): Kokain entsteht als Extrakt der Blätter des aus Südamerika stammenden Cocastrauches (das z. B. Ende des 20. Jhdts. von der Drogenmafia von Medellin oder dem Cali-Kartell distribuiert wurde). Es wurde ursprünglich zur Unterdrückung des Hungergefühls gekaut und wird heute als „Schickeriadroge“ als weißes, bitter schmeckendes und lokalanästhetisch wirksames Pulver geschnupft, als Crack geraucht oder in einer alkoholischen Lösung injiziert. In Österreich konsumieren ca. 4% der Bevölkerung - seit 2015 stark ansteigend - manchmal Kokain, 1,5% regelmäßig. 2022 war Kokain bei 20% der Suchterstbehandelten die Leitdroge. Wirkung: Kokain (gehört zu den Stimulantien) greift in den Neurotransmitterhaushalt ein, indem es die Dopamin-Produktion steigert. Es betäubt die Ganglien, putscht auf, führt zu scheinbarer Leistungssteigerung, enthemmt, ruft auch Halluzinationen und Juckreiz hervor und schränkt die Selbstkritik ein. Es erzeugt keine physische, aber eine sehr starke psychische Abhängigkeit. + Halluzinogene: Substanzen, die Sinneseindrücke verändern, sind z. B. Mescalin (Spitzen des Peyotlkaktus werden, schon seit der Inka-Zeit, gekaut; in den KZs Auschwitz und Dachau wurden damit Menschenversuche durchgeführt; auch der Schriftstellers Aldous Huxley, 1894-1963, nahm 1953 an Mescalin-Experimenten teil und prägte danach das Wort „psychodelisch“ = den Bewusstseinszustand verändernd), Psilocybin (aus mittelamerikanischen Pilzen gewonnen), DOM (STP, DMT = synthetisch erzeugte Mescalinableger) oder das starke, nach Forschungen am Claviceps purpurea (= „Mutterkornpilz“, da er zur Auslösung von Wehen eingesetzt wurde; wächst - hochgiftig - aus Getreideähren hervor und verursachte im Mittelalter Ergotismus-/Antoniusfeuerepidemien) synthetisierte und in den USA (nach starken Einschränkungen ab 1966) 1970, in Österreich erst 1971 verbotene LSD (Lysergsäurediäthylamid 25, da es die 25. Substanz von Hofmanns Versuchsreihe war; Summenformel C20H25N3O). Diese psychedelische Droge auf der Basis toxischer Alkaloide wurde zum ersten Mal 1938 bei Sandoz (benannt nach Edouard-Constant Sandoz, 1853-1928) in Basel vom Chemiker Albert Hofmann (1906-2008) hergestellt, der sie - dosiert mit 250 Mikrogramm (¼ Milligramm) - im Selbstversuch erprobte (was unwissentlich zum weltweit ersten LSD-Trip führte) und - ursprünglich unter dem Markennamen Delysid „zur seelischen Auflockerung“ - von Sandoz auf den Markt gebracht (später als Flüssigkeit, in Tablettenform oder als stecknadelgroße „Minitrips“ verkauft). Als Kreislaufmittel untauglich, geriet es in Vergessenheit und später in Verruf (was die medizinische Forschung erschwerte). Als Rauschmittel griff 1960 der „Drogenmessias“ Timothy Leary (1921-1996; Psychologie-Professor in Harvard; Slogan „Come on, tune in, turn on, drop out“) Psilocybin und LSD auf und praktizierte und propagierte deren Einnahme (was 1963 zu seiner Entlassung führte). Aufgrund von Aktenvernichtung wurde erst spät bekannt, dass in den USA der CIA im Anschluss an Nazi-Versuche (s. o.) bereits ab 1953 im berüchtigten M-K-ULTRA-Experiment Tausenden Bürgern mit dem (nicht erreichten) Ziel der Bewusstseinssteuerung (z. B. mit dem Zweck, Verhöre besser kontrollieren zu können und nach der „Löschung“ der alten Bewusstseinsinhalte erwünschte Antworten zu bekommen) ohne deren Wissen u. a. LSD verabreichte. An den damaligen Drogenexperimenten freiwillig teilgenommen haben u. a. der Schriftsteller Ken Kesey (1935-2001; 1962 Autor von One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975 verfilmt - s. u. - von Miloš, eig. Jan Tomáš, Formann, 1932-2018) und die von ihm angeheuerte Popgruppe Grateful Dead. Wirkung und Gefahr: Die Droge dockt im Unterschied zu MDMA (s. o.) direkt am Serotonin-2A-Rezeptor an und stimuliert das Feuern der darunter sitzenden Nervenzellen. Dadurch wird die Informationsübertragung im gesamten Gehirn verändert (z. B. die Filterfunktion des Thalamus geschwächt). Es kommt zu unberechenbaren Veränderungen der sensorischen Wahrnehmung, auch Trugwahrnehmungen, die im Falle eines „Horror Trips“ letal enden können (etwa, weil man glaubt, fliegen zu können). LSD wird daher meist (nicht gleichzeitig) in Gruppen genommen. Gehirnareale, die Inhalte verknüpfen und Sinn destillieren, scheinen „freier“ agieren zu können, was eventuell die oft berichtete gesteigerte Kreativität erklärt. (Vgl. den bewussten Einsatz von psychedelischen Drogen durch zahlreiche Künstler wie den mit Hofmann korrespondierenden deutschen Schriftsteller Ernst Jünger, 1895-1998, den östrreichischen Maler Arnulf Rainer, 1928-2025, die Beatles, die Rolling Stones, Pink Floyd, John Allan / James Marshall „Jimi“ Hendrix, 1942-1970 und viele andere. Die Frage ist dabei allerdings, ob durch diese Methode nicht etwas evoziert wird, was ohnehin latent vorhanden war.) Unter gewissen Umständen kann unter ärztlicher Aufsicht die Gabe von ca. 100 Mikrogramm LSD therapeutische Wirkungen erzielen. Es entsteht dabei (wie auch sonst) keine physische, aber möglicherweise eine starke psychische Abhängigkeit. + Synthetische Drogen (= sog. Designerdrogen; inzwischen tw. häufiger konsumiert als Drogen pflanzlichen Ursprungs): Da in den USA Drogen im Gesetz taxativ aufgezählt werden, besteht ein Interesse der Suchtgifthändler, immer neue Drogen, die dann kurze Zeit „legal“ sind, zu entwickeln, in den letzten Jahr(zehnt)en v. a. Fentanyl (ein synthetisch hergestelltes Opioid mit starker analgetischer Wirkung), Speedball, eine Heroin-Kokain-Mischung, Crack, ein speziell zubereitetes und billiges Kokain, das mit Tabak gemischt geraucht wird, DOM, die „Partydrogen“ Ecstasy (beide s. o.) und MDMA (das zur Gruppe der Methylendioxyamphetamine gehört), Ice, Crystal Meth, das chemisch dem seit den 30er-Jahren des 20. Jhdts. verbreiteten Methamphetaminhydrochlorid „Pervitin“ entspricht (wurde z. B. von der deutschen Wehrmacht, 1953 von Hermann Buhl, 1924-1957, bei seiner Nanga-Parbat-Erstbesteigung und gerüchteweise 1954 von der deutschen Fußballnationalmannschaft - s. hier: 1 oder 2 - verwendet), usw. (Zu Neuroenhancement-Präperaten s. o.) |
||
| ° | Weitere
Süchte (die ersten vier sind die wichtigsten
Verhaltenssüchte): + Workaholism: Unter Workaholics (= Kunstwort aus work und alcoholic) versteht man Menschen, die hektisches Angetriebensein kennzeichnet. Gefahr: Erschöpfen der physischen Reserven, z. B. durch Schlafentzug, psychosomatische Auswirkungen, z. B. Magengeschwüre. Interpretation: Kann durch Sublimation oder (Todes)verdrängung (es bleibt keine Zeit mehr, bei sich zu sein bzw. sich der Begrenztheit des Daseins oder zumindest eigener Lebensprobleme bewusst zu werden) erklärt werden. + Spielsucht: Der pathologische Zwang, Glückspiel zu betreiben (Casino, „einarmiger Bandit“, Onlinezocken, Wetten etc.), ist in Österreich gesetzlich als Abhängigkeit anerkannt. (Es gibt hier ca. 60 000 - überproportional häufig männliche - massiv Abhängige, die Anzahl aller Personen mit problematischem Glückspielverhalten beläuft sich ansteigend seit 2023 auf 300 000.) Gefahr: Zerstörung der Existenz durch hemmungslose Verschuldung, in weiterer Folge ev. Kriminalität. (Durch unvorsichtig-naive Übernahme von Bürgschaften ist auch die Existenz anderer - meist Ehepartnerinnen und Freunde - in Gefahr.) Spielsucht ist die wichtigste substanzungebundene Sucht (vgl. Fragebogen zur Spielsucht, Spielsuchthilfe). + Onlinesucht: Kaum Zahlen verfügbar, hat aber in Österreich in den letzten Jahr(zehnt)en um Zehntausende zugenommen, sodass man mit bis zu 100 000 Abhängigen rechnet. Jugendliche (aber nicht nur sie) bringen es auf tw. unglaubliche online verbrachte Stundenanzahlen pro Tag. Das Problem entsteht oft schon in der Kindheit, da viele Eltern glauben, ihren Nachwuchs durch Zur-Verfügung-Stellung von Tablets oder Smartphones auf die digitale Welt rechtzeitig vorbereiten zu müssen. (Manfred Spitzer meint dazu, dass man ja auch nicht im Kindergarten Bier ausschenken würde, damit die Kinder später besser mit Alkohol umgehen können.) Vgl. onlinesucht.de und Fragebogen-Selbsttest; die Startseite bietet Jugendlichen zahllose Informationen zu weiteren Problemfeldern. + Kaufsucht: eine auch Oniomanie genannte Impulskontrollstörung, deren Sinnlosigkeit im Unterschied zum Konsumismus den Betroffenen klar ist. Nach einer Studie der Arbeiterkammer Wien (2017) sind rund 13% der Bevölkerung kaufsuchtgefährdet und 11% kaufsüchtig, v. a. jüngere Frauen. + Essstörungen: Eine der häufigsten Essstörungen ist die Anorexia nervosa (Magersucht), die v. a. in der Pubertät (nicht nur) bei Mädchen auftritt und als psychogene Nahrungsverweigerung mit dem Zwang, das Gewicht dauernd kontrollieren zu müssen, erscheint. Sie tritt gekoppelt mit Amenorrhoe oder überhaupt dem Ausbleiben der Menarche und häufig in Verbindung mit Perfektionismus und/oder Bulimie (dem zwanghaften Erbrechen nach jedem Essen) auf. Den Hintergrund scheint eine unbewusste Ablehnung der Geschlechterrolle zu bilden. 4mal häufiger ist der große „Ochsenhunger“ (Binge-Eating-Störung). Adipositas (Fettsucht) besteht demgegenüber in überhöhter Energiezufuhr mittels Nahrung (in Österreich sind 30% der Kinder von Esssucht - tw. mit Adipositas - betroffen) und ist eine auch in späterem Alter vorkommende noch häufigere Essstörung. 2019 überwog weltweit erstmals in der Geschichte der Menschheit die Zahl der Übergewichtigen die der Untergewichtigen bzw. Hungernden. (Laut UNICEF sank der Prozentsatz unterernährter Kinder zwischen 2000 und 2025 von 13% auf 9,2%, die der fettleibigen stieg von 3% auf 9,3%, in Österreich von 6% auf 11%. In Chile, den USA und den VAE waren 2025 mehr als 20% aller Kinder adipös.) Vgl. Seite über Magersuchtgenetik (Der Standard bzw. Originalstudie), Magersucht mit BMI-Berechnung, Essstörungen, BFE, Essstörungen (Stadt Wien) und folgende Kurzinformation + Sniffen: Schnüffeln von alltäglichen Essenzen, wie z. B. Klebestoffe, Fleckputzmittel, Benzin etc., die als (nicht unter das Suchtgiftgesetz fallende) Suchtersatzmittel verwendet werden. + Andere Süchte: Sucht nach „Badesalzen“ (synthetische Cathinone, die ähnlich der arabischen bzw. ostafrikanischen Khatpflanze stimulieren und Halluzinationen und Wahnvorstellungen auslösen können), nach Sex (Hypersexualität; vgl. hier), nach der Betelnuss (v. a. in Ostafrika und Asien), nach SVV (s. u.), nach Süßigkeiten (v. a. Schokolade; aus mexikanisch „Xocolatl“, enthält Theobromin!, s. o.; vgl. folgende Seite. Die Schokoladensucht ist die häufigste Sucht nach einem Nahrungsmittel - vgl. den engl. Ausdruck „Chocoholic“ -, eine echte Abhängigkeit wird allerdings nicht angenommen, da die Reduktion des Konsums keine komplexen Maßnahmen erfordert) usw. |
-
Neurosen:
Der Begriff (gr. νεῦρον / Neuron = Nerv) wurde vom schottischen Arzt William
Cullen (1710-1790) geprägt (im §
1019 von First Lines in the Practice of Physics, 1776-84). Bis ins
20. Jhdt.
wurde damit jede nicht erklärbare Krankheit bezeichnet (z. B. auch Epilepsie).
Die heutige Bedeutung des Wortes geht auf Freud
(s. u.)
zurück. In diesem Abschnitt sind auch einige Persönlichkeitsstörungen enthalten.
* Definition: Eine Neurose liegt dann vor, wenn ohne entsprechenden Anlass willentlich unbeeinflussbare Zustände, Verhaltensweisen oder vegetative Veränderungen von solcher Stärke auftreten, dass dadurch die Ordnung des psychischen und physischen Geschehens gestört wird. Neurosen bilden etwa zwei Drittel aller psychiatrischen Störungen. Man schätzt, dass mindestens 20% der Bevölkerung zumindest einmal im Leben darunter leiden.
Krankheitsanzeichen:
| ° | Physische Symptome: ähnlich denen des Affekts (s. u.). Es können Tachykardie, Hyperventilation, Schweißausbrüche, Kreislaufbeschleunigung, Verdauungsprobleme, Überaktivität des Neurotransmitters Norepinephrin etc. auftreten. |
| ° | Psychische Symptome: Angstbesetztheit, Zwanghaftigkeit. Neurosen werden als aufdringlich, quälend, störend empfunden. |
* Angstneurose: Im Prinzip ist (die nichtneurotische) Angst als normalpsychologisches Phänomen ein Schutzmechanismus, der letztlich durch Gefahrenvermeidung zu einem Sicherheitsgefühl führt. Sie ist eine Stressreaktion des Gehirns im Dienste des Überlebens und Lernens. Physiologisch wird Angst von den Amygdalae (Teilen des rechten bzw. linken Temporallappens, deren Läsion zu einem völligen Verschwinden jeglicher Furcht führen kann) innerhalb von 12 Millisekunden eingeleitet und gesteuert, vom medialen präfrontalen Cortex gebremst. Physische Korrelate betreffen u. a. Blutdruck, Atmung und Herzfrequenz. Indem sie in einen Zustand der Alarmbereitschaft versetzt, ermöglicht sie rasch weitere Reaktionen. Wird sie im Hinblick auf den Anlass zu stark oder zu lang und damit übermächtig, schränkt sie die Freiheitsgrade der betroffenen Person ein, übernimmt die Verhaltenssteuerung und wird neurotisch. Aus der gesunden Anspannung wird eine Vermeidungsreaktion, die in einer unerklärlichen, unkontrollierbaren, unverhältnismäßigen, unspezifischen Erregung besteht, der keine äußere Gefahr mehr entspricht („generalisierte Angst“, „frei flottierend“) und die auch plötzlich - als Panikattacke - auftreten oder Teil einer Depression (s. u.) sein kann.
Frauen sind doppelt so
oft von Angststörungen betroffen wie Männer, 18- bis 44-Jährige doppelt so
häufig wie Über-60-Jährige (s. z. B.
hier). Sowohl übertriebene Angst wie auch
Angstfreiheit (z. B. bei „Adrenalinjunkies“ und „sensation seekers“, die
durch ihre Aktionen sich
und oft - direkt oder indirekt - auch andere gefährden, sodass man vor Menschen ohne Angst Angst haben
sollte) sind evolutionär ungünstig, da die
Entscheidung „fight or flight“, also für Kampf (Aggression) oder Flucht (Rückzug), nicht mehr situationsadäquat getroffen werden
kann und tw. Erstarrung (die als „Totstellreflex“ manchmal auch
zielführend sein kann) eintritt. Die rationale Beurteilung einer Situation hinkt
den physiologischen Reaktionen immer hinterher. Als einziges Lebewesen ruft der
Mensch freiwillig Angstzustände hervor (vgl. etwa Trails of Screams oder Haunted
Houses zu Halloween).
Vgl. a.
Seite über Angsterkrankungen,
Fragebogen 1,
2.
Insgesamt sind nach Schätzungen mindestens 15% aller psychischen Störungen Angststörungen. Nach Fritz Riemann (1902-1979; publiziert 1961) entstehen alle Ängste (diese Ängste müssen nicht zwangsläufig pathologisch sein, schließlich ist Angst an sich eine natürliche und nützliche Reaktion auf Bedrohungen) aus der Widersprüchlichkeit menschlicher Grundbedürfnisse, die sich in den beiden Antinomien Individuation vs. Hingabe und Beständigkeit vs. Wandel zeigt. Daraus erwachsen
4 Grundformen der Angst:
| ° | Angst vor Selbsthingabe (schizoider Mensch, der Distanz halten muss) |
| ° | Angst vor Selbstwerdung (depressiver Mensch, der unter Trennungs- und Verlustängsten leidet) |
| ° | Angst vor Wandlung (zwanghafter Mensch, der Chaos und Veränderung schwer erträgt) |
| ° | Angst vor Notwendigkeit (hysterischer Mensch, der Bindung und Verantwortung scheut) |
Andere halten Ungewissheit, Verlust, Gefahr und
Vereinzelung für die Wurzeln der Angst. Die zehn häufigsten Ängste der Österreicher
nach einer Umfrage aus dem Jahr 2001 waren die vor unheilbarer Krankheit
(90%), die Sorge um die Zukunft der Kinder (68%), die Angst vor einem
Verkehrsunfall (66%), vor Arbeitslosigkeit (66%), vor AIDS (59%), vor einem
Reaktorunglück (57%), vor einem Weltkrieg (56%), vor Partnerschaftsproblemen
(53%), vor dem finanziellen Ruin (52%). An zehnter Stelle steht mit 49% die
Angst, dem Wahnsinn zu verfallen, die die größte Steigerung (+21%) gemessen an
Umfragen von 1997 aufweist. Eine Untersuchung der Frage Was bereitet den Österreichern Ängste und Sorgen
im Jahr 2017? ergab Folgendes: Arbeitslosigkeit 82%, Ausländerzuzug 71%,
gesicherte Zukunft der Kinder 67%, Terrorismus 61%, Einbruch, Diebstahl 59%,
Pflegefall im Alter zu sein 59%, Naturkatastrophen 58%, schwere Erkrankung 57%,
Krieg 50%, Erhaltung des Lebensstandards im Alter 50%. 2024
ergab die Ipsos-Umfrage What Worries the World (s. hier;
zu beachten ist dabei, dass die Begriffe „Angst“ und „Sorge“ nicht
deckungsgleich sind) diese Rangliste: Einwanderung (43%), Kriminalität (34%),
Gesundheitswesen (32%), Inflation (26%; 2023 Top 1), Klimawandel (20%), Armut
bzw. soziale Ungleichheit (20%), moralischer Verfall der Gesellschaft (17%),
Terrorismus (15%), Steuern (14%) und Korruption (12%).
Zur Entwicklung vgl. a. folgendes
Video, zu Phobien
hier
Angstreaktionen funktionieren abgekoppelt von Rationalität, also auch ohne sachliche Grundlage bei vernachlässigbar geringer Gefahr - z. B. Angst vor Hühnern, Angst vor Flugzeugabstürzen (die Zahl derer, die nach den Anschlägen von 9/11 aus Angst vor dem Fliegen das Auto benutzten und als Verkehrstote endeten, wurde vom Risikoforscher Gerd Gigerenzer, *1947; s. a. o., mit 1600 errechnet und lag damit 6mal höher als die Anzahl derer, die in den Flugzeugen der Terroristen gestorben sind; die vielen tausend Personen, die doch geflogen sind, überlebten - bis auf die 260 bei Flug AA 587 am 12. 11. 2001 in New York durch Abriss des Seitenleitwerks abgestürzten, darunter eine 9/11-Überlebende - alle), Angst, in Österreich Opfer von Terror zu werden, oder Angst vor Impfschäden (obwohl diese um Potenzen unwahrscheinlicher sind, als das Auftreten von Schäden jener Krankheit, die verhindert werden soll), Angst davor, mit einer Waffe getötet zu werden (die Anschaffung einer Waffe, um für diese Bedrohung gerüstet zu sein, erhöht in Wahrheit das Risiko beträchtlich: die Wahrscheinlichkeit, dass im Haushalt jemand durch die eigene Waffe ums Leben gebracht wird, steigt nun an). Aufgrund der kognitiven Undurchdringlichkeit können Angstreaktionen auch dann auftreten, wenn man rational um die Ungefährlichkeit der Situation weiß.
Eine der Ursachen dieses Phänomens liegt in der überproportionalen Häufigkeit von Medienberichten über die erwähnten Ereignisse, die Bilder und Gedanken in den Kopf setzen, die manche Menschen nicht mehr beherrschen können (vgl. a. o. Verfügbarkeitsheuristik). Bei weit höherer Wahrscheinlichkeit, Schaden zu erleiden, bleiben Angstreaktionen meist aus (z. B. hat kaum jemand Angst, ins Auto einzusteigen, um zum Flughafen zu fahren, Raucher und übergewichtige Personen verfallen nicht in Panik angesichts drohender Herzinfarkte). Ob einzelne Ängste angeboren sind, ist umstritten. Neuropsychologisch sind, wie oben erwähnt, die Amygdalae (die Mandelkerne; s. o.) für Ängste verantwortlich.
Der Wirtschaftswissenschaftler Frank Knight (1885-1972; Mitbegründer der Chicagoer Schule der Ökonomie) hat drei Angst auslösende Gefahrenbereiche unterschieden: Unsicherheiten (unkonkrete Situationen der Ungewissheit bzw. der Unwissenheit, die eine noch nicht eindeutig definierbare Zukunft erwarten lassen; z. B. Berufswechsel), Bedrohungen (konkrete, potentiell negative Ereignisse; z. B. Wirtschaftskrisen, Krankheiten) und Risiken (mit potentiell möglicher, wenn auch nicht immer einfacher mathematischer Folgenabschätzung aufgrund von Basisinformationen; z. B. Geld im Roulettespiel zu setzen, im Flugzeug zu reisen).
* Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS; engl. Posttraumatic Stress Disorder PTSD; s. a. International Network for Interdisciplinary Research about the Impact of Traumatic Experience on the Life of Individuals and Society): Im 1. Weltkrieg noch aufgrund unzulänglicher Zuschreibungen als „Granatenschock“ bezeichnet (man nahm die Explosionsstoßwellen als ursächlich an), wurde die PTBS im Zusammenhang mit den psychischen Problem der Vietnamkrieg-Rückkehrer 1980 das erste Mal beschrieben und 1992 von der WHO in die ICD aufgenommen. Das Zustandsbild entsteht nach dem Durchleben von Gefahrensituationen (z. B. Naturkatastrophen, Kriegen, Unfällen, anderen Gewalterfahrungen etc.), denen man ausweglos ausgeliefert war und die durch bestimmte Trigger (Gerüche, Geräusche, bestimmte Situationen) wieder aufflammen können, dauert über die vierte Woche nach dem Ereignis hinaus an und zeigt - neben allgemeiner psychischer Labilität - folgende spezifische
Symptome:
| ° | Zwanghaftes inneres Wiederholen des durchlebten Traumas (Nachhallerinnerungen), manchmal mit Suizidimpulsen. Das unerwünschte, oft durch einen Schlüsselreiz getriggerte Wiedererleben bzw. die damit zusammenhängenden Gedanken und sich aufdrängenden Erinnerungen nennt man Intrusion, nimmt sie ein Ausmaß an, das das Erleben von einem realen Erleben nicht mehr unterscheiden lässt, spricht man von Flashbacks. |
| ° | Chronische Angst, Schreckhaftigkeit, Meiden der angstauslösenden Situation (des Ortes, der Tätigkeit etc.), um Retraumatisierung zu verhindern |
| ° | Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Albträume, gefühlsmäßige und soziale Abstumpfung, Freudlosigkeit, Depressivität oder erhöhte Reizbarkeit |
Akute Belastungsstörungen (bis zu vier Wochen anhaltende Psychotraumata) treten als Sofortreaktion (Begleiterscheinung: Speechless Terror / Sprachloses Entsetzen) auf traumatisierende Erlebnisse auf. (Möglichkeit zur Prophylaxe: Einsatz von Psychologen; vgl. u. Krisenintervention, Seiten über Notfallpsychologie, Traumatisierte Migrantinnen oder eine Diplomarbeit über traumatisierte Flüchtlinge). Ein seit der Befreiung der KZs der NS-Zeit bekanntes (von William G. Niederland, 1904-1993 beschriebenes) Phänomen ist das Überlebensschuldsyndrom (Survival Guilt), bei dem sich davongekommene Opfer einer Katastrophe gegenüber ihren toten Freunden, Angehörigen oder Kollegen ohne rationalen Grund schuldig fühlen. Indirekte Belastungsstörungen (z. B. durch Beobachtung von Gewalt) nennt man sekundäre Traumatisierungen.
Der Neurologe und Gedächtnisforscher Scott A. Small (*1963?; Eigendefinition: „Hirnmechaniker“) definiert PTBS als „ein Gehirn, das durch viel zu viele Erinnerungen in Flammen steht“. Soziale Kontakte seien in der Lage, das Angstgedächtnis herunterzukühlen. (Zu spezifischen Traumatherapien s. u.)
* OCD (Obsessive-compulsive Disorder): Darunter versteht man Zwangsstörungen, die in der Folge in einem eigenen Abschnitt behandelt werden (s. u.). Hier werden sie deshalb erwähnt, da die meisten Denk- und Verhaltensweisen bei Zwangsstörungen mit Ängsten über Gefahren und Risiken zusammenhängen. Automatisch ablaufende Gedanken erzeugen periodisch oder permanent Angstzustände.
* Phobie: Phobien (nach Φόβος, dem griechischen Gott der Angst) sind objekt- oder situationsbezogene, also gerichtete Ängste. Sie erscheinen auf Deutsch terminologisch manchmal als „Furcht“ und haben oft reale Ursachen - es kann z. B. sehr sinnvoll bis lebensrettend sein, Höhe als Gefahr zu identifizieren - überschreiten aber dann den Anlass und sind manchmal auch völlig irrational. Der Ausdruck „Phobie“ wurde im heutigen Sinn vom „Vater der amerikanischen Psychiatrie“, dem amerikanischen Arzt, Sklaverei- und Todesstrafengegner Benjamin Rush (1745-1813) geprägt. (Er verwendete auch den Begriff Manie zum ersten Mal im heutigen Sinn und beschrieb vor allen anderen die Sucht als Krankheitsform, den Zusammenhang von Zahnproblemen mit anderen Krankheiten und das Dengue-Fieber. Dies alles brachte ihm eine Gletscherbenennung auf der antarktischen Brabantinsel ein.)
Man unterscheidet soziale Phobien, die gut behandelbaren spezifischen Phobien, die in Tier-, Umwelt und Verletzungsphobien unterteilt werden, und situative Phobien aller Art. Sie alle bewirken zunächst meist Meidungsverhalten, danach (bei erhöhtem Leidensdruck) im besten Fall den Gang zur Therapie.
Einige bekannte Phobien:
| ° | Agoraphobie oder Platzangst: die Angst davor, alleine auf weitem Plan stehen zu müssen (oft fälschlich mit Klaustrophobie, s. u., verwechselt) |
| ° | Akrophobie: Höhenangst |
| ° | Astraphobie: Angst vor Gewittern |
| ° | Klaustrophobie: Angst vor zuwenig Platz, z. B. Sitzplatz ohne Fluchtmöglichkeit |
| ° | Aichmophobie: Angst vor spitzen Gegenständen |
| ° | Arachnophobie: Angst vor Spinnen (oder Insekten allgemein) |
| ° | Aviophobie: Angst vor dem Fliegen |
| ° | Bakterien-, Virenphobie |
| ° | Coulrophobie: Angst vor Clowns |
| ° | Emetophobie: Angst vor dem Erbrechen |
| ° | Erethophobie: Angst, zu erröten |
| ° | Mysophobie: Angst vor Keimen und Ansteckung mit Kontaktvermeidungsverhalten |
| ° | Nomophobie: Angst, ohne Mobiltelephon zu sein („NO MObile“) |
| ° | Nosophobie: Angst vor Krankheiten |
| ° | Phobie vor abstrakten Dingen und Symbolischem (vgl. Totem, Tabu) |
| ° | Phobie vor radioaktivem Material |
| ° | Phobophobie: Angst davor, Angst zu bekommen und dieser Situation hilflos ausgeliefert zu sein |
| ° | Prüfungsangst (vgl. Fragebogen): Jede Nervosität aktiviert auch und ist daher zunächst positiv. Überschreitet sie jedoch ein gewisses Level, hemmt sie und kann durch inkompatibles Verhalten (s. u.) oder Entspannungsübungen (bewusstes Anspannen - Entspannen des Körpers von oben nach unten im Wechsel) bekämpft werden. (Die beste Prophylaxe ist eine seriöse Vorbereitung.) |
| ° | Schlangenphobie |
| ° | Soziale Phobie: z. B. Xenophobie (Angst vor Fremden/m) oder Angst vor Öffentlichkeit, pathologische Schüchternheit, ev. gepaart mit selektivem Mutismus, also situationalem Stumm-Bleiben |
| ° | Taphephobie: Angst vor dem Lebendig-Begraben-Werden |
| ° | Tokophobie: Angst vor Schwangerschaft und Geburt |
| ° | Trypanophobie: Angst vor Spritzen (griech. τρύπανον = Bohrer; vgl. o.) |
| ... u. v. a. m. (Angst vor dem Zahnarzt, vor bestimmten Zahlen etc.) Auch Ekelphänomene werden manchmal als Phobie bezeichnet: Trypophobie (Ekel vor Lochmustern), Bambakomallophobie (Ekel vor Watte) etc. |
* Zwangsneurosen (Anankasmen; vgl. www.zwaenge.de und Fragebogen): Zwangsneurosen erscheinen in
2 Formen:
| ° | Zwangshandlungen: z. B. Zwang, Servietten zu beschriften, (die Wohnungstür) zu kontrollieren; Zwang zu lästern, zu zählen (Arithomanie), zu tanzen (Choreomanie), zu putzen, zu ordnen, Kugeln aus Käserinde oder Kerzenwachs zu formen, herumzuirren (Dromomanie) und vieles mehr. Stärkere (und v. a. selbst und andere schädigendere) Phänomene sind der Zwang, Feuer (Urelement, Symbol der Leidenschaft) zu legen (Pyromanie), zu stehlen (Kleptomanie), sich Männern bzw. Frauen an den Hals zu werfen (Nymphomanie bzw. Satyriasis); sie werden oft nur als sich aufdrängende Handlungsimpulse erlebt, deren Ablauf bei Ausführung der Handlungen ähnlich einem Orgasmus über einen Höhepunkt zur Depression führt (vgl. das oft Aristoteles, der mit „philosophus“ gemeint ist, zugeschriebene Zitat von Johannes Murmellius, 1480-1517: „Nam, teste, philosopho, omne animal a coitu triste est“). |
| Oft sind Zwangshandlungen (die trotz manchmal identischer Bezeichnung nicht mit einer psychotischen Manie - s. u. - verwechselt werden dürfen) nahe einer Verhaltenssucht (s. o.). Sie sind komplexer als Tics (die jedoch nicht mit dem genetisch bedingten, meist vor dem 18. Lebensjahr auftretenden Tourette-Syndrom - nach Georges Albert Édouard Brutus Gilles de la Tourette, 1857-1904; vgl. auch Tourette-HP, Tourette-Forschung -, bei dem Echolalie, Echopraxie, Koprolalie und motorische und vokale Tics gleichzeitig auftreten, verwechselt werden dürfen). | |
| ° | Zwangsgedanken (bzw. Zwangsvorstellungen): perseverierende Vorstellungen, Befürchtungen oder Impulse, z. B. Zwang, obszöne Gedanken zu denken, Zweifelsucht, Vergewisserungszwang, Zählzwang etc. |
* Hysterie: krankhaftes Meidungsverhalten unangenehmer Situationen („Flucht in die Krankheit“); stellt oft den Versuch dar, etwas Erwünschtes dadurch zu erzwingen, dass anderen unbewusst Angst eingeflößt wird. (Wer z. B. aufkreischt, wenn eine Spinne über das Bettzeug läuft, „zwingt“ das Umfeld, sich um die Situation zu kümmern und erspart sich selbst unangenehme Handlungen. Die Vorgänge sind jedoch unbewusst und nicht hinterhältig geplant.)
2 Arten:
| ° | Konversionshysterie: Ausfall von körperlichen Funktionen (z. B. Abasie - Lähmung, Astasie - Unfähigkeit zu stehen - oder sensorische Dysfunktionalitäten) ohne äußere Ursache, der im Schlaf und unter Hypnose verschwindet. Verwandt damit sind die 1915 von Charles Samuel Myers (1873-1946) untersuchten Shellshocks (kriegserlebnisbedingte physische Ausfälle bzw. Zittern ohne organische Ursache). |
| ° | Hysterische Bewusstseinsspaltung: Patient verliert die Fähigkeit, sich über die Zeit als eine gleichbleibende Person zu erleben; kann bis zur (seltenen) Multiplen Persönlichkeit (einer schwerwiegenden Störung, die den Psychosen zuzurechnen ist) führen, die z. B. 1979 vom „Würger von Los Angeles“, einem US-Serienmörder, zunächst erfolgreich simuliert worden ist, von Robert Louis Balfour Stevenson (1850-1894) in Dr. Jekyll und Mr. Hyde literarisch dargestellt wurde oder dem Kinofilm The Three Faces of Eve von 1957 zugrundeliegt. Die heutige Bezeichnung lautet DIS (Dissoziative Identitätsstörung). |
* Hypochondrie: der Patient „erfreut sich schlechter Gesundheit“, da er sich als von seinem Körper abgetrennt empfindet und seine Zustände analysiert, statt sie zu erleben.
* Depressive Neurose: Verlust des rechten Maßes des Reagierens auf Situationen des Verlustes, Versagens, der Enttäuschung etc. Die an sich natürliche Phase der Niedergeschlagenheit wird zu einer depressiven Verstimmung zwanghaft verlängert und kann in eine veritable Depression (s. u.) ausarten.
* Experimentelle Neurosen: durch psychologische Exe. oft willentlich herbeigeführte neurotische Zustände, z. B. Pawlow'scher Hund, wenn er zwischen einem Kreis und einer Ellipse nicht mehr unterscheiden kann (s. o.); oder „Little Albert“ (s. o.); oder an der Wiener Klinik Hoff (Hans Hoff, 1897-1969 gilt als der Begründer der Wiener Psychiatrischen Schule, die eine Vermenschlichung der Zustände unter Berücksichtigung der Würde der Klienten durchsetzen wollte; vgl. u.) durchgeführte Exe. mit Katzen in einer Skinner-Box (s. o.), die durch Frustrationserlebnisse (eine durch operantes Konditionieren eingelernte Verhaltenskombination, die zur Gabe von Futter führt, wird unregelmäßig mit Luftstößen „bestraft“, wenn das Futter aufgenommen wird) dazu gebracht werden, freiwillig mit Alkohol versetzte Milch zu trinken und diese auch unter drei anderen Schalen mit reiner Milch, die sie ansonsten bevorzugen würden (gesunde Katzen finden normalerweise umgekehrt die einzige nichtalkoholische Schale unter mehreren) zu erkennen. Im Zuge dessen leidet ihr Äußeres, sie verlieren anderen Katzen gegenüber ihre Dominanz und können nur durch liebevolle Pflege wieder „gesunden“.
* Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen bzw. -abweichungen: Unter dem Begriff „Persönlichkeitsstörung“ (früher „Charakterneurose“) werden von gesellschaftlichen Erwartungen abweichende Wahrnehmungen von Gefühlen und Mitmenschen in Verbindung mit meist unflexiblen, wenig angepassten Strukturmerkmalen der Persönlichkeit zusammengefasst. Hierzu zählen z. B.:
| ° | Störungen der Geschlechteridentität (z. B. Transsexualität, Transvestitismus; vgl. etwa transmann.de) und solche der Sexualpräferenz (Paraphilien), z. B. Pädophilie, Sodomie, Nekrophilie, Sadismus, Masochismus, Fetischismus, Voyeurismus, Hybristophilie (ein Sich-hingezogen-Fühlen zu Schwerkriminellen, das nach Haller - s. o. - drei Formen aufweisen kann: „Retterinnen“, die die im Grunde edle Seele des Täters „erlösen“ wollen / „Forscherinnen“, die in Seelenabgründe blicken wollen / „Archaikerinnen“, die in Gewalttätern das männliche Prinzip suchen) u. a.; Begriffe oft von Richard von Krafft-Ebing, 1840-1902, in seiner 1886 ersch. Psychopathia sexualis geprägt. |
| Beide Gruppen unterliegen aber in den letzten Jahrzehnten einer Entpathologisierungstendenz und werden - ähnlich der Schwangerschaft - als teilweise behandlungsbedürftige, aber nicht krankhafte Varianten angesehen - zumindest, solange niemand anderer zu Schaden kommt. (Aufgrund dieser Entwicklungen wurde beispielsweise Homosexualität in Österreich 1971, in Deutschland 1994 straffrei gestellt und gilt nun auch nicht mehr als psychische Störung. Die WHO bezeichnet sie seit 1990 nicht mehr als Erkrankung.) | |
| ° | Narzissmus (abgeleitet vom antiken Mythos des in sein eigenes Spiegelbild verliebten Νάρκισσος) zeigt die eigene Brillanz betreffende Phantasien, Empathiemangel, Ruhmsucht (Doxomanie) und eine Überempfindlichkeit gegenüber anders lautenden Meinungen. Diese Störung wird oft als als Stärke getarnte Angst mit fehlgeleiteter Empathie (man kennt die Schwachstellen anderer genau) gedeutet. Narzissten wollen bewundert werden, sind oft manipulativ und eigensüchtig, aber kränkbar. Als erster literarischer Entlarver dieser Störung gilt der Kritiker aristokratischer Selbstsucht François VI. de La Rochefoucauld (1613-1680) mit Zitaten wie „Wir sind alle stark genug, das Unglück anderer zu ertragen“ bzw. „Bescheidenheit ist die schlimmste Form der Eitelkeit“. Man beobachtet eine starke Zunahme dieses Zustandsbildes seit der digitalen Revolution ca. ab 2000 - oder zumindest eine Zunahme der bespielbaren (digitalen) Bühnen -, ein (manchmal behaupteter) Zusammenhang mit einem eventuellen Einzelkinddasein konnte nicht nachgewiesen werden. Im ICD-10 ist Narzissmus unter F 60.8 erwähnt. Manchmal werden zusätzlich gesunder von pathologischem und grandios-extravertierter von vulnerabel-introvertiertem Narzissmus unterschieden. Zu Kränkung s. o.) |
| ° | Dissoziale Persönlichkeiten mit geringer Frustrationstoleranz, Diskrepanz zwischen eigenem Verhalten und den sozialen Normen und deformierter Emotionalität („Psychopathie“, „antisoziale Persönlichkeitsstörung“). Gewissen, Empathie und Verantwortungsgefühl können fehlen. (Das bedeutet nicht automatisch, dass Psychopathen Delinquenten werden müssen, wenn auch aggressives und gewalttätiges Verhalten prozentuell häufiger vorkommt als unter Ceteris-paribus-Bedingungen in der Normalbevölkerung.) Neuere Forschungen legen nahe, dass Veränderungen mancher Hirnpartien mit dieser Störung assoziiert sind (s. hier und hier). Als „dunkle Triade“ bezeichnet man, oft mit Sadismus ergänzt zu einer Tetrade, das Zusammentreffen von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. |
| ° | Emotional instabile Persönlichkeiten mit Tendenz zu Launenhaftigkeit, dazu, Impulse auszuagieren, zu emotionalen Ausbrüchen, ev. Streitsucht; bei übermäßiger Emotionalität Histrionismus, z. T. vom Borderline-Typus (zusätzlich mit Selbstbild-Störung und mangelnder Impuls-Kontrolle, Affektstürmen, suizidalem Verhalten, Dissoziation, also „Entfernung“ des Geistes vom Körper, SVV - s. u. - etc.). Definition des Borderline-Erforscher Otto Friedmann Kernberg, *1928 (s. a. u.): „Ein Borderline-Patient versteht sich in schwerwiegender Weise selbst nicht [...] und zugleich versteht er wichtige andere Personen nicht mit dem Resultat chaotischer menschlicher Beziehungen, weil er das eigene und das Verhalten anderer nicht vorhersagen kann.“ (Kernberg im Gespräch mit Manfred Lütz, *1965. Freiburg im Breisgau 2020) - Vgl. a. u. bzw. Selbsttest) |
| ° | BIID (Body Integrity Identity Disorder bzw. Body Integrity Dysphoria BID; Körperintegritätsidentitätsstörung): Bei dieser Störung stimmt das mentale Körperbild nicht mit dem tatsächlichen Körper überein. Sie äußert sich im krankhaften Verlangen nach Amputation von Gliedmaßen oder einer anderen physischen Behinderung. Als Ursache werden u. a. dysfunktionale Hirnteile angenommen (vgl. hier). Seit 2019 ist BIID in die ICD 11 aufgenommen. Verwandt ist die Xenomelie, also das Gefühl, dass einzelne Körperteile nicht zu einem selbst gehören. |
| ° | Dysexekutives Syndrom: bei Anomalien oder Läsionen des präfrontalen Kortex (s. a. o.) auftretende Enthemmung mit unangepassten Verhaltensweisen, Wutanfällen, Empathielosigkeit, unhöflichem oder infantilem Verhalten, ungehemmter Impulsivität etc. Um exekutive Funktionen wie Planungsfähigkeit von Klienten (und damit die Intaktheit ihres Stirnhirns) zu testen, wird im Ex. der auf der Grundlage des mathematischen Knobelspiels „Turm von Hanoi“ vom englischen Neurologen Tim Shallice (*1940) entwickelte Turm von London benützt. Dabei müssen drei auf drei Stäben über- oder nebeneinander aufgesteckte verschiedenfarbige Kugeln durch Umstecken in möglichst wenigen Zügen in eine vorgegebene andere Formation gebracht werden. Es darf jeweils nur eine Kugel (und immer nur die oberste eines Stabes) berührt werden. Die Spielzüge sollen nachher erinnert werden können. |
Zu Autismus s. o. - Im DSM V werden Persönlichkeitsstörungen in Cluster A (paranoide, schizoide, schizotypische Störung: sonderbar, exzentrisch), Cluster B (antisoziale, narzisstische, histrionische, Borderline-Störung: dramatisch, emotional, launisch) und Cluster C (passiv-aggressive Störung: ängstlich, vermeidend, dependent, furchtsam, zwanghaft) unterteilt.
-
Psychosen:
Der Begriff Psychose wurde 1845 von Ernst
Maria
Johann
Karl
Freiherr von Feuchtersleben
(1806-1849), einem
Wiener Arzt, der auch als Mitbegründer der psychosomatischen Medizin gilt, und Freund von Franz Seraphicus Grillparzer
(1791-1872) zum ersten Mal verwendet.
* Definition: Wenn das Erleben und Verhalten eines Menschen derart stark
von der Norm abweicht, dass der Kontakt zur Realität verloren geht und die
Persönlichkeit nachhaltig desintegriert ist, so wird dieser Zustand als
psychotisch bezeichnet.
Psychosen, die auf physische Ursachen zurückzuführen sind, nennt man organische
Psychosen (z. B. durch Tumore, Altersdemenz, Alkohol oder Gehirnläsionen
verursacht). Im folgenden ist ausschließlich von der zweiten Gruppe, den
funktionellen oder endogenen Psychosen, die Rede (deren Auftreten
nichtsdestotrotz ebenfalls biologisch-genetisch mitverursacht sein mag).
Vgl.
Was sind Psychosen?
* Paranoide Psychosen (von griech. παρανοεῖν: neben dem Geist, wahnsinnig sein): bezeichnet mit Wahnideen verbundene Psychosen. Unter Wahn wird eine lebensbestimmende „Privatwirklichkeit“ verstanden, die - nach Karl Theodor Jaspers (1883-1969) - subjektiv gewiss, unkorrigierbar und inhaltlich unmöglich ist. Eine Komorbidität mit anderen Psychosen ist möglich.
| ° | Paranoia: der Patient leidet dauerhaft unter persistierenden (lange andauernden) Wahnideen (also der objektiven Realität widersprechenden Wahrnehmungsinhalten, die zäh verteidigt werden). Am häufigsten sind (häufig gekoppelt): Verfolgungswahn (der durch geringes Selbstvertrauen, schlechten Schlaf, übertriebene Sicherheitsvorkehrungen und Probleme beim Schlussfolgern aufrechterhalten zu werden scheint), Größenwahn (man hält sich für mehr, als man ist - bis hin zu historischen Persönlichkeiten oder dem Vorstand der psychiatrischen Klinik) und Beziehungswahn (man bezieht alles, z. B. das Blätterrascheln oder Restaurantgespräche am Nachbartisch, auf sich). Der Paranoiker baut komplizierte Gedankengebilde auf seinen Wahnideen auf, in die alle Therapieversuche miteinbezogen werden. (Deshalb ist manchmal eine paradoxe Intervention - vgl. u. - wirksam.) Ein Spezialfall ist das Capgras-Syndrom (Angehörige werden für Doppelgänger gehalten; nach Joseph Capgras, 1873-1950), das aber wie die Prosopagnosie (s. o.) auch auf Hirndefekten beruhen könnte. |
| ° | Paranoider Zustand: Die Wahnideen erscheinen vorübergehend. |
* Affektive Psychosen (die Gemütslage betreffende Psychosen; früher Gemütserkrankungen): Die Patienten leiden unter extremen Stimmungsschwankungen (Zyklothymie), verbunden mit Denk- und Verhaltensstörungen. Ursächlich scheinen u. a. (vgl. u.) Störungen des Serotonin- bzw. Dopaminhaushalts zu sein. Das Bewertungssystem im Gehirn gerät außer Takt. Man unterscheidet unipolare von bipolaren Störungen. Geschätzte Prävalenzen: 55% der Erkrankten sind unipolar depressiv, 5% unipolar manisch, 40% bipolar. (Zu Stimmungen s. u.)
| ° |
Manie (von
griech. μανία
= Raserei; Begriff von Benjamin
Rush -
s. o.): ist eine intensive Hochstimmung ohne Grund;
ein unangemessen gesteigertes
Lebens- und Selbstwertgefühl mit „Bremsversagen“, verbunden mit
einem Drang zu Rede (Logorrhoe),
zu Bewegung, zu Lachen, zu Risiko und Geldausgeben bzw. allgemein zu Aktivität. Oft tritt Größenwahn
auf. Die Sprache ist
während eines manischen Schubs oft assoziativ, gedankenflüchtig, ohne Stringenz. (Beispiel von Navratil,
s. u.: „Erbtanten habe ich
nicht, Inzucht liegt bei mir auch nicht vor, nicht einmal Unzucht, dafür
stamme ich aber von Karl Martell, dem 'Hammer'. Im Hammerverlag sind
seinerzeit sehr bedeutende politische Schriften erschienen. Der
'Hexenhammer' allerdings nicht, der ist mindestens 500 Jahre älter. Meine
Alte fällt auch drunter, die hätt' man damals glatt verbrannt. Heirate oder
heirate nicht, bereuen wirst du beides, sagt Kierkegaard. Die Axt im Haus
erspart den Scheidungsrichter, sag ich! Ich bin aber nicht gemeingefährlich,
ich bin nur Gemeinen gefährlich! Ach, da kommt ja schon wieder die
Straßenbahn mit ihrem saudummen Geklingel...“ sagte ein manischer Patient auf die Frage des
Psychiaters, ob es in seiner Familie Geisteskranke gebe; zitiert nach Schizophrenie und Sprache. München 1966, S. 45.) Man unterscheidet klassische, gereizte (mit zornig-aggressiven Anteilen) und verworrene Manie (mit extremer Verwirrtheit in Denken und Sprechen). Eine nur leichte Agilität mit erhöhtem Redefluss wird Hypomanie genannt. Können Handlungen nicht mehr adäquat beendet werden und gelingt es nicht mehr, die Umwelt in gewisser Weise „anzustecken“, spricht man von einer überkochenden Manie. |
|||||||||
| ° |
Depression (vgl.
Fragebogen 1,
2; Allgemeine Informationen)
bezeichnet eine nicht mit zeitweise auftretender Traurigkeit (einem starken, mit Verzweiflung und
Verlust verbundenen Gefühl) oder Melancholie zu verwechselnde starke, grundlose oder über den Anlass
bzw. über gelegentliche Deprimiertheit hinausgehende Niedergeschlagenheit,
Melancholie, Negativstimmung, Empfindung innerer Leere, Verzagtheit, Schwermut.
Sie ist verbunden mit dem Verlust der Freude an Unternehmungen und als Folge
der Verminderung jeder Aktivität durch Antriebsverlust
(motorischer Hemmung), chronischem Energiemangel bis hin zu Lustlosigkeit,
Hoffnungslosigkeit, allgemeiner Gefühlsleere, Empfindungslosigkeit
und Abulie (Schwächung oder Verlust der Willenskraft, ev. mit Mutismus = Stummheit), Gefühlen
der Verlangsamung, der Wertlosigkeit (Verlust des
Selbstwertgefühls), der Hoffnungslosigkeit oder der Hilfslosigkeit, Selbstvorwürfen, Appetitlosigkeit, Ermüdbarkeit,
Konzentrations-, Merkfähigkeits- und Schlafanomalien. (Beim letztgenannten
Phänomen besteht eine bidirektionale Beziehung: Schlafstörungen können
Depressionen, Depressionen können Schlafstörungen auslösen.) Die Entwicklung der Erkrankung kann bis hin zur Suizidneigung führen. (Die Selbstmordrate unter Depressiven ist sehr hoch, wenn auch etwas niedriger als die der Suchterkrankten.) Die gestörte Verarbeitung innerer und äußerer Reize kann zu Grübelzwang (overthinking; intrusive Kognition) führen, das - oft von Reizüberflutung ausgelöst - ohne Lösungsansatz im Kreis geht. (Vgl. Mark Twain: „Ich habe in meinem Leben schon die schrecklichsten Dinge erlebt. Die wenigsten davon sind eingetroffen.“) Depressionen haben eine hohe Komorbidität mit Essstörungen, Suchterkrankungen und Angststörungen und wirken sich negativ auf körperliche Erkrankungen aus. Etwa 20% aller Depressionen chronifizieren, wobei die reaktiven (als Folge äußerer Geschehnisse) oft leichter zu behandeln sind als die endogenen. Häufig wird das Burnout-Syndrom - s. o. - mit der Depression in Verbindung gebracht. Nicht zu verwechseln ist die Depression mit dem harmloseren „Winterblues“, der eine Missstimmung beschreibt, die in der dunkleren Jahreszeit dadurch ausgelöst wird, dass aufgrund des geringen Lichteinfalls die Zirbeldrüse (corpus pineale) zu wenig Melatonin produziert, wodurch der zirkadiane Rhythmus (s. o.) gestört wird.. Weitere mit der Depression in Zusammenhang stehende Phänomene sind der durch Hormonumstellung bewirkte postpartale „Babyblues“, der sich zu einer veritablen Depression auswachsen kann und dann auch im § 79 StGB berücksichtigt wird, und „Blues“ bzw. Leere, die sich manchmal einstellen, wenn man ein großes Ziel, auf das man lange hingearbeitet hat, erreicht, aber nicht abschließen kann. (Zu Stimmungen s. u.) Um eine Depression gültig diagnostizieren zu können, sollten drei Monate vergangen sein. Als erster Diagnoseversuch kann das Konzept der Melancholie von Hippokrates (Ἱπποκράτης ὁ Κῷος; ca. 460-370 v. Chr.) gelten (s. u.), der humoralpathologisch einen Überschuss an schwarzer Galle im Blut annahm. Der Leipziger Johann Christian August Heinroth (1773-1843; erster Inhaber eines Lehrstuhls für psychische Krankheiten) prägte 1818 den Begriff „Depression“. Ein rezentes psychologisches Konzept zur Erklärung dieser Erkrankung ist das der erlernten Hilflosigkeit von Martin E. P. Seligman (*1942). Darunter versteht man die aufgrund negativer Lebenserfahrungen entwickelte internalisierte Überzeugung, dass man aus eigener Schuld die Fähigkeit verloren hat, seine Lebenssituation zum Positiven verändern zu können. (In der Therapie setzt er - s. a. u. - im Gegensatz zu einer seiner Meinung nach zu sehr defizitorientierten Psychologie auf Positive Psychologie.) Andere Ansätze sehen die Ursachen einer Depression in einer - wodurch immer verursachten - Störung der Neuromodulatoren. Seit der 1965 aufgestellten und später ausdifferenzierten Monoaminhypothese von Joseph J. Schildkraut (1934-2006) wird eine - wie immer geartete - Beteiligung von Adrenalin, Dopamin und Serotonin angenommen. Weitere Risikofaktoren sind chronische Belastungssituationen, gewisse genetische Dispositionen und ein problematischer Alkoholgenuss. In Österreich erkranken im Laufe eines Kalenderjahres etwa 7% aller Männer und 12% aller Frauen an einer Depressionserkrankung, sehr häufig im Alter. Tendenziell nimmt die Zahl der Depressionen zu, v. a. in der westlichen Welt (die aber auch eine höhere Lebenserwartung und größere Diagnosehäufigkeit aufweist). Depressionen sind durch neue, nebenwirkungsarme Antidepressiva und Psychotherapie im Vergleich zu anderen Erkrankungen relativ gut behandelbar. Günstig wirkt sich oft längeres, einfaches Gehen bis zur Ermüdung aus. Mehr als 20fach häufiger als in der Normalbevölkerung tritt bei Depressiven Lebensüberdruss auf. Die Bezeichnung „Selbstmord“ wird heute manchmal vermieden, da sie moralisiert. Der Begriff „Freitod“ hingegen insinuiert romantisierend einen Handlungsspielraum, der jedoch oft sehr eingeschränkt ist. (Betroffene diagnostizieren z. B. oft aufgrund ihrer periodisch eingeengten Sichtweise dort, wo noch Aussichtslosigkeit vorliegt, eine Ausweglosigkeit ihrer Situation). Unter „erweitertem Suizid“ versteht man die Mitnahme (Ermordung) von Nahestehenden, für die man in diesem Moment einer eingeengten Sicht ebenfalls keinen Ausweg mehr sieht. Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi (Лев Николаевич Толсто́й, 1828-1910) hielt den Selbstmord - ohne ihn zu praktizieren - in den Bekenntnissen für die ehrlichste der vier Antworten auf das Unrecht der Welt. (Die anderen drei seien kindliche Ignoranz, hedonistischer Rausch und trotziges Durchhalten.)
|
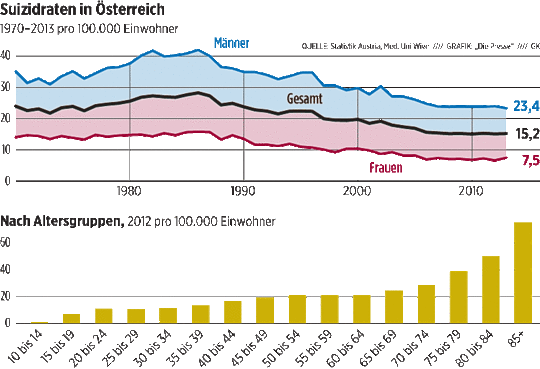
Abb. 4/6: Quelle: https://diepresse.com vom 9.11.2014
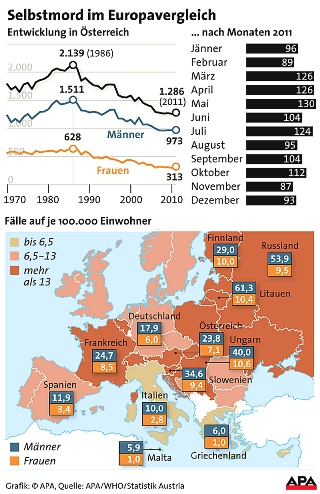
Abb. 4/7: aus: derstandard.at 7.9.2012
| Einer der ersten, der sich dem Suizid nicht aus
moralischer oder rein statistischer, sondern aus medizinischer und
psychologischer Perspektive
näherte, war der Arzt Erwin Ringel
(1921-1994; vgl.
Seite 1,
Seite 2), ein (selbst physisch schwer beeinträchtigter,
zunächst in der Tradition Adlers
- s. u. - stehender)
österreichischer Pionier der
Psychosomatik
(deren Phänomene erstmals von Heinroth
beschrieben wurden) bzw. der
medizinischen
Psychologie. Er machte erfolgreich seinen Einfluss geltend, um die Katholische Kirche
- entgegen deren Jahrtausende alter Tradition - davon zu überzeugen, auch Selbstmördern trotz „Judassünde“ - ein Suizid (wie
das Erhängen des Judas) leugne die Allmacht Gottes, da ihn nur vollziehe,
wer daran zweifle, dass ihm vergeben werden könne - ein kirchliches
Begräbnis zu gestatten. (Davor gab es nur ein „Eselsbegräbnis“ - sepultura
asini; nach Jeremia 22,19 - außerhalb der den geweihten Bereich
abgrenzenden Friedhofsmauern.) Ringel
beschrieb ein von ihm so genanntes Präsuizidales Syndrom: Danach werden so gut wie alle Selbstmorde angekündigt, was aber aufgrund der Tatsache, dass umgekehrt viele Ankündigungen leichtfertig ausgesprochen werden, oft ignoriert wird. Der Patient erlebt vor dem Suizid: + Einengung, die ihm „situativ“ (die Welt wird als unbeeinflussbar empfunden) subjektiv immer weniger Bewegungsspielraum lässt (wie beim Panther von Rainer Maria Rilke, 1875-1926: „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt“), dynamisch seine Affekte in Richtung Depression und Selbstvernichtung richtet, aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen (bis zur völligen Isolierung) und die Wertwelt (Gleichgültigkeit, nichts wird mehr als wirklich wichtig empfunden) betrifft. + Selbstmordphantasien, die in drei Stadien erscheinen: tot zu sein, Selbstmord zu begehen und, zuletzt (Alarmzeichen!), es auf eine ganz bestimmte Weise zu tun. + Aggressionsumkehr, also Aggression, die - an sich natürlich und biologisch sinnvoll (s. u.) - gehemmt und gegen die eigene Person gerichtet ist. Durch die Unfähigkeit, sie nach außen abzureagieren, bietet sich der eigene Körper als Ersatzobjekt an (wie auch bei tw. „versteckt“ Suizidelemente enthaltenden Phänomenen wie Alkoholismus und anderen Süchten, manchen Unfällen, psychosomatischen Erkrankungen etc.) In einer clusteranalytischen Studie, die 2000 im Auftrag des Ludwig-Boltzmann-Institutes (nach Ludwig Boltzmann, 1844-1906) für angewandte klinische Psychologie erarbeitet wurde, konnte dabei Ringels Konzept von der Aggressionsumkehr nicht bestätigt werden. Sie zeigt viel mehr auf, dass bei selbstmordgefährdeten Personen beide Aggressionsdimensionen (die nach außen und die nach innen) ansteigen. Gefahr ist in Verzug, sobald die Autoaggression die nach außen gerichtete Aggression überwiegt und auch die beiden anderen von Ringel genannten Faktoren zutreffen. Der österreichische Psychiater Walter Pöldinger (1929-2002) beschrieb 1968 die suizidale Entwicklung in 3 Phasen: + Stadium der Erwägung: Die Selbsttötung wird als eine von mehreren Möglichkeiten in Betracht gezogen (je konkreter, desto gefährlicher die Situation). + Stadium der Ambivalenz: Die potentiellen Suizidanten sind hin- und hergerissen: Soll ich oder soll ich nicht? + Stadium des Entschlusses: Für den Betroffenen steht fest, dass er sein Leben beenden will. (Phase der inneren Beruhigung, die von der Umgebung aber falsch verstanden wird; auf indirekte Hinweise achten: Testament, überraschende Reisepläne etc.) Die Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens des US-amerikanischen Psychologen Thomas Joiner (*1965) postuliert 3 Schlüsselprozesse: + Wahrnehmung, eine Last zu sein (und daher durch Suizid andere zu entlasten) + Wahrnehmung, dauerhaft isoliert zu sein (und das fehlende Zugehörigkeitsgefühl bzw. die Einsamkeit auch unter anderen Menschen nicht mehr kompensieren zu können) + Suizidfähigkeit (die die Betroffenen den aus den ersten beiden Komponenten entstandenen Suizidwunsch aufgrund von erhöhter Schmerztoleranz und Furchtlosigkeit vor dem Tod in die Tat umsetzen lässt), deren Koinzidenz in einer Person einen Suizid wahrscheinlich werden ließen. Zu Suizid vgl. Statistik, Zahlen für Europa („Bevölkerung/Gesundheit/Todesursachen“), Suizid-Prävention, World Suicide Prevention Day, aktuelle Informationen und Suizidberichte für Österreich, Suizidinformationen Deutschland, suizidpraevention.at, Institut für Suizidprävention Graz, Suizidgefahr erkennen, Linksammlung, Suizid bei Kindern und Jugendlichen, Seite der IASP (International Association for Suicide Prevention), Studie „Suizide von Männern in Österreich“ (Wien 2003), Wiener Werkstätte für Suizidforschung, österreichische Suizidprävention, österreichischer Suizidpräventionsplan, Suizidmedienrichtlinien im Zusammenhang mit COVID 19 und diverse Veröffentlichungen. |
|
| ° | Bipolare affektive Störung, früher Manisch-depressives Irresein: Erstmals wurde ein periodischer Wechsel der oben beschriebenen unipolaren Grundstimmungen von Jean-Pierre Falret (1794-1870) als Folie circulaire (zirkuläres Irresein) beschrieben. Laien beurteilen eine auf eine depressive Phase folgende manische Phase oft irrtümlich als Zeichen der Genesung, da die Ausstrahlung der Person nun zugewandt und (scheinbar!) positiv wirkt. Man unterscheidet Typ I (Depression plus Manie) von Typ II (Depression plus Hypomanie); s. hier. |
* Schizophrenie: Diese Bezeichnung wurde 1911 von Eugen Bleuler (s. o.) als Sammelname für alle nicht erklärbaren Persönlichkeitsstörungen, z. B. auch für Epilepsie, eingeführt. Sie löste den früheren Namen Dementia praecox (= „vorzeitiger geistiger Abbau“) ab und bedeutet „gespaltenes Zwerchfell“ (für die alten Griechen sitzen dort Geist und Seele; von griech. σχίζειν „spalten“ und φρήν „Zwerchfell“, „Geist“, „Bewusstsein“). Heute werden darunter im ICD klar definierte Zustandsbilder verstanden. In Österreich erkrankt im Laufe des Lebens etwa 1% aller Personen an Schizophrenie. Die Krankheit zeigt in Zwillingsstudien eine hohe Erblichkeit von bis zu 80%. Die pharmazeutische Behandlung erfolgt meist mit Neuroleptika wie Phenothiazinen und Butyrophenonen.
Heute bezeichnet man damit den Persönlichkeitszerfall
(eine Verunsicherung des Kerns des Ich) mit zunehmender
Abstumpfung gegenüber der Umwelt. Schizophrenie tritt in Schüben auf (vgl.
die Bezeichnung der Erkrankung, die die Spaltung zwischen normalen und psychotischen Phasen
anzeigt). Frauen vor
den Wechseljahren sind weniger stark betroffen als andere Bevölkerungsgruppen,
da ein hoher Östrogenspiegel die Sensibilität der Dopaminrezeptoren vermindert
und daher neuromodulatorisch vor den Symptomen bis zu einem gewissen Grad
schützt. Möglicherweise spielt bei dieser Erkrankung aber gar nicht das Dopamin,
sondern der Glutamatmangel die Hauptrolle: Dopaminsynapsen hemmen die
Freisetzung von Glutamat im limbischen System. Der britische Anthropologe Gregory
Bateson (1904-1980;
s. a. u.) interpretierte
Schizophrenie unter ganz anderen Gesichtspunkten als dysfunktionale Kommunikationsform, die nicht fähig sei,
Kontexte zu berücksichtigen. Diese würden als verwirrend erscheinen.
Vgl. auch
Was ist Schizophrenie?,
Medizinische Informationen,
schizophrenia.com,
hopeforschizophrenia.com,
What happens to the body and brain of individuals with schizophrenia?
|
Formen der Schizophrenie:
| ° | Schizophrenia simplex: ist die Grundform der Schizophrenie. Mögliche Symptome: Wahnideen, die Sprache ist durch Begriffszerfall (ähnlich der Dichtung) gekennzeichnet. Die Wörter und Begriffe sind nicht eindeutig definiert (also von anderen Lexemen abgegrenzt) und damit schwer zuordenbar; der Therapeut muss interpretieren. (Z. B. die doppelsinnige Äußerung: „Meine Mutter musste heiraten, und deshalb bin ich hier.“) Zunehmende Reduzierung der Verbindungen zur Außenwelt; Demenz (Abbau der Persönlichkeit und des Denkvermögens); Wegfall von Hemmungen. Insgesamt zeigt sich in schleichender Progredienz merkwürdiges Verhalten, das mit sozialen Anforderungen nicht mehr kompatibel ist. |
| ° | Paranoide Schizophrenie: von - im Gegensatz zur Paranoia nicht notwendigerweise systematisierten - Wahnideen begleiteter Persönlichkeitsabbau. (Akustische) Halluzinationen mit imperativem Charakter (z. B. eine als real empfundene Stimme aus dem Radio: „Ich, Gott, befehle dir, ...“) treten auf und werden handlungsbestimmend (kann in seltenen Fällen bis zum Mord führen). |
| ° | Katatonie (katatone Schizophrenie): beginnt plötzlich mit Halluzinationen und Wahnideen, die sich mit psychomotorischen Störungen verbindet. Nach einer Erregungsphase tritt oft plötzliche Erstarrung der Willkürmuskulatur auf (Stupor vigilans, Katalepsie). Die gerade eingenommene Lage wird oft über Stunden beibehalten, die Körperfunktionen werden vergessen, auf Reize wird trotz Wachheit nicht reagiert. (Ein entfernt ähnliches, aber durch gänzlich andere Ursachen hervorgerufenes Phänomen ist das antarktische Starren als Teil des Winterover-Syndroms, das manchmal Personen zeigen, die in südpolnahen Forschungsstationen überwintern. Sie sind dann schwer ansprechbar und starren auf das Eis, ertragen dadurch aber möglicherweise die Situation der viermonatigen Nacht durch diesen „Kurzwinterschlaf“ besser. Vgl. Link) |
| ° | Hebephrenie: besonders schwere Form der Schizophrenie, die im Jugendalter auftritt. Symptome: Verlust jeglicher Anpassung und Integration; völliger Persönlichkeitsabbau; Regression. |
| ° | Mischformen mit Symptomen aller Art oder unklarer Symptomatik. |
| ° | Zur dissoziativen Identitätsstörung DIS s. o. |
Schizophrenie und Kunst:
Dieser Zusammenhang ist ein in der Forschung besonders berücksichtigter Gesichtspunkt, da seit Jahrhunderten offensichtlich war, dass zahllose weltbekannte Künstler unter Schizophrenie litten. (Beispiele sind u. a. Vincent van Gogh, 1853-1890, oder Friedrich Hölderlin, 1770-1843, der die zweite Hälfte seines Lebens pflegebedürftig war, was er womöglich in seinem 1804 erschienenen kurzen Gedicht Hälfte des Lebens bereits vorausahnte.)
In Niederösterreich hat Leo Navratil (1921-2006; s. o.) in der 1889 gegründeten und 2007 geschlossenen Landesnervenklinik Gugging (nach ersten Zeichenversuchen zu diagnostischen Zwecken 1954) 1981 das Haus der Künstler gegründet (eine Art betreute Wohngemeinschaft malender oder dichtender Anstaltsbewohner, die bis 1986 Zentrum für Kunst und Psychotherapie hieß und im leer stehenden Pavillon 11 untergebracht wurde) und mit seinen Büchern Schizophrenie und Kunst (1965) bzw. Schizophrenie und Sprache (1966) der (im anglophonen Raum manchmal Outsider Art genannten) Art Brut zu einer breiten Öffentlichkeit verholfen, die Navratil allerdings - ärztlich einschränkend - „zustandsgebundene Kunst“ nannte. (Der Ausdruck Art Brut wurde 1945 vom französischen Künstler Jean Dubuffet, 1901-1985, entwickelt, der damit aber weniger „rohe, wilde Kunst“, sondern eher „ungesüßte Kunst“ - analog dem Champagner Brut - meinte.) Einige wichtige Gugginger Künstler waren Oswald Tschirtner (1920-2007), Johann Hauser (1926-1996), August Walla (1936-2001) und Johann Garber (von dem die Ohrplastik vor dem Wiener Radiokulturhaus stammt; *1947). Die Einrichtung erlangte in einschlägigen Kreisen unter anderem durch den 1994 erfolgten Besuch des englischen Musikers und Sängers David Bowie (1947-2016; eig. David Robert Jones), der hier eine Inspirationsquelle für sein Album 1. Outside fand, weltweite Aufmerksamkeit.
Navratils Nachfolger Johann Feilacher (*1954; s. hier), selbst Künstler, löste 1986 das Haus der Künstler aus der Klinik organisatorisch heraus und stellte nicht mehr den Therapieaspekt, sondern die Eigenständigkeit der Kunst seiner Klienten in den Mittelpunkt seines nicht mehr (nur) ärztlichen Wirkens (der Patientenstatus der Künstler fiel weg), organisierte mit den gugging friends einen privaten Träger und gründete 2006 gemeinsam mit Nina Katschnig (*1972), der Leiterin der bereits seit 1994 bestehenden galerie gugging (die im Besitz der Gugginger Künstler ist), das „museum gugging“ - heute (gemeinsam mit mit dem Haus der Künstler, der galerie gugging und dem auch für Gäste zugänglichen Offenen Atelier) Teil des international bekannten Art Brut Centers Gugging. Am 1. 1. 2023 übernahm Nina Ansperger (*1980) die künstlerische Leitung des Museums.
-
Andere Einteilungen:
Es existieren zahllose andere Einteilungen und Klassifizierungen
psychischer Störungen, z. B. die des amerikanischen Psychiaters Karl
Menninger (1893-1990), der ein
hierarchisches System der Kontroll-(Funktions-)Störungen aufgestellt hat:
| ° | 1. Ordnung: Rhythmische Bewegungen, Rauchen, Trinken, Lachen, Weinen, Fluchen, Prahlen, Phantasien, Tagträume etc. sind zu beobachten. |
| ° | 2. Ordnung: Der Stress für den Patienten ist so stark, dass die genannten Verhaltensweisen zu seiner Beseitigung nicht mehr ausreichen. Symptome von Neurosen, also Phobien, psychosomatische Krankheiten, neurotische Depressionen, Zwangshandlungen, Kleptomanien, Perversionen mit aggressiver Komponente in verhüllter Form treten auf. Der psychisch zu zahlende Preis ist höher als bei den Symptomen erster Ordnung. |
| ° | 3. Ordnung: Es zeigen sich noch schwerwiegendere Kontrollstörungen mit „unverhüllten Aggressionen“ in drei Formen: chronisch-aggressives Verhalten, episodisch-impulsive Gewalttätigkeiten und episodische Gewalttätigkeiten mit Desorganisation. |
| ° | 4. Ordnung: Symptome von Psychosen (z. B. Schizophrenien) kennzeichnen diese Ordnung. Sie repräsentieren eine „vorletzte Anstrengung, etwas Schlimmeres zu vermeiden“. |
| ° | 5. Ordnung: Maligne Angstzustände und Depressionen, die letztlich im Tod, oft durch Suizid, enden, können nun nicht mehr überboten werden. |
Vgl. psyonline.at, Psychotherapie-Links, den Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, Berufsverband österreichischer Psychologinnen, die American Psychiatric Association o. ä.
-
Definitionen:
*
Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller
Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in
einem Konsensus (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für
behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch
Kommunikation) meist verbal aber auch averbal, in Richtung auf ein definiertes,
nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisierung und/oder
Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis
einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.
Hans Strotzka
(1917-Feuerunfall 1994) Hrsg.: Psychotherapie. München 21978,
S. 4
* Schule: bezeichnet die Grundorientierung der Therapie (z. B. Psychoanalyse, Gestalttherapie; mit Stichtag 31. 12. 2009 war die Systemische Familientherapie mit mehr als doppelt so vielen Vertreter/innen wie die nächstplazierte Verhaltenstherapie am häufigsten vertreten.)
* Verfahren: bezeichnet die Praxis, die der Grundorientierung entspricht (z. B. verhaltensorientierte Gruppentherapie)
* Technik: bezeichnet operational beschreibbare Methoden des konkreten therapeutischen Vorgehens (z. B. Paradoxe Intention, Reizüberflutung in vivo)
* Setting: bezeichnet behandlungsstrategische Elemente und Arrangements (z. B. ambulant / teilambulant / stationär oder Einzel-, Gruppen-, Familiensetting)
* Perspektive: bezeichnet das Referenzsystem psychotherapeutischer Wirkfaktoren (z. B. Entwicklungs-, Ressourcenperspektive)
-
Geschichtliches:
Historisch erwähnenswerte (1000e Jahre alte) „Therapieformen“,
die vermutlich auch oder gerade bei Zustandsbildern angewendet wurden, die man
heute als psychische Erkrankungen diagnostizieren würde, sind der
Schamanismus (bis heute existent; soll die verlorene Seele finden und dem
Körper zurückgeben), der Tempelschlaf der alten Griechen (ἐγκοίμησις =
Inkubation; durch den Traum werden Therapiehinweise erhofft), die Chiromantie (Handlesen) und die Trepanation
(schon in der Steinzeit praktiziertes Aufbohren des Schädeldaches, um - ähnlich
dem Aderlass und gewissen Reinigungspraktiken - Druck zu mildern und Dämonen
entweichen zu lassen). Aristoteles (Ἀριστοτέλης;
384-322 v. Chr.) betrachtete jede Diagnose als einen
essenziellen Schritt auf dem Weg zu einem tugendhaften und erfüllten Leben, also
zur Eudaimonie. Für ihn bestand der Sinn einer Diagnose einzig in der
Therapie leidender Menschen. (Auch heute besteht mancherorts die Ansicht, dass
nicht der Grad an Normalität, sondern der des Leidens eine Störung definiert,
sodass letztlich der Patient und nicht der Arzt das Ziel der Therapie bestimmt.)
Das erste (und lange Zeit einzige) „Irrenhaus“ war seit 1357 das „Bedlam“ = Londoner Bethlem Hospital, das bald als Stätte des Schreckens galt. In Wien existierte von 1784-1869 der von Kaiser Joseph II. (1741-1790) finanzierte und vergleichsweise fortschrittliche Narrenturm, der vielen als erste psychiatrische Klinik gilt (von den Wienern aufgrund seiner Bauform „Guglhupf“ genannt; heute Teil des Naturhistorischen Museums; s. hier). Europaweit wurden Patienten erst in der Zeit der Aufklärung aus der Kettenhaltung befreit: Philippe Pinel (1745-1826), leitender Arzt des Hôpital Salpêtière, trat 1793 als einer der ersten gegen Zwangsbehandlungen auf und begründete - auf Grundlage der damals ungewöhnlichen Idee, dass psychisch Kranke geheilt werden können - das No-restraint-Konzept. (1783 hatte bereits Abraham Joly, 1748-1812, am Hôpital général in Genf Zwangsmaßnahmen abgelehnt.) Zwischen 1840 und 1900 wurden dann zahlreiche psychiatrische Krankenhäuser eröffnet (1870 z. B. in Zürich die als modern geltende Klinik Burghölzli, deren Anspruch Heilung war). Gegen Ende des 19. Jhdts. entwickelten sich allmählich Systematiken (s. o.), die zunächst davon ausgingen, dass mentale Störungen physische Ursachen hätten und geheilt werden können. Reaktionen darauf, dass dies sehr häufig nicht möglich war, bestanden einerseits im Aufkommen der Eugenik (in diesem Fall der Verhinderung der Fortpflanzung kranker Personen) und andererseits in der Ausarbeitung einer Gesprächstherapie, wie sie etwa Freud entwickelte.
Erste Psychopharmaka (Valium) wurden 1788 von Vincenzo Chiarugi (1759-1820) in Italien eingesetzt, das erste Antidepressivum war (erst in den 50er-Jahren des 20. Jhdts.) das vom Schweizer Konzern Geigy (später Novartis) entwickelte Imipramin, dessen Wirkung in einem Fall von Serendipität (s. u.) entdeckt wurde. (Der Psychiater Roland Kuhn, 1912-2005, wollte es ursprünglich als Neuroleptikum einsetzen.) Im 20. Jh. führte das Aufkommen der Psychochirurgie durch Antonio Egas Moniz (1874-1955, Medizin-Nobelpreis 1949) und anderen zu den berüchtigten Lobotomie-Operationen (mit zum Teil katastrophalen Ergebnissen, z. B. bei der US-Präsidentenschwester Rosemary Kennedy, 1918-2005). Dabei wurden die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen durchtrennt, um psychische Erkrankungen, v. a. solche mit starker Unruhe, zu beeinflussen. Häufig wurden außerdem Elektroschocks (Elektrokonvulsionstherapie ECT; 1938 von Ugo Cerletti, 1877-1963, entwickelt) angewendet. All dies konnte die Hoffnung auf vollständige Heilung nicht erfüllen, schaffte aber teilweise eine Symptombekämpfung.
Unterbrochen vom barbarischen Rückfall in der NS-Zeit, in der man psychisch Kranke als „Ballastexistenzen“ bezeichnete und sie zumindest sterilisierte, meist aber in „Euthanasie“programmen umbrachte, wurden allmählich aus Irrenärzten Nervenärzte bzw. Psychiater und aus der Psychiatrie eine mit der Neurologie verschwisterte akademische Disziplin. Da (Zwangs)psychiatrie im Laufe der Geschichte immer wieder als Herrschaftsinstrument eingesetzt wurde, das unter dem Deckmantel der medizinischen Hilfe Menschen inhaftierte, zum Verschwinden brachte und/oder misshandelte, bildete sich in den 60er-Jahren des 20. Jhdts. eine Protestbewegung und eine antiautoritäre Antipsychiatrie, deren Ziel u. a. in der Reintegration von psychisch kranken Personen bestand. Vertreter waren u. a. Franco Basaglia (1924-1980), der die katastrophalen Umstände, unter denen in Italien „behandelt“ wurde, anprangerte und eine offene Psychiatrie forderte, oder Ronald David Laing (1927-1989), der argumentierte, dass psychische Erkrankungen eine kreative und angepasste Reaktion auf die Welt seien. (Vgl. Zitat von Vincent van Gogh, 1853-1890: „Die Normalität ist eine gepflasterte Straße, man kann gut darauf gehen. Doch es wachsen keine Blumen auf ihr.“) Auch psychiatriekritische Filme wie Einer flog über das Kuckucksnest (One flew over the cuckoo's nest 1975; alle 5 Hauptoscars 1976) oder Zeit des Erwachens 1990 (nach dem Buch Awakenings von Oliver Sacks, 1933-2015; 3 Oscarnominierungen) verstehen sich in diesem Zusammenhang. Vorläufer waren Thomas Szasz (1920-2012), der 1961 vom Mythos der mentalen Erkrankungen sprach, die er für „problems in living“ hielt, die nicht objektiv verifizierbar seien (statt den Betroffenen zu helfen, würden stigmatisierende und marginalisierende Bezeichnungen für Situationen, für deren Bewältigung die Kapazität der Klienten, deren emotionales Leben in den Vordergrund gerückt werden müsse, nicht ausreiche, gefunden werden), und das 1961 erschienene Buch Wahnsinn und Gesellschaft: Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft des französischen Philosophen Michel Foucault (1926-1984). Die Sozialpsychiatrie ging davon aus, dass das gesellschaftliche Umfeld größeren Einfluss auf die Krankheit habe als biologische Dispositionen.
Spätestens in den 70er-Jahren des 20. Jhdts. trennten sich Neurologie und Psychiatrie voneinander, der Begriff „Nervenarzt“ verschwand. (Neurologen sehen jedoch immer noch mehr psychiatrische Krankheitsbilder als Psychiater rein neurologische.) Mitte bis Ende desselben Jhdts. verlor der Gang zum Psychiater bzw. zum Psychotherapeuten (zunächst in den USA) seinen Tabucharakter und erfolgte nun immer öfter freiwillig. In Österreich gab es 2010 nur noch ca. 22 000 unfreiwillige Unterbringungen bei insgesamt 1,3 Mill. Belegungstagen pro Jahr, allerdings kaum grundlose. (Zum Vergleich: ca. 4000 Gefängnisinsassen. Nach dem - etwas vereinfachenden - Gesetz von Lionel Sharples Penrose - s. o. - ist die Anzahl der Gefängnisinsassen zu der von Psychiatrierten verkehrt proportional. Die Anzahl der gerichtlichen Verurteilungen - nur ein geringer Teil muss ins Gefängnis - sinkt allerdings in Österreich stetig: 2020 gab es mit 23 716 Fällen - 84,7% Männer, 41% Ausländer, 37% Vermögensdelikte, 15% Suchtmitteldelikte, 0,002% Morde - einen historischen Tiefstand.)
-
Basisinformationen:
Unabhängig von jeder Schule (mit Ausnahme der
auf Psychopharmaka setzenden biologischen Therapieformen) scheint als „Common
factor“ (allgemeiner Wirkfaktor, zum ersten Mal von Saul
Rosenzweig,
1907-2004, vermutet und nach
Alice im Wunderland von Lewis
Caroll,
1832-1898,
Dodo-Bird-Verdict - alle können
gewinnen - genannt), der mit 30-70% beziffert wird, vor allem
die therapeutische Allianz
(beschreibt das Bindungs- und Vertrauensverhältnis zum Therapeuten, der Glaube
des Patienten an Hilfe und das Erleben von Empathie) durch beidseitige
Oxytocinausschüttung und die Veränderungsbereitschaft der Klient/innen heilsam zu wirken. Therapie, letztlich ein Lernprozess, ist umso wirksamer, je
besser dieses „Arbeitsbündnis“ (Gerhard Roth,
s. o.)
funktioniert, je früher sie beginnt, je leichter die Störung ist und je später
diese eingesetzt hat.
Therapieziel sollte - um Enttäuschungen zu vermeiden - realistischerweise nicht Heilung, sondern Zustandsbesserung durch Überlernen, nicht (unmögliches) Löschen alter Gedächtnisinhalte, sondern ein autonomeres Leben sein. Therapie ist somit ein „lang anhaltendes Einüben neuer Einstellungen und Verhaltensweisen“ mithilfe von „emotionalem Aufruhr“ (Roth). Die Basisverdrahtungen werden sich nur noch verstärken (oder schwächen), aber nicht mehr verändern lassen (s. a. o.: Neuroplastizitätshypothese). Immerhin kann so die funktionale Dynamik des Gehirns (wie ev. auch durch die Meditation) verändert werden. Vor jeder Therapie müsse die Therapiebedürftigkeit feststehen, die (noch) nicht gegeben sei, wenn nicht „wesentliche menschliche Funktionen lädiert sind“ (wie Ausübung eines Berufs, Liebesfähigkeit, Entwicklung von Interessen etc). Von einem gesunden Menschen müsse man erwarten können, dass er mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig werde, meint Otto F. Kernberg, der auch sagt: „Gesunder Menschenverstand ist der Anfang guter Psychotherapie.“
* Allgemeines: Die Wahl der Therapie hängt von der Interpretation der Krankheit, also dem ätiologischen (die Herkunft betreffenden) Erklärungsmodell ab (s. o. Ursachengruppen). Die einzelnen Therapieschulen (in Österreich waren 2019 etwa 2 Dutzend anerkannt) stellen jeweils einen anderen Aspekt in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen. Die Therapie der Wahl für einen spezifischen Persönlichkeitstyp zu finden erfordert oft einen längeren Zeitraum (und höheren Geldaufwand - 2020 etwa für 50 Minuten ca. 70 € bis 200 €). Etwa 200 000 Österreicher sind zu jeder Zeit in psychologischer Betreuung - einerseits bei Fachärzten für Psychiatrie und Neurologie, andererseits bei Psychologen, deren gesetzliche Grundlage das Psychotherapiegesetz von 1991 ist. (Davor liefen Nicht-Mediziner Gefahr, nach dem Kurpfuscherparagraphen - s. hier - verklagt zu werden.) Dort wird deren Ausbildung in einem Propädeutikum (765 h Ausbildung + 550 h Praktikum) und einem Fachspezifikum (300 h Theorie + 1600 h Praxis) geregelt. (Die Ausbildungsgrundlagen wurden 2024 - geltend ab 2026 - in Richtung Akademisierung novelliert und kann in Wien auch an der Universität oder der SFU erfolgen; s. hier für das deutsche Psychotherapiegesetz.)
Die Frage der Laienanalyse (ob auch
Nicht-Ärzte zu einer psychotherapeutischen Ausbildung zugelassen werden sollten)
wurde bereits 1926 von Sigmund Freud
in einer gleichnamigen Schrift diskutiert und bejaht. Anlass war eine Anklage
gegen seinen von ihm auch finanziell unterstützten Lieblingsschüler Theodor
Reik (1988-1969), der als
Religions- und Literaturwissenschaftler (seine 1912 erschienene Doktorarbeit
Flaubert und seine „Versuchung
des heiligen Antonius“ war
die erste psychoanalytische Literaturstudie) die Psychoanalyse erlernte.
Vgl. auch
Psychologische Diagnostik auf Krankenschein
1,
2 - Zur psychotherapeutischen
Versorgung der österreichischen Bevölkerung s.
Analyse der Versorgung psychisch Erkrankter und die folgenden (etwas
veralteten) Graphiken:
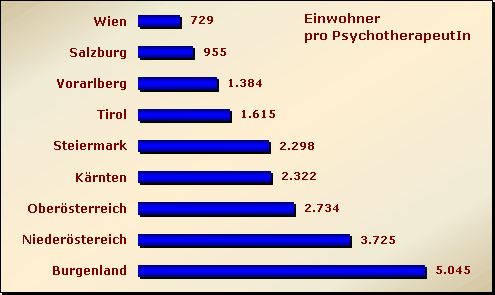
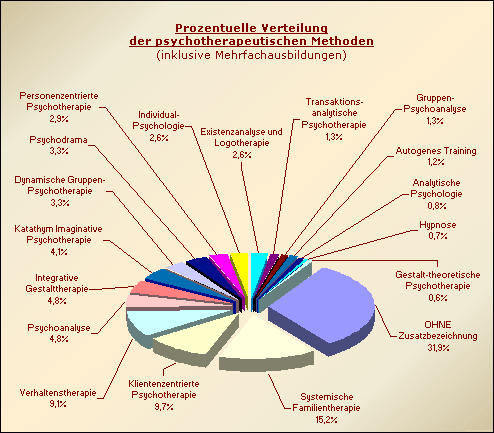
Abb. 4/8 und Abb. 4/9: Beide Abbildungen nach https://www.psyonline.at/
* Erfolgsrate: Man rechnet (vermutlich zu optimistisch gesehen) mit insgesamt etwa 1/3 Heilungen (die dann gegeben sind, wenn die Patient/innen die Diagnosekriterien nicht mehr erfüllen), 1/3 kann zumindest zeitweise ein einigermaßen autonomes Leben führen, 1/3 bleibt therapieresistent und z. T. stationär. (Der Verlauf von Behandlungen in psychiatrischen Anstalten wird oft - pessimistisch gesehen - nach dem Drehtürschema beschrieben: nach der Therapie vorne hinaus, nach Rückfällen hinten wieder herein.) Die Erfolgsrate hängt stark von der Art der Störung und Parametern wie dem Gelingen einer therapeutischen Allianz, der verstrichenen Zeit zwischen Ausbruch und Behandlung einer Störung und den mitgebrachten Voraussetzungen ab. (Das 2008 in Großbritannien implementierte und konsequent evaluierte IAHT-Programm - Improving Access To Psychological Therapies -, das v. a. für Angststörungen und depressive Verstimmungen geschaffen wurde, schaffte in manchen Jahren im Durchschnitt aller Krankheitsbilder ca. 50% Heilungen.)
* Medizinische Ethik: Jede Behandlung von Patient/innen orientiert sich (sollte sich orientieren) an folgenden 1979 von Tom Lamar Beauchamp (1939-2025) und James Franklin Childress (*1940) entwickelten
4 Prinzipien der medizinischen Ethik:
| ° | Gerechtigkeitsprinzip: Hilfe sollte nach dem Motto „Alle Menschen müssen gleich behandelt werden“ bekommen, wer sie am dringendsten benötigt (und nicht, wer - bei womöglich begrenzten Ressourcen - mehr Geld oder Einfluss geltend machen kann, um eine Vorreihung zu bewirken.) |
| ° | Selbstbestimmungsprinzip: Hilfe sollte bekommen, wer ihr informiert zustimmt und das Recht auf Ablehnung, Abbruch oder Änderung der Therapie nicht in Anspruch nimmt. (Da dieses Prinzip geistige Autonomie voraussetzt, ist seine Anwendung bei psychisch Erkrankten manchmal problematisch.) |
| ° | Primum non nocere-Prinzip: Nach dem hippokratischen Eid soll jede Therapie zunächst einmal keinen Schaden anrichten, dann Vorsicht walten lassen und erst drittens heilen. (Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare) |
| ° | Fürsorgeprinzip: Unter Berücksichtigung aller (individueller) Umstände soll die jeweils bestmögliche Behandlung ausgewählt werden. (Dieses Prinzip steht in gegensätzlichem bzw. ergänzenden Zusammenhang zu primum non nocere.) |
* Probleme der Betreuer: Um Konflikten und Stress vorzubeugen, unterziehen sich viele Therapeuten (und andere Sozialarbeiter) einer Supervision (lat. „Überblick“; vgl. für Österreich Seite 1, 2). Es handelt sich um therapieähnliche Sitzungen im Einzel- oder Gruppensetting unter der Leitung außenstehender geschulter Personen, in denen berufsbedingte Probleme mit dem Ziel einer Entlastung erörtert werden können. (Eine Beratung ohne Therapieanspruch nennt man Coaching.)
Unterbleibt die Supervision, zeigt sich im Sozialbereich oft das Phänomen der „Hilflosen Helfer“ (Begriff von Wolfgang Schmidbauer, *1941): Darunter werden Menschen verstanden, die in ihrem Über-Ich das Ideal verinnerlicht haben, dass man nur dann gut sei, wenn man Anderen - Schwächeren, Kranken, Benachteiligten oder Bedürftigen - helfe, und die, da Frustrationen nicht ausbleiben können, als Folge selbst Therapie benötig(t)en. Eine überstarke Ausprägung des Helfersyndroms (wenn das Wohlergehen der Klienten grundsätzlich als wichtiger eingestuft wird als die eigene Befindlichkeit des Helfers) führt zu einem Gefühl der Leere und des Ausgebrannt-Seins. (Nach zwei Jahren sozialer Tätigkeit entsteht daher oft der Wunsch nach einem Berufswechsel.)
Dieses Burn-out-Syndrom (auch Burnout; vgl. auch die unten stehende Graphik), das häufig in Sozialberufen, aber auch in anderen Zusammenhängen auftritt, zeigt nach dem 1981 entwickelten Maslach Burnout Inventory MBI von Christina Maslach (*1946; 1972-2024 die 2. Frau von Philip Zimbardo, s. u.) und Susan E. Jackson (*1952)
3 Symptome:
| ° | chronische, emotionale Erschöpfung, die auch nach einigen Tagen Erholung nicht schwindet |
| ° | Depersonalisierung, die sich oft in Zynismus und Widerwillen gegenüber der Arbeit oder Kollegen und Vorgesetzten äußert |
| ° | mangelnde Leistungszufriedenheit (geringe Effizienz trotz hohem Arbeitseinsatz). |
Den Begriff „Burn out“ führte Herbert Freudenberger (1926-1999) 1974 in die Psychologie ein. (Kurt Lewin hatte schon 1928 auf einen Zusammenhang zwischen der von seiner finnischen Schülerin Anitra Karsten, 1902-1988, untersuchten psychischen Sättigung und einer „Erschöpfung des Berufswillens“ hingewiesen.) Er findet sich im ICD ab Version 10 (aber nicht im DSM), in Version 11 unter dem Code QD85. Nach der Effort-Reward-Imbalance-Therorie von Johannes Siegrist (*1943) entstehen Stress im Arbeitskontext und als Folge das Burn-out-Syndrom dadurch, dass die betroffenen Personen über einen längeren Zeitraum das Gefühl haben, dass ihren Anstrengungen nicht die entsprechenden Wirkungen folgen. (Wenn dies nicht auf Überforderung, sondern auf Unterforderung zurückzuführen ist, spricht man von „bore out“.) Objektive und subjektiv empfundene Leistungsreduktion wird begleitet bzw. verursacht von einem Entfremdungsgefühl gegenüber der Arbeit, gegenüber den Kolleg/innen und sich selbst gegenüber. Ein weiterer Faktor besteht darin, die Batterien nicht mehr aufladen zu können. (So haben z. B. - wie viele in Sozialberufen Tätige - über 40% der Lehrer/innen - und damit doppelt so viele Personen wie im Bevölkerungsdurchschnitt - Probleme, sich in ihrer Freizeit gedanklich von der Arbeit zu lösen.) Dies alles kann auch zu Depressionen (s. o.) führen - „man spürt nichts mehr“.
Meist lassen sich drei Phasen unterscheiden: Die 1. Phase kann Symptome wie erhöhte Gereiztheit, Schlaf- und Sexualstörungen, Schwierigkeiten beim Erbringen der üblichen Leistung und Aggressivität zeigen, die aber noch nicht als Belastung oder gar als Krankheit wahrgenommen werden. In der 2. Phase werden die Symptome deutlich und störend, Beziehungsschwierigkeiten und Angstzustände bei der Unmöglichkeit einer Spannungslösung können auftreten, im Sport lässt sich z. B. ein Verlust der Automatismen (etwa beim Tennisaufschlag) beobachten. In der 3. Phase (die es durch rechtzeitiges Einschreiten zu vermeiden gilt) ist Regeneration ohne Therapie nicht mehr möglich, eine Erschöpfungsdepression und das -losigkeitsgefühl (so Michael Musalek, s. o.; Freudlosigkeit, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit etc.) tritt ein, ein Zusammenbruch bzw. der Übergang in eine veritable Depression (s. o.) ist möglich.
Nach genaueren Untersuchungen in den 2020er-Jahren leiden in Österreich ca. 30%-40% der Bevölkerung an potentiellen Burnout-Konstellationen (schlechtes Arbeitsklima, das Wertesystem der Umgebung stimmt nicht mit dem eigenen überein, „Brennen“ und hoher Leistungsanspruch an sich selbst, aber mangelnde Anerkennung, da der Erfolg, aber nicht die eigene Leistung geschätzt wird etc.), etwa 8% erleben die 3. Phase.
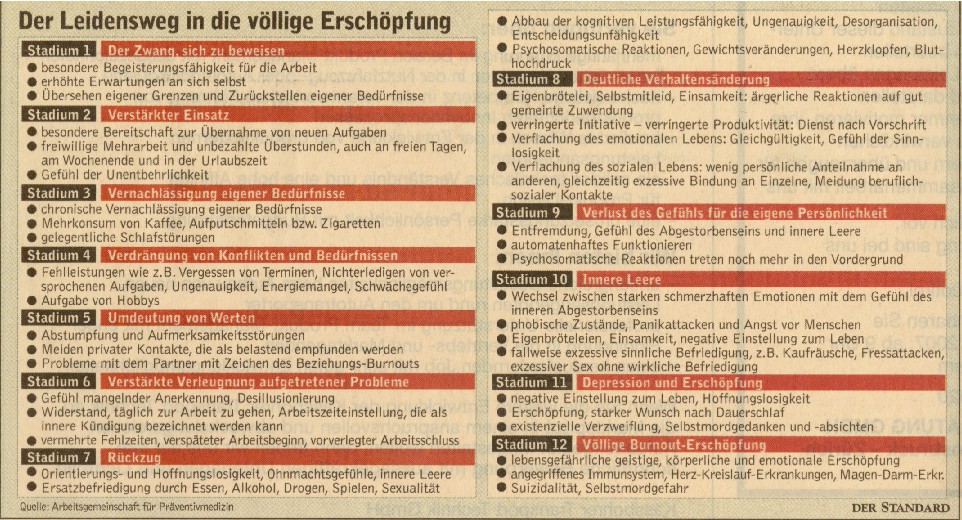
Abb. 4/10: Burn-out-Syndrom (aus: Der Standard 17./18.3.2007)
Mit dem Burn out verwandte Syndrome sind das Imposter-/Impostor-Syndrom (die Betroffenen leiden trotz beruflicher Erfolge unter tw. sehr starkem Selbstzweifel und dem Gefühl, Hochstapler zu sein und unverdient gelobt zu werden, bzw. dass externe Faktoren und nicht ihre Leistung für den positiven Outcome verantwortlich gemacht werden müssten; sie haben Angst „aufzufliegen“) und das Floating Duck-Syndrom (die Betroffenen kämpfen und verkrampfen innerlich, obwohl sie äußerlich ihre Arbeit völlig souverän bewältigen - ähnlich einer Ente, die mühelos dahingleitet, aber unter der Oberfläche hektisch paddelt). Zugrunde liegt jeweils eine bestimmte Art von Perfektionismus.
* Psychopharmaka: Nicht-psychologische medizinische Interventionen (die aus der Psychiatrie nicht wegzudenken sind, hier aber nicht weiter besprochen werden) bestehen in der weithin verbreiteten Verabreichung von psychoaktiven Arzneistoffen wie z. B. Lithiumsalzen oder selektiven Serotoninwiederaufnahehemmern. (Bekannt wurde etwa das 1987 zugelassene und seither meistverkaufte Psychomedikament Prozac / Fluctin, das den Wirkstoff Fluoxetin enthält, der bei Depressionen eingesetzt wird, um den zu schnellen Abtransport des Neurotransmitters Serotonin aus dem synaptischen Spalt zu blockieren; vgl. a. o. ADHS. Eine neuere Entwicklung brachte etwa 2025 zugelassene Antipsychotika gegen Schizophrenie mit Depotwirkung hervor: der Wirkstoff wird über einen längeren Zeitraum gleichmäßig abgegeben.)
In vielen Fällen sind Psychopharmaka unumgänglich, es gilt aber immer zu beachten, dass eine individuelle Auswahl aus dem pharmazeutischen Angebot sowie eine individuelle Dosierung vorgenommen werden muss (abhängig vom Geschlecht, physischen Parametern, der - oft überschätzten - Geschwindigkeit, mit der die Person die Wirkstoffe abbaut und vielem mehr). Der Siegeszug der Psychopharmaka erfolgte in der 2. Hälfte des 20. Jhdts. Er bewirkte, dass die Anzahl der Patienten in psychiatrischen Anstalten drastisch sank, verführte aber dazu, die Wirkung statt der Ursache zu bekämpfen. Gefahren bestehen in den Nebenwirkungen und möglicherweise hervorgerufener Abhängigkeit. (Es gilt, Nutzen und Kosten abzuwägen.)
* Krisenintervention: Darunter versteht man das therapeutische Handeln im Akutfall bei drohenden Belastungsstörungen (s. o.), z. B. zur Stabilisierung Überlebender nach Gefahrensituationen wie z. B. dem School Shooting in Graz am 10.6.2025, nach Unfällen etc., um nachfolgenden psychischen Katastrophen vorzubeugen. Ziel ist es vor allem, nach einem Schock Sicherheit zu geben, dabei zu unterstützen, die erste Phase gut zu überstehen, und Hilfe anzubieten, um letztlich die Handlungsfähigkeit der Klienten wiederherzustellen. Eine mögliche fünfstufige Vorgangsweise beschreibt Gernot Sonneck (*1942) in seinem
Bella-Modell:
| ° | Beziehung aufbauen |
| ° | Erfassen der Situation |
| ° | Linderung von Symptomen |
| ° | Leute einbeziehen, die unterstützen können |
| ° | Ansätze zur Problembewältigung in konkreten Schritten entwickeln |
In allen entwickelten Staaten existieren (tw. rund um die Uhr besetzte) Kriseninterventionszentren, z. B. der 1979 von Stephan Rudas, 1944-2010, u. a. gegründete PSD Wien (ein sozialpsychiatrischer Notdienst), das KIZ Wien, die Telephonseelsorge und andere ähnliche Einrichtungen. Wie immer im Bereich der Medizin empfiehlt es sich, zusätzlich präventiv vorzugehen.
Mit Ersthelferprogrammen (z. B. MHFA) sollen akute psychische Notfälle (oft schon am Einsatzort) frühzeitig erkannt bzw. im Idealfall überhaupt vermieden werden. Als Gesprächstechniken werden im Rahmen dieser psychologischen Ersten Hilfe Defusing (strukturiertes Gespräch zur Reduzierung des emotionalen Stresses im Anschluss an das Trauma) und Debriefing (Aufarbeitung des Traumas durch Ausnützen kognitiver Bewältigungsmechanismen einige Tage später) eingesetzt. Es gilt dabei, Warnsignale (Rückzug aus dem Freundeskreis, Schweigsamkeit, Müdigkeit, Freudlosigkeit, innere Unruhe, psychosomatische Beschwerden etc.) zu erkennen, um Betroffene rasch einer professionellen Hilfe zuzuführen. („Therapie“ soll nie durch Bekannte oder Freunde erfolgen, man würde ja auch - frei nach Rudas - nicht auf die Idee kommen, bei einem offenen Oberschenkelbruch eines Freundes auf der Skipiste den Knochen selbst zu nageln.) Es gilt, die Zeit zwischen dem Auftreten von ersten Symptomen und dem Ausbruch einer ernsthaften Krise (manchmal erst nach fünf und mehr Jahren) frühzeitig zu nützen. (Im privaten Bereich gelang es dem Australier Donald Taylor Richie, 1927-2012, einem Anrainer der Klippen von Sydney - heute Gap Park -, im Laufe von Jahrzehnten Hunderte Suizidanten ins Leben zurückzuführen, indem er sie als solche erkannte, anredete und in sein Haus einlud.)
Im Folgenden werden die drei wichtigsten Richtungen der Psychotherapie und deren Schulen dargestellt. (Zu Fallbeispielen s. hier.)
-
Psychodynamisch orientierte Therapieformen:
Darunter werden alle Methoden
verstanden, die auf einem Menschenbild basieren, das davon ausgeht, dass sich
die aus der Triebenergie gespeisten innerseelischen Kräfte auf verschiedene
Weise als Reaktion auf äußere und innere Erlebnisse und Reize prozesshaft
(dynamisch) verändern können. Gemäß dieser Annahme existiere ein - nach Freud
alogischer, widersprüchlicher und zeitloser - unbewusster Bereich, der unser
Erleben und Verhalten bestimme. Der Mensch unterliege unbewussten
Determinationen. (Der Begriff „Psychodynamik“ entstand analog dem knapp davor
geprägten und ebenfalls auf Energie bezogenen Begriff „Thermodynamik“.)
Kritik (s. a. u.): Die Grundannahme entspreche nicht wissenschaftlichen Grundsätzen und schotte sich gegenüber Kritik ab, da sie zwar jedes menschliche Verhalten ex post erklären könne, sich aber Voraussagen gegenüber nicht exponiere (also nicht dem Falsifikationskriterium von Karl R. Popper, 1902-1994, genüge, wonach eine Aussage nur dann wissenschaftlich sei, wenn es einen Fall gebe, der sie bei seinem Eintreten widerlegen würde). Zusätzlich hat die Entwicklung der Neurowissenschaften manche Annahmen obsolet werden lassen (vgl. z. B. hier).
Einzelne Schulen:
* Psychoanalyse:
entwickelt
von Sigmund Freud
(s. Bilder); geb. 6. 5. 1856 in Freiberg in Mähren; gest. 23. 9. 1939 in London.
Psychiatrische Ausbildung in Wien, Freundschaft mit Josef
Breuer (1842-1925), einem 14 Jahre älteren
Nervenarzt und für Freud der
„Vater der Psychoanalyse“, dessen Behandlung der 1880 an durch eine Kränkung
durch den Vater hervorgerufenen hysterischen Lähmungen erkrankten Bertha
von Pappenheim („Anna
O.“, 1859-1936; Freud
anonymisierte durch Herabsetzung der Buchstabenreihe für die Initialen um 1) zur Geburtsstunde der Psychoanalyse wurde. (Mit
Breuer veröffentlichte Freud 1895
die bahnbrechenden Studien über Hysterie.) Hypnose-Ausbildung bei Charcot,
der
in Paris mit dieser Methode Neurosen erforschte. Freud entdeckte die
schmerzstillende Wirkung von Kokain. Seit 1885 Dozent, seit 1902
Titularprofessor in Wien, nie ordentlicher Professor. Seit 1886 mit Martha
Bernay (1861-1951) verheiratet;
fünf Kinder: bekannt v. a. die Tochter Anna
Freud (s. u.),
die sich als seine Nachfolgerin sah. England-, Amerikareisen. 1930 Goethe-Preis der Stadt Frankfurt (nach Johann
Wolfgang
von Goethe,
1749-1832). 1933 Verbrennung der Werke Freuds
durch die NSDAP in Berlin. 1938, bereits mit fortgeschrittenem Mundhöhlenkrebs,
Emigration nach London, wo er noch bis 1939 praktizierte. Seit 1923 33
Krebsoperationen. Tod durch eine Überdosis Morphium. 1971 im Beisein von Freuds
Tochter Anna Eröffnung des auf Initiative von
Friedrich Hacker
(s. o.)
entstandenen Freud-Museums
in 1090 Wien, Berggasse 19, den ehemaligen Ordinationsräumlichkeiten
(Wiedereröffnung nach Totalrenovierung 2020), 1986
Eröffnung des Freud-Museums
in London (in jenem Haus, das Freuds
Sohn für seine exilierten Eltern gefunden hatte), 2006 Eröffnung des Freud-Museums
in Přibor (dt. Freiberg in Mähren).
Zur Einführung vgl. das Video
„Die Erfindung der
Psychoanalyse“, eine Beurteilung der Theorien Freuds
aus neurobiologischer Sicht findet sich
hier.

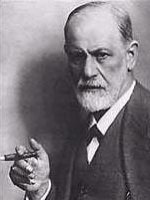

Abb. 4/11, Abb. 4/12 und Abb. 4/13: Sigmund Freud in verschiedenen Lebensphasen
Bei der Psychoanalyse handelt es sich um eine Technik, die es mit Hilfe der vier Zugangsmöglichkeiten zum Unbewussten (s. o.) ermöglichen soll, die verdrängten Es-Ansprüche (s. u.) bloßzulegen und durch den jetzt offenen Kausalzusammenhang der psychischen Krankheit die Grundlage zu entziehen. Der Klient liegt dabei auf der berühmt gewordenen Couch (das Original steht in London: Bild), an dessen Kopfende - um die Hemmschwelle zu verringern, nicht mehr im Blickfeld - der Analytiker sitzt, der mit Techniken wie der von Freud zunächst als Störeinfluss betrachteten Gegenübertragung (= das Sich-zunutze-Machen der Übertragung - alte, oftmals verdrängte Gefühle, Affekte, Erwartungen, Wünsche und Befürchtungen aus der Kindheit werden vom Patienten unbewusst auf neue soziale Beziehungen - auch auf den Analytiker - übertragen und reaktiviert -, indem der Therapeut als Reaktion auf die Übertragung seinerseits sein Inneres auf den Klienten richtet) eine Talking cure (der Begriff stammt von Anna O.) praktiziert.
Die Psychoanalyse wurde schon zu Lebzeiten Freuds kritisiert, z. B. von Karl Kraus (1874-1936: „Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.“ - Eine gewisse Psychoanalyse ist die Beschäftigung geiler Rationalisten, die alles in der Welt auf sexuelle Ursachen zurückführen mit Ausnahme ihrer Beschäftigung.), aber auch weiterentwickelt. (Bekannt geworden sind die im Rückgriff auf strukturalistische Prinzipien entstandenen Neuinterpretationen von Jacques Lacan, 1901-1981; s. u.). Heute werden der Psychoanalyse vor allem fehlende Effizienzstudien (etwa im Gegensatz zur Verhaltenstherapie), die Unvereinbarkeit mit manchen Befunden der Neurowissenschaften (vgl. z. B. hier) und das Festhalten an nicht mehr zeitgemäßen Anschauungen Freuds vorgehalten. Eysenck (s. u.) behauptete, dass Freuds Therapie nicht mehr Wirkung hätte als gar keine Therapie. Dennoch gilt sie als eine der wirkmächtigsten und kulturell fruchtbarsten Theorien aller Zeiten und als wichtiger intellektueller Beitrag zum Verständnis der Welt. Die Zeit von 1885 bis 1890 wird im Film Freud von John Huston (1906-1987; Hauptdarsteller Montgomery Clift, 1920-1966) von 1962 dargestellt, dessen Drehbuch ursprünglich Jean Paul Sartre (1905-1980) konzipiert hatte.
Szenenfolge des Films Freud (47 Szenen tw. mit Rückblenden und Traumsequenzen):
| Einleitung „3 Kränkungen“ (s. o.; Erzähler) / AKH 1885 (Theodor Meynert, 1833-1892, Freud) / Zukunftspläne (Freud, Mutter Amalia Freud, 1835-1930) / Bahnhof, Abfahrt nach Paris (Freud, Mutter, Vater Jacob Freud, 1815-1896, Verlobte Martha Bernay, 1861-1951) / Versuche in Paris (Charcot, Freud als Hörer) / Hochzeit (Freud; Martha, Familie) / Erster Vortrag vor der Wiener Ärzteschaft (Freud, Meynert, Breuer u. a.) / Bei Koertners (Freud, Breuer, Cäcilie und ihre Mutter) / Verabredung einer Zusammenarbeit (Freud, Breuer) / Arbeit am Fall (Freud, Patient) / Arbeit am Fall (Freud, Cäcilie) / Reflexionen über Neurosen auf einem Spaziergang (Freud) / Arbeit am Fall (Freud, Patient von Schlosser) / Erste Traumsequenz (Freud u. a. in einer Höhle) / Erwachen aus dem Traum (Freud, Martha) / Vor von Schlossers Haus (Freud, Portier) / Gespräch über den Zusammenhang von Neurose und Sexualität (Freud, Breuer) / Zwei Versionen über den Tod von Cäcilies Vater (Freud, Breuer, Cäcilie) / Besorgte Gespräche über Freuds Arbeit (Freud, Martha, zu Beginn auch Breuer) / Abschied Breuers von Cäcilie (Freud, Breuer, Cäcilie und ihre Mutter) / Scheinschwangerschaft Cäcilies (Freud, Breuer, Hausarzt, Cäcilie) / Nachricht vom Schlaganfall von Freuds Vater (Freud, Martha, dann Schwester Marie („Mitzi“) Freud, 1861-1942 (ermordet in Treblinka) / Kollaps auf dem Weg zum Begräbnis des Vaters (Freud) / Zweite Traumsequenz (Freud, „Die Augen werden geschlossen“) / Erwachen aus der Ohnmacht und Gedanken über das Deuten von Träumen (Freud, Martha, Breuer) / Nochmals zum Friedhof (Freud, Breuer) / Neurosentheorie während einer Kutschenfahrt (Freud, Breuer) / Fehlleistungen (Freud, Cäcilie) / Über Liebe (Freud, Martha) / Freies Assoziieren (Freud, Cäcilie, Puppe mit eingestreuter Traumsequenz: Rotenturm-Straße) / Reflexionen über das Gehörte im Freien (Freud) / Couchposition (Freud, Cäcilie mit Rückblick: Rotenturm-Straße) / Im Freien: Reflexionen über den Sexualtrieb (Freud) / Diskussion über die Sexualtheorie (Freud, Breuer) / Rückblick auf Cäcilies Kindheit (Freud, Cäcilie und im Rückblick ihre Eltern) / Im Freien: Reflexionen über das Gehörte (Freud) / Gespräch über die Kindheit (Freud, Mutter) / Vor dem Haus der Koertners: Cäcilie ist weg (Freud, Portier) / Rotenturm-Straße, Suizidversuch Cäcilies (Freud, Cäcilie) / Allein daheim (Freud, mit dritter Traumsequenz: Höhle und Rückblende auf Breslau), dann Entwicklung der endgültigen Theorie (mit Martha) / Gespräch mit Cäcilies Mutter (Freud, Frau Koertner) / Übertragung Cäcilies Gefühle auf Freud (das letzte verbliebene Symptom: „Deine Liebe zu mir“; Freud, Cäcilie, mit Rückblenden) / Zweiter Vortrag Freuds vor der Wiener Ärzteschaft über die psychosexuellen Phasen löst Empörung aus (Freud, Breuer u. a.) / Friedhof, Schlussworte: „Erkenne dich selbst“ / Schlussbild wie Beginn (Erzähler) |
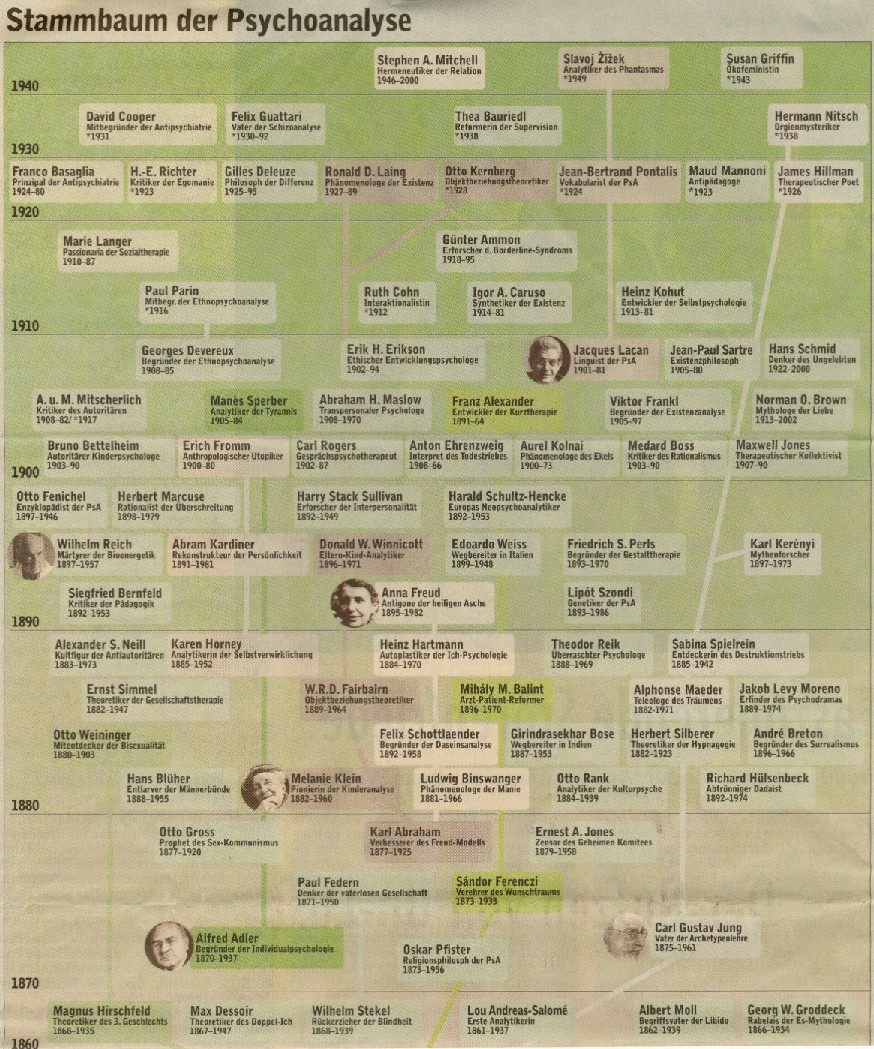
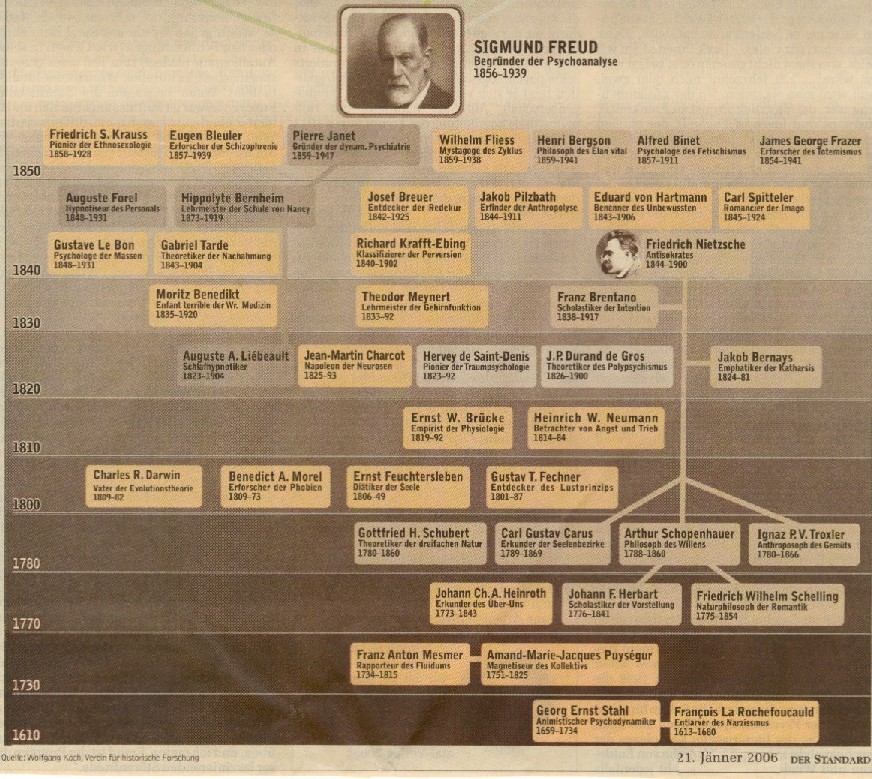
Abb. 4/14: Stammbaum der Psychoanalyse (Scan aus: Der Standard)
| ° | Abwehrmechanismen: s. o. |
| ° | Zugänge zum Unbewussten (mit Traumdeutung): s. o. |
| ° |
Psychische Provinzen: Die Persönlichkeit besteht nach Freud
(1923 in Das Ich und das Es -
s. hier - erstmals zusammenhängend dargestellt)
aus drei Hauptsystemen psychischer Energien, die in dynamischer
Wechselwirkung stehen und das Verhalten des Individuums beeinflussen: + Id (Es): alles Ererbte, die biologische Ausstattung, v. a. die Triebe; älteste Provinz + Ego (Ich): unbewusst - bewusstes Selbst, Vermittler zwischen Es und Über-Ich + Super-Ego (Über-Ich): internalisierte Normen und Ideale; „Aufsichts-Organ“, „Gewissen“; durch Introjektion (das frühere Außen wird zu einem Innen) entstanden (= Topisches Persönlichkeitsmodell; der Ausdruck „Es“ stammt von Georg Groddeck, 1866-1934, bekannt für seinen Wahlspruch „Natura sanat, medicus curat“ und vermutlich Vorbild für Dr. Krokowski im Zauberberg von Thomas Mann, 1875-1955, Nobelpreis 1929, der Ausdruck „Über-Ich“ von Freud selbst.) Im Zusammenwirken dieser drei Instanzen, von denen zwei Einflüsse der Vergangenheit repräsentieren (das Es - es handelt nach dem Lustprinzip - solche der Phylogenese, das Über-Ich - es handelt nach Sollens- oder Moralitätsprinzipien - solche der Ontogenese), eine durch das gerade Seiende bestimmt wird (das Ich - es handelt nach dem Realitätsprinzip und hat nach Freud die „Stellung eines konstitutionellen Monarchen, ohne dessen Sanktion nichts Gesetz werden kann, der es sich aber sehr überlegt, ehe er gegen einen Vorschlag des Parlaments sein Veto einlegt“), entsteht das Seelenleben des Menschen. Psychische Krankheiten entstehen nach Freud dadurch, dass die Ansprüche des Es durch das Über-Ich zurückgedrängt werden und daher nicht ausgelebt werden können. Sie wirken aber aus dem Unbewussten weiter und bewirken z. B. Neurosen (Dynamisches Persönlichkeitsmodell): „Das Wesen der Neurose ist, dass das Ich (die Persönlichkeit) nicht imstande ist, die Forderungen des Über-Ich (des Gewissens) und die Triebkräfte (Es) auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.“ (Freud; zum Ökonomischen Persönlichkeitsmodell s. o.) |
| ° | Trieblehre: Triebe sind für die Psychoanalyse Quellen, aus denen die
Seele mit Energie versorgt wird. Hinter den Bedürfnisspannungen stünden laut
Freud zwei Grundtriebe, die
aber oft gleichzeitig vorhanden seien, sodass eine Störung des
Gleichgewichts zu psychischen Erkrankungen führen könne: + Eros (Lebenstrieb, dessen konstruktive Energie Libido genannt wird; strebt nach Vereinigung) + Thanatos (Todes-, Destruktionstrieb; wirkt gegenläufig; strebt nach Auflösung der Einheit) |
| ° | Entwicklung des Trieblebens: Freud unterscheidet fünf Phasen, die sich auf die jeweils erogenen Zonen (Lust spendende Areale) beziehen. Sexualität (ungleich genitale Lust) wird dabei als etwas von der Geburt an Vorhandenes und sich Entwickelndes gesehen. Die „ordnungsgemäße“ Absolvierung (keine zu exzessive Befriedigung, keine Frustration) der Phasen garantiert eine normale Weiterentwicklung. Andernfalls tritt Fixierung ein, die die Interaktion zwischen Kind und Umwelt behindert. In Freuds Sexualtherorie werden Perversionen und Neurosen als Fehler der Triebentwicklung interpretiert. |
| Die
psychosexuellen Phasen
nach
Freud
im einzelnen: + Oralphase: Der Mundbereich (Saugen etc.) steht im Mittelpunkt der Bedürfnisbefriedigung (ca. 0;0 bis 1;0). Bei Fixierung Abhängigkeit, Passivität, orale Neigungen, z. B. Rauchen, Schwatzen, Essen, das bis zur Adipositas (Fettleibigkeit) führen kann (nach Definition der WHO ein Wert von 30+, wenn bei Ermittlung des Body Mass Index das Körpergewicht in kg durch das Quadrat der Körpergröße in m dividiert wird; ab 25 = Übergewicht; vgl. o. Essstörungen). + Analphase: Lustgefühle durch Ausscheiden und Zurückhalten der Exkremente (ca. 1;0 bis 3;0). Bei Fixierung Pedanterie, Geiz, Tyrannei. Im Zuge der Erziehung zur Sauberkeit oft Regressionen. + Phallische Phase: Entdecken der primären Geschlechtsorgane als Lustspender (ca. 3;0 bis 6;0); nachfolgend gewinnt der Geschlechterunterschied an Bedeutung. Knaben leiden am Kastrationskomplex, Mädchen am Penisneid. In dieser Phase Ödipus- bzw. Elektrakomplex (das Kind fühlt sich zum andersgeschlechtlichen Elternteil hingezogen; vgl. Inzestmotiv in der Dichtung). Phasenfehler führen zu Minderwertigkeitskomplexen, Geltungssucht oder Unsicherheit. + Latenzphase: Libidinöse Triebansprüche treten in den Hintergrund (ca. 6;0 bis 12/14;0). + Genitalphase: Ab der Pubertät entwickelt sich die Erwachsenensexualität. Dem Genitalprimat müssen die bisherigen Partialtriebe untergeordnet werden. |
 Abb. 4/15:
Alfred
Adler
Abb. 4/15:
Alfred
Adler
*
Individualpsychologie: Konzept von Alfred
Adler (geb. 7. 2. 1870
im damals eigenständigen Rudolfsheim bei Wien; gest. 28. 5. 1937 in Aberdeen). Ophthalmologe, dann
Neurologe. Seit 1897 mit Raissa Timofejevna
(1872-1962), einer mit Trotzkij (Лев Давидович Бронштейн,
1879-Eispickelmord 1940)
bekannten Moskowiterin, verheiratet, vier Kinder. Naheverhältnis zum
Sozialismus. Schüler Freuds (erste
Begegnung 1902), 1911 Bruch und Gründung einer eigenen, später „Verein für
Individualpsychologie“ genannten Gesellschaft. Lehrtätigkeit am Pädagogium der
Stadt Wien und Erziehungsberater. Die Habilitation scheiterte 1912 am Widerstand
von Julius
Wagner von Jauregg
(1857-1940), dem einzigen Psychiater (wenn man von Eric
Richard Kandel, *1929
- s. o. -, absieht, der diesen Beruf nie ausgeübt hat), der je einen
Nobelpreis für Medizin erhielt (1927 für die
Anwendung des Malaria-Heilfiebers zur Behandlung von Progressiver Paralyse). Im
Ersten Weltkrieg Militärarzt. 1934 Übersiedlung nach Amerika, wo Adler
ab 1926 lehrte (seit 1929 an der Columbia University als Gastprofessor, ab 1932
am Long Island Medical College). Tod während einer Vortragsreise in Schottland auf offener Straße
an Herzversagen. Biographie von seinem Freund Manés
Sperber (1905-1984), der ihn ein „soziales
Genie“ nennt, 1970: Alfred Adler
oder das Elend der Psychologie.
Vgl. Österreichischer
Verein für Individualpsychologie
| ° | Grundideen: In der frühen Kindheit würden Leitlinien (eine Art von Schablonen) erworben, die ein Persönlichkeitsideal bildeten, das durch den Charakter (die dynamisch veränderbaren psychischen Bereitschaften) verwirklicht werde. Dabei spiele die Stellung innerhalb der Geschwisterreihe eine Rolle. Der Mensch strebe aus seiner frühkindlichen Hilflosigkeit nach Unabhängigkeit, um seine Lebensaufgaben erfüllen zu können. Im Zentrum der Lehre Adlers steht der Minderwertigkeitskomplex (z. B. aufgrund einer empfundenen oder tatsächlichen Organminderwertigkeit). Er bedinge einen falschen Lebensplan, wenn ein geglückter Lebensplan aufgrund von fehlendem oder mangelndem Selbstwertgefühl nicht zustandekomme. Aus diesem würden sich kompensatorischer Geltungsdrang bzw. als Selbstschutz angenommene starre Charakterzüge ergeben, was sich in Arrangements (dies seien „fiktive Leitlinien“) kundgebe. V. a. der Machttrieb (vgl. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, „Wille zur Macht“), symbolisiert durch den Turmbau zu Babel, steuere den Menschen. Bleibe er erfolglos, komme es zur Frustration, wobei die Frustrationstoleranz (das Ausmaß an Frustrationsverträglichkeit; s. o.) unterschiedlich sei. Würden die Flucht vor den Lebensaufgaben (= Arbeit, Liebe, Gemeinschaft) und das Ausmaß der Lebenslüge zu deutlich, komme es zu Neurosen. |
| ° | Therapie: Abhilfe schaffe nach Adler eine Psychotherapie, die sich nicht nur als Deutung, sondern als Neu- und Umerziehung des ganzen Menschen verstehe (vgl. Motto von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831: „Das Wahre ist das Ganze“). Gefragt wird nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu (finale oder teleologische Betrachtungsweise, z. B.: „Zweck des Vergessens ist das Ausweichen vor Unangenehmem“; nicht: „Ursache des Vergessens sind frühkindliche Traumen“). Ziel der Therapie sei das Finden der Lebensleitlinien und die Rückkehr zu einer „Gemeinschaft ohne Phrasen“. |
| ° | Unterschiede zum Konzept von S. Freud: + Betrachtet wird die Gesamtpersönlichkeit, nicht ein Einzelphänomen. + Intuitives Verstehen ersetzt naturwissenschaftliches Erklären. + Falsche Leitbilder übernehmen die Rolle von Kindheitskomplexen. + Der Machttrieb steht im Mittelpunkt, nicht der Sexualtrieb. + Neurosen sind eine Flucht vor Lebensaufgaben, kein Über-Ich-Es-Konflikt. + Ziele, nicht Ursachen von Neurosen werden untersucht. + Psychotherapie interpretiert nicht, sie erzieht. |
 Abb. 4/16: Carl
Gustav Jung
Abb. 4/16: Carl
Gustav Jung
* Analytische Psychologie: Konzept von Carl Gustav Jung (geb. 26. 7. 1875 in Kesswil am Bodensee im Kanton Thurgau, gest. 6. 6. 1961 in Küsnacht) aus der Schweiz, dem dritten der „Pioniere der Tiefenpsychologie“. Seine psychiatrische Ausbildung erhielt Jung an der berühmten Klinik Burghölzli bei Zürich, die unter der Leitung von Eugen Bleuler (1857-1939), dem Schöpfer einer modernen psychiatrischen Fachsprache (s. o.), stand. Nach einem Studienjahr in Paris heiratete er Emma Rauschenbach (1882-1955). 1905 erfolgte die Habilitation, 1907 Jungs erste Begegnung mit Freud. Nach Auseinandersetzungen verlässt er, inzwischen Oberarzt, Burghölzli und zieht nach Küsnacht, wo er - z. T. in einem selbst errichteten Meditations-Turm - bis zu seinem Tod wohnt und privat praktiziert. Im Unterschied zu Freuds Neurotiker(inne)n waren seine Patienten meist Psychotiker mit Wahnideen. Jung schuf das Prinzip der Lehranalyse. 1911-13 war er Präsident der neu gegründeten Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, die Auseinandersetzungen mit Freud („Vater-Sohn-Konflikt“) dauerten an. Es folgten Lehrtätigkeiten an den Universitäten Zürich, Basel, New York, Yale, Studienreisen nach Amerika (zu den Pueblo-Indianern), Afrika (zu den Elgonyi in Kenia) und Asien und 9 Ehrendoktorate in Asien, Europa und Amerika. Jungs lebenslanges Interesse an Religionen und Mythen (auch und vor allem fremder Völker), z. B. am I Ging, einem alten chinesischen Orakelbuch, beeinflussten seine Theorien nachhaltig. (In seinem erst 2009 erschienenen Roten Buch, einem nie zur Veröffentlichung vorgesehenen Selbstfindungsdokument, sind viele Illustrationen, Mandalas und kalligrafischen Bibelzitate festgehalten. Die NZZ bezeichnete das Werk als „ein Dokument eines 16 Jahre andauernden Selbstexperiments, in dem Jung in Visionen und Träumen seinen eigenen Mythos ergründen wollte“.)
| ° | Grundideen: Das seelische Geschehen, das das Selbst (die reife Persönlichkeit in ihrem tiefsten Aspekt) aufbaut und dessen Energie für ihn nicht notwendigerweise sexueller Natur sein muss, nennt Jung Individuation („Werde, der Du bist!“; s. o.). Die Muster im eigenen Unbewussten sollen in bewusste Erkenntnisse übertragen werden. Oft seien „Lebenswenden“ (z. B. Zeit der Identitätsfindung in der Jugend / Zeit der Todesorientiertheit im Alter) beobachtbar, die sich nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt festlegen ließen. Das ein Lebensziel ansteuernde Selbst - es erscheint als Persona (unser gesellschaftliches Gesicht, die „soziale Fassade“ - nur Kinder haben noch keine -, der gerade aktualisierte Ausschnitt der Individualität, das Bild, das der Mensch an seine Umwelt weitergibt) - vermittle, je nach Funktionstyp, mit seinen vier psychischen Grundfunktionen Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden zwischen Bewusstem und Unbewusstem. (Zu Jungs Bewusstseinsbegriff s. a. o.) |
| Das Unbewusste stelle sich nicht nur als persönliches, sondern auch als Kollektives Unbewusstes dar, als eine Art Weltseele, durch die alle Menschen „unterirdisch“ miteinander verwoben seien wie Fruchtkörper durch ein Mycel. Dieses enthalte die Archetypen, also die „gewaltige geistige Erbmasse der Menschheitsentwicklung“, zeitlose Inhalte, die allen Menschen aller Kulturen gemeinsam seien (z. B. „der alte Weise“), die Grundwahrheiten menschlicher Erfahrung symbolisierten und sich in allen Kulturen in Mythen und Märchen oder der Kunst äußern würden (z. B. im Mandala, einer geschlossenen Figur mit einem Zentrum, als Archetyp des Selbst). Jung war einer der ersten, der die Bedeutung von Märchen erfasst hat. (Vgl. für später das 1976 erschienene Buch The Uses of Enchantment / Kinder brauchen Märchen von Bruno Bettelheim, 1903-Suizid 1990, in dem dieser auf die angebotenen Lösungen in scheinbar unausweichlichen Situationen und die Darstellung des Unterschieds zwischen Lustprinzip und Verantwortungsprinzip hinweist.) | |
| Wichtige Seelenanteile seien die Schatten (die finsteren, zerstörerischen Teile des Selbst, z. T. uneingestandene unvorteilhafte Eigenschaften, die sich oft in kollektiven Projektionen, wie z. B. Fremdenhass in Kriegen, entladen würden) und als weitere zentrale Archetypen Ego (Zentrum des Bewusstseins), Anima (das Bild der Frau im Mann) und Animus (das Bild des Mannes in der Frau). Das innere, meist unbewusste Vorstellungsbild einer bestimmten, realen Person (z. B. eines Elternteils), das auch spätere Beziehungen entscheidend mitprägen könne, wird als Imago bezeichnet. | |
| Jung hat auch den Begriff des Komplexes entwickelt (verstanden als affektgeladener Vorstellungsinhalt, der im Erlebnisablauf eine überwertige Stellung einnimmt, ev. verdrängt wird und aus dem Unbewussten nachwirkt; werde er berührt, löse dies starke Gefühle aus). Jungs Konzept wird deshalb auch Komplexe Psychologie genannt. (Zu den Persönlichkeitsdimensionen s. u.) | |
| ° | Jungs Therapie zielt auf Ausgleich zwischen Individuum und Sozietät, wobei die bewusste Einstellung (nicht das Verdrängte) Angriffspunkt einer Änderung wird. („Unbewusstheit ist die größte Sünde“. - „Bis Sie das Unbewusste bewusst machen, wird es Ihr Leben lenken und Sie werden es Schicksal nennen“.) Mit Hilfe von analytischen Gesprächen und schöpferischen Methoden wie dem Deuten von Träumen, der Arbeit mit inneren Bildern (der aktiven Imagination) oder gemalten Bildern soll patientenorientiert die Neurose, die als mangelnde Selbstentwicklung, bedingt durch Vernachlässigung einzelner Persönlichkeitsanteile, gesehen wird, erkannt und ein Zuwachs an Autonomie und kreativen Lebensgestaltungsmöglichkeiten erreicht werden. Jede Krise ist für Jung eine Chance für einen Neuanfang. Er vertraut dabei auf die Selbstheilungskräfte des Unbewussten. Das Therapieziel besteht in einer Amplifikation, also einer Erweiterung des Bewusstseins, die z. B. durch das Herstellen einer Beziehung zwischen religiösen und mythischen Symbolen und den Trauminhalten des Analysanden erzielt werden soll. (Bewusstseinserweiterung als Lebensziel wurde später von der Hippiegeneration aufgegriffen.) Jung war der Ansicht, dass „in erster Linie nicht Wissen und Technik, sondern die Persönlichkeit [erg. „des Therapeuten“] heilend wirkt“ (vgl. o. „therapeutische Allianz“). |
Zu C. G. Jung vgl. Interview 1 (Originalaufnahme 1959; englisch) und Interview 2 (Originalaufnahme 1960; deutsch) oder „Eine Einführung in tiefenpsychologisches Denken" von Tewes Wischmann (*1960?)
* Weitere analytische Ansätze: Durch den krankheits- und verfolgungsbedingten Rückzug Freuds begünstigt beherrschten allmählich andere die psychoanalytische Diskussion. Eine besondere Rolle - auch für eine geregelte Ausbildung der Therapeuten - spielte dabei das 1920 gegründete und bis heute bestehende Berliner Psychoanalytische Institut (s. hier; später Karl Abraham-Institut nach seinem Mitbegründer, 1877-1925). Verschiedene Richtungen (tw. unter dem Sammelbegriff Neoanalyse) versuchten u. a. die relativ untergeordnete Rolle des Ich (es wird zwischen Real-Ich und Ideal-Ich unterschieden) zu korrigieren und die Psychoanalyse weiterzuentwickeln bzw. zu überwinden. Nach Kernberg existieren heute drei Hauptströmungen der psychoanalytischen Psychotherapie: die psychoanalytische Ichpsychologie (der Psychopathologie lägen unbewusste intrapsychische Konflikte zwischen Triebabkömmlingen und Abwehrmechanismen zugrunde, alle Objektbeziehungen - verstanden als Beziehungen zu anderen Personen - seien gleichzeitig Ausdruck der Konflikte zwischen den drei psychischen Instanzen; z. B. Anna Freud), die psychoanalytischen Objektbeziehungstheorien (sie sehen Konflikte stark in der Internalisierung pathologischer Objektbeziehungen - also phantasierter bzw. vorgestellter Beziehungen zur, v. a. personellen, Umwelt - begründet; z. B. Melanie Klein, 1882-1960) und die psychoanalytischen interpersonalen Theorien (sie unterstreichen die traumatischen Erlebnisse der Vergangenheit und wurden in Verbindung mit den Objektbeziehungstheorien vom Amerikaner Stephen A. Mitchell, 1946-2002, u. a. zur sogenannten Relationalen Psychoanalyse weiterentwickelt; Vertreter z. B. Herbert / Harry Stack Sullivan 1892-1949 und Heinz Kohut, 1913-1981). Im Folgenden einige
Beispiele:
| ° | Sandor Ferenczi (1873-1933; zunächst Schüler, dann Freund Freuds, Teil der „Budapester Schule“): Er beschrieb, seiner Zeit voraus, Psychotraumatisierungen durch Super-Ego-Intropression (die reale Schuld eines übergriffigen Täters, der, seine Schuld nicht anerkennend, ein Introjekt hinterlasse, werde zum Schuldgefühl des Opfers) und - noch vor der Ausarbeitung dieser Theorien durch Klein - Objektbeziehungen. Ferenczis therapeutische Neuerungen nach einem Konzept der Nachnährung, die in Richtung Reparenting (Neubeelterung, die die Heilung bringe) gingen, führten dann zu einer starken Entfremdung zu Freud. (Dessen Biograph und enger Freund Ernest Jones, 1879-1858, der Freud auch bei der Emigration nach London behilflich war und der für den extremen Narzissmus den Ausdruck Gottkomplex geprägt hat, hielt dies für die Nachwelt fest.) |
| ° | Otto Rank (eig. Rosenfeld; 1884-1939; zunächst Vertrauter, dann Gegner Freuds): Rank hielt das Geburtstrauma für den entscheidenden Faktor der psychischen Entwicklung des Menschen und beeinflusste durch seine Beschäftigung mit Kunst die Gestalttherapie (s. u.). Der wechselseitige Austausch mit seiner zeitweiligen Geliebten, der US-Schriftstellerin Anaïs Nin (1903-1977), die ihn als „Kronprinzen Freuds“ bezeichnete, schlägt sich in deren Tagebüchern nieder. |
| ° | Karen Horney (1885 Hamburg - 1952 New York): Sie - „die sanfte Rebellin der Psychoanalyse“ - betont die Selbstanalyse und spricht vom Ich auf der Suche nach Sicherheit. Es sei gerichtet „auf etwas hin, gegen etwas oder von etwas fort“. Zwischen Normalität und Neurose besteht für sie (inspiriert von der mit ihr befreundeten Ethnologin M. Mead, s. o.) nur ein gradueller, kein substantieller Unterschied. Horney weist auf die Bedeutung der Eltern-Kind-Beziehung bei der Entstehung von Neurosen unter dem Einfluss einer bei Störungen dieser Beziehung auftretenden Grundangst hin. „Toxische soziale Umwelten“, die sich in gesellschaftlichen, fremdbestimmten Forderungen an ein ideales Selbst realisierten, würden die authentischen Wünsche des realen Selbst konterkarieren und zu einer Tyrannei des „Du sollst!“ führen. Horney kritisiert Freud für sein Konzept des Penis-Neids und stellt ihm den Gebär-Neid gegenüber. Ihre frauenbezogenen Artikel wurden 1967 unter dem Titel Feminine Psychology herausgebracht. - Vgl. Seite des Karen Horney-Instituts |
| ° | Melanie Klein geb. Reizes (1882-1960; s. a. o.): wuchs in Wien auf und gilt als zentrale Gründungsfigur psychoanalytischer Objektbeziehungstheorien. Sie analysierte nach Lehranalysen in Budapest bei Ferenczi und in Berlin bei Karl Abraham (1877-1925) auch ihre eigenen Kinder. Auf Einladung von Jones übersiedelte sie schon 1926 nach London. Klein sieht in ihrem Hauptwerk Über das Seelenleben des Kleinkindes präödipale Objektbeziehungen als zentral für die weitere psychische Entwicklung an. Im Unterschied zu (und in Auseinandersetzung - den sogenannten Controversial Discussions - mit) Anna Freud propagierte Klein die Behandlung auch von Unter-6-Jährigen mittels einer von ihr entwickelten Spieltherapie. |
| ° | Anna Freud (1895-1982; 6. und letztes Kind von Sigmund Freud, dessen enge Mitarbeiterin sie bis zu seinem Tod war; danach war Dorothy Burlingham-Tiffany, 1891-1979, ihre wichtigste Partnerin): Verfasserin des Standardwerks Das Ich und die Abwehrmechanismen, in dem sie z. B. die Begriffe „Verdrängung“ und „Sublimierung“ (s. u.) populär machte und die Anpassungsfähigkeit des Ich als Basis einer gesunden Entwicklung „von der infantilen Abhängigkeit zum erwachsenen Liebesleben“ ansah. Anna Freud analysierte u. a. Marilyn Monroe bzw. Norma Jeane Mortenson bzw. N. J. Baker (1926-1962), wurde aber v. a. als Begründerin und Pionierin der Kinderanalyse (Zur Einführung in die Technik der Kinderanalyse) bekannt. Sie vertrat in einer Kontroverse mit Melanie Klein die Ansicht, dass Kinder vor dem 6. Lebensjahr nicht analysiert werden können. Danach könne eingegriffen werden: „In der infantilen Neurose, wo die Abwehr aus Realangst erfolgt war, hat die analytische Therapie sehr gute Aussicht auf Erfolg. Am einfachsten und unanalytischsten ist der Versuch des Analytikers, nach Rückgängigmachen des Abwehrvorgangs im Kind selbst, die Realität, nämlich die Erzieher des Kindes, so zu beeinflussen, dass weniger Realangst vorhanden ist.“ |
| ° |
Wilhelm Reich
(1897-1957):
Nach dem Studium in Wien war er in Wien und Berlin als Sexualaufklärer
tätig. Ab 1933 Exil (über mehrere Stationen nach Amerika). Er forderte eine
Aufhebung der Charakterpanzerung z. T. mit ungewöhnlichen Methoden (Vegetotherapie
gegen Muskelverhärtungen, Anwendung von Orgonakkumulatoren, wobei Orgon
für Lebensenergie steht), die
ihn nach einer Betrugsklage ins Gefängnis brachten, wo er 1957, 60jährig
starb. Er war mit Neill (s. o.) befreundet. Bekannt ist heute v. a. sein Buch
Massenpsychologie des
Faschismus (1933), in dem er die pathologische Sehnsucht des unpolitischen
Menschen nach Autorität, Beherrschtwerden, Mystik und Ausleben von
legitimierter Aggressivität beschrieb. S. a. u. unter „Körpertherapie“ und vgl. Seiten der W. Reich-Gesellschaft und des Reich-Instituts bzw. über Wilhelm Reich selbst. |
| ° | Erich Fromm (1900-1980; Promotion in Heidelberg; Lehranalyse in Berlin; Mitglied der „Frankfurter Schule“; Emigration in die USA; Professur in Mexiko; Lebensende in Locarno; 4 Jahre verheiratet mit der 10 Jahre älteren Analytikerin Frieda Reichmann, 1889-1957). Fromm gilt als Pionier der Politischen Psychologie (der Begriff wurde 1860 von Adolf Bastian, 1826-1905, geprägt) und eines „dialektischen Humanismus“. Er nannte |
| 5
Grundbedürfnisse der Psyche: + nach Bezogenheit (Verantwortung für Mitmenschen) + nach Transzendenz (Überschreitung der Physiologie) + nach Verwurzelung (Gefühl, benötigt zu werden) + nach Identität (Einzigartigkeit) + nach einem (Sicherheit gebenden) Orientierungsrahmen |
|
| Angst und Hoffnungslosigkeit entstünden, wenn man ein geglücktes Leben außen statt innen zu finden glaube. Ein Schlüsselproblem sei das der Beziehung (zu anderen Menschen, zur Welt). Durch Furcht vor der Freiheit (Buchtitel 1941) entstehe freiwilliger Freiheitsverzicht verbunden mit einer Tendenz zum Konformismus (durch die Tendenz, Verantwortung zu delegieren), zur Destruktion oder eine Flucht ins Autoritäre. (Im Vorwort formuliert Fromm: „Die These des Buches lautet, dass der moderne Mensch, nachdem er sich von den Fesseln der vorindividualistischen Gesellschaft befreite, die ihm gleichzeitig Sicherheit gab und ihm Grenzen setzte, sich noch nicht die Freiheit – verstanden als positive Verwirklichung seines individuellen Selbst – errungen hat.“) Die Gefahr der Freiheit und ihrer zwei Aspekte (Freiheit wovon? Freiheit wozu?) sieht Fromm in der Vereinsamung. Er unterscheidet zwischen autoritärem Gewissen (bei Verfehlungen gegenüber Forderungen einer Autorität) und humanistischem Gewissen (bei Verfehlungen sich selbst gegenüber). | |
| Andere Unterscheidungen: + Produktive Charakterorientierung (verantwortlich, liebend, schöpferisch, selbständig) vs. nicht-produktive Charakterorientierung (offen oder latent lebensverneinend) + Biophiler Menschentyp (gelungene Lebensbejahung) vs. nekrophiler Menschentyp (misslungene Lebensbejahung; im Buch Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, 1973) + Haben-Modus (Besitz, Materielles steht im Mittelpunkt) vs. Sein-Modus (was der Mensch ist und was er anderen geben kann, steht im Mittelpunkt; im Buch Haben oder Sein, 1976) |
|
| Weitere (weltbekannt gewordene) Buchtitel: Die Kunst des Liebens (1956), Die Revolution der Hoffnung (1968) | |
| Vgl. Vortrag Psychologie für Nichtpsychologen (2 Videos), Interview, Erich Fromm-Homepage | |
| ° | Jacques Lacan (1901-1981): Der Pariser Analytiker begründete 1953 mit dem Vortrag Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse die Strukturale Psychoanalyse auf philosophischer und linguistischer Grundlage. In Anlehnung an Claude Lévi-Strauss (1908-2009; s. a. o.) versteht Lacan das Unbewusste als strukturiert wie eine Sprache. Er vertritt ein Konzept des konstitutiven Mangels des Subjekts, das sich, im Versuch den Mangel zu beheben, der Sprache als symbolischem System zuwenden müsse. Lacan kritisiert auch das bisherige Verständnis vom Ich, das er als auf andere Ichs angewiesen versteht. Nur wer ein Konzept vom Anderen habe, könne sich selbst definieren. Auch das Unbewusste existiere nicht separiert von der Außenwelt. Ziel der Psychoanalyse seien weder das Wiedererinnern verdrängter Erlebnisse noch das Abreagieren von Affekten oder die Stärkung des Ichs, sondern die „Artikulation der Wahrheit des eigenen Begehrens“. |
| ° | Heinz
Kohut (1913-1981):
Kohut musste nach seiner
Lehranalyse bei August Aichhorn
(1878-1949) vor den Nazis 1940 aus Wien in die USA fliehen, wo er die Selbstpsychologie begründete und das Wort
„Selbstobjekt“ (das
durch empathische und zugewandte Bezugspersonen
entstehe) prägte. Psychische Leiden entstünden laut
Kohut nicht durch Triebkonflikte,
sondern in einem durch mangelnde Empathie und Zugewandtheit der
Bezugspersonen in der Kindheit verursachten schwachen oder defizitär
entwickelten Selbst. Heilung soll durch eine intersubjektive, empathische
analytische Beziehung erfolgen. Seine bekanntesten Werke: Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer
Persönlichkeitsstörungen, Die Heilung des Selbst und Wie heilt
die Psychoanalyse? (Vgl. a. Wiener Kreis für Psychoanalyse und Selbstpsychologie) |
| ° | Erik Homburger Erikson (1902-1994): Indem er historische mit psychologischen Methoden verband, beschäftigte er sich besonders mit Identitätskrisen und postulierte psychosoziale Phasen (s. o.). |
| ° |
Transaktionsanalyse (TAA): Vom
Kanadier Eric Berne (1910-1970,
eig. Eric Lennard Bernstein; einem
Schüler des Freud-Schülers Paul
Federn, 1871-1950) begründete
Therapieform, die Freuds
topisches Modell (s. o.) ins Soziale wendet.
Bekannt
geworden ist die TAA durch Bernes Bestseller
Spiele der Erwachsenen 1964 bzw. das Buch
Ich bin ok, du bist ok 1967 seines Schülers Thomas
Anthony Harris,
1910-1995. Nach diesem Konzept ergibt sich die Lebenseinstellung des Menschen aus dem Maß der Befriedigung
der 3 Grundbedürfnisse: + Hunger nach Zuwendung + Hunger nach Zeitstrukturierung + Hunger nach Aktivierung. Die verschiedenen Ausrichtungen (Lebens-Skripts; s. o.) werden durch eine Skriptanalyse erfasst. Darauf aufbauend ergeben sich 72 mögliche Kommunikationsformen (Transaktionen; zu einem gewissen Teil nichtsprachlich), die auf den 3 Ichs: + Kindheits-Ich (die ungefilterten Erfahrungen der naiven Frühzeit) + Eltern-Ich (die erfahrenen Überzeugungen und Regeln der Autoritätspersonen) + Erwachsenen-Ich (das heutige, rationale Selbst), die jeder Mensch in sich vereinigt, beruhen. Transaktionen („Grundeinheiten aller sozialen Verbindungen“) können vom Sender anders gemeint sein, als sie vom Empfänger verstanden werden - oder auch nicht. Sie können relativ problemlos komplementär (auf akzeptierter Ebene) stattfinden (z. B. Erwachsenen-Ich spricht zu Erwachsenen-Ich, das auch im selben Modus antwortet), gekreuzt (Rollenkonfusion zeigend) und damit unter „Störfeuer“ auftreten (z. B. Eltern-Ich spricht zu Kindheits-Ich, das die Rolle nicht akzeptiert und im Erwachsenen-Ich-Zustand antwortet; etwa: „Iss doch nicht so viel!“ - „Immer musst du wie meine Mutter an mir herumerziehen.“) oder verdeckt (parallel zur „offiziellen“, sozialen Kommunikation existiert unterschwellig - als Duplex-Transaktion - eine zweite und entscheidendere psychologische Schiene) erfolgen. |
| Zu berücksichtigen ist auch, dass sich die emotionalen Zuständen, in denen
sich interagierende Personen befinden, während des Kommunikationsvorganges
ändern können. Die
Aufgabe des Therapeuten liegt darin, dies alles zu durchschauen und Zusammenhänge zu
entschmelzen,
die Aufgabe des Klienten wäre es in der Folge, die typischen Muster seines
(unerwünschten) Verhaltens zu erkennen, zu verstehen und zu verändern. (Vgl. Seite über Transaktionsanalyse, transaktionsanalyse-online.de und Seite eines österreichischen Transaktionsanalyse-Instituts) |
|
| Ein aus der TAA erwachsenes psychologisches und soziales Modell ist das zuerst von Stephen Karpman beschriebene Drama-Dreieck. (Ein „Retter“ hilft einem von einem „Verfolger/Täter“ bedrohten „Opfer“, das den Anschein erweckt, Hilfe zu benötigen, vielleicht aber unter Nutzung seiner eigenen Fähigkeiten das Problem auch alleine bewältigen könnte. Die Positionen können wechseln. Eignet sich für Verhaltensanalysen, z. B. beim Helfersyndrom - s. o. - etc.) | |
| ° | Transference-Focused-Psychotherapy (TFP, Übertragungs-fokussierte Psychotherapie): von Otto Friedmann Kernberg (*1928; s. a. o.) für schwere Persönlichkeitsstörungen mit dem Ziel, die Objektbeziehungen nachhaltig zu verbessern, entwickelte Methode, die auf der Durcharbeitung und Analyse der Übertragungsbeziehung (s. o.) zwischen Klient und Therapeut - anstatt sich auf diese regressionsfördernd einzulassen - basiert. |
| ° | Ethnopsychoanalyse: wurde im Rückgriff auf Freuds von Wundt (s. o.) angeregtes Buch Totem und Tabu (1913; Untertitel Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker) vom Schweizer Paul Parin (1916-2009) u. a. begründet und entwickelt. Sie verbindet psychologische mit sozialanthropologischen Fragestellungen. |
| ° | Mentalization-Based-Treatment (MBT; Mentalisierungsbasierte Therapie): Eine von Peter Fonagy (*1952) und anderen vor allem als Behandlungsprogramm für Borderline-Fälle entwickelte (nicht ausschließlich) psychoanalytische Technik, die die Fähigkeit, psychische Vorgänge als kausal für eigene und fremde (auch Therapeuten-) Handlungen zu verstehen, fördern will (Mentalisierung). Dadurch soll es möglich werden, reflexiv zu erfassen, welche mentalen, geistigen und emotionalen Umstände und Erfahrungen zu den jetzigen Wünschen, Gedanken und Überzeugungen geführt haben. Der Fokus liegt dabei weniger auf der unbewussten Vergangenheit des Klienten als auf der Qualität der wechselseitigen Einschätzung der gegenwärtigen therapeutischen Beziehung. (Ist die Sicht des Klienten auf das Verhalten des Therapeuten richtig? Könnte er die Situation auch anders verstehen? Auf welchen Gefühlen und Wünschen beruht das Verhalten des Klienten? etc.) Das Therapieziel besteht darin, durch besseres Verstehen des eigenen Fühlens und Denkens (und damit des Verhaltens) Beziehungsfähigkeit herzustellen. |
| ° | Spezifische Traumatherapien: Zur Behandlung von PTBS/PTSD (s. o.) entwickelte die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Francine Shapiro (1948-2019) die EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-Methode, deren Ziel es ist, den nach einem Schicksalsschlag auftretenden Speechless Terror (Sprachloses Entsetzen) zu überwinden. Dabei erfolgt während der Zurückversetzung in die Angst machende Situation eine bilaterale Hirnstimulation durch verschiedenartige Reize (meist Augenbewegungen). Daraus wurde 2003 vom Psychoanalytiker David Grand (*1968) der neuropsychotherapeutische Ansatz Brainspotting entwickelt, mithilfe dessen traumaverarbeitende Gehirnregionen, die aufgrund bestimmter Augenpositionen und -fixierungen identifiziert werden, aktiviert werden. (Diese Therapieformen sind nicht direkt psychodynamisch, aber indirekt davon beeinflusst.) |
| ° | Cyberanalysis: Online-Therapie auf der Basis von E-Mail, Chatroom oder Videokonferenz (zunächst umstritten und z. T. als unseriös bezeichnet, seit der COVID 19-Pandemie 2020 zunehmend akzeptiert); z. B. Online-Therapien, Internet-Therapists. Bezeichnet eher die technische Durchführung als die zugrunde liegende Theorie. Mit dem Fortschreiten der IT-Wissenschaften werden allerdings immer häufiger Computer in das Therapiegeschehen miteinbezogen, z. B. um durch Algorithmen das Abbruchrisiko berechnen zu lassen oder sie unbeeinflusst von persönlichen Werthaltungen als Therapiemanager (z. B. Trier Treatment Navigator TTN von Wolfgang Lutz, *1966) die Methode der Wahl vorschlagen zu lassen. (Schon 1966 entwickelte Joseph Weizenbaum, 1923-2008, das Computerprogramm ELIZA, das als früher Umsetzungsversuch des Turing-Tests - s. o. - psychotherapeutische Gespräche in der Art von Carl R. Rogers- s. u. - ermöglichen sollte und damit zum ersten Vorläufer moderner Chatbots wurde.) |
-
Verhaltenstherapie (VT):
Hinter der (am Behaviourismus -
s. o. - orientierten)
Verhaltenstherapie steht - gemäß einem mechanistischen Menschenbild - die Auffassung, dass allem Verhalten
- auch dem
unerwünschten, neurotischen - (ev. fehlgegangene) Lernprozesse zugrunde
liegen, die wieder rückgängig gemacht werden können. Die Neurose könne daher
verlernt bzw. durch inkompatibles Verhalten - z. B. ist Essen angstinkompatibel
- vermieden werden (Reziproke Hemmung). Der Startschuss der VT fiel, als
der Südafrikaner Joseph
Wolpe (1915-1997) als Medical
Officer im 2. Weltkrieg erkannte, dass psychodynamische Talking Cures bei den
Angst- bzw. PTSD-Zuständen der Soldaten nicht halfen, gewisse
Entspannungstechniken und Konditionierungen jedoch sehr wohl. Er griff auf die
Ergebnisse der behaviouristischen Schule (s. o.)
zurück und versuchte, nicht die Verhaltensweisen, sondern die emotionalen
Reaktionen auf traumatisierende Reize zu konditionieren.
Später wurde die behavioristische VT von Albert Ellis (1913-2007) und Aaron T. (Temkin/Tim) Beck (1921-2021; er hielt die Psychoanalyse, die er selbst betrieben hatte, für eine Glaubenssache, keine Wissenschaft) zur Kognitiven Verhaltenstherapie weiterentwickelt (rational emotive behaviour therapy REBD). Nach ihr machen uns nicht Ereignisse, sondern die Art, wie wir sie sehen, krank. Unsere Reaktionen können dann eine Negativitätsspirale auslösen. Vorgangsweisen, die diese Richtung (heute cognitive-behavioural therapy CBT genannt) protegiert, sind bedingungslose Selbstakzeptanz (des Seins; nur das Tun könne bewertet werden), rationale Verbalisierung (z. B. von Ängsten), Konfrontation emotionaler Bilder mit objektiven Fakten, positive Mantras und bestimmte Atemtechniken (z. B. bei der Behandlung von OCD - s. o.). Diese Therapieform wurde von den Stoikern Seneca, ca. 1-65, und Epiktet, ca. 50-138, beeinflusst und klingt im Band 3 der bekannten Buchreihe von Joanne K. Rowling (*1965; sie hat selbst Erfahrungen mit der CBT gemacht) Harry Potter und der Gefangene von Askaban im dort erwähnten Patronuszauber an. (Thomas Niederkrotenthaler, *1978, von der MedUni Wien u. a. entwickelten ein Curriculum zur Krisenbewältigung und Resilienzstärkung für Unterstufenschüler, in dem das Buch eingesetzt wird; vgl. hier.) Kristin Neff (*1966) beschrieb später im Zusammenhang mit der KVT
3 Elemente des Selbstmitgefühls:
| ° | Achtsamkeit: die Fähigkeit, sich seiner Erfahrungen bewusst zu werden, ohne sie zu beurteilen. Sie ermögliche, Negatives im Wissen zu registrieren, es werde vorübergehen. |
| ° | Erkenntnis, Mensch unter Menschen zu sein: Sie erlaube, Verbundenheit mit jenen zu fühlen, die Ähnliches erlebt haben. |
| ° | Selbstakzeptanz: Sie sei die Voraussetzung für die Umsetzung des Selbstmitgefühls (self compassion) im Leben. |
Kritik: VT sei nur Symptombekämpfung, ein „Verlernen“ unerwünschter Reaktionen sei nicht möglich - bestenfalls ein Überlernen und dadurch Einkapseln der alten Gewohnheiten, die aber unter ungünstigen Bedingungen jederzeit wieder hervorbrechen können (Rückfallsgefahr). Die Annahme, dass die Ratio die limbische (Gefühls)welt dominieren könne, scheint widerlegt: Eine kognitive Umstrukturierung sei laut moderner Hirnforschung schon deshalb schwer möglich, da das entsprechende Kortexareal keine Verbindung zur verhaltenssteuernden Amygdala habe. Zitat Gerhard Roth (s. o.): „Appelle an die Einsicht [...] aktivieren allein die Netzwerke des bewusstseinsfähigen cortico-hippocampalen Systems, das auf die verhaltensrelevanten limbischen Netzwerke keinen wesentlichen oder einen nur indirekten Einfluss hat. Eine Veränderung des cortico-hippocampalen Systems verändert unser deklaratives Gedächtnis, nicht aber unser Verhalten.“
Einzelne Methoden:
* Löschung: Dem unerwünschten Verhalten wird mit dem Ziel, es verschwinden zu lassen, durch Unterlassung jeglicher Verstärkung begegnet (z. B. durch Nichtbeachtung).
* (Systematische) Desensibilisierung (wirksam v. a. bei Phobien): von Joseph Wolpe entwickelter schrittweiser Abbau der vorher hierarchisch aufgelisteten angstauslösenden Situationen (z. B.: eine Schlange in der Vorstellung - eine Schlange in der Realität, aber fern - eine Schlange in der Nähe - eine Schlange auf der Haut o. ä.). Nach dem Erlernen von Entspannungstechniken wird der Klient mit der Realität konfrontiert. (Die Methode kann nicht immer in vivo, sondern manchmal nur imaginal durchgeführt werden.) Wolpe verstand seine Methode als Gegenkonditionierung durch reziproke Hemmung (indem er Reaktionen verwendete, die antagonistisch zur Angst stehen).
* Reizüberflutung: 1967 von Thomas Stampfl (*1930?-????) entwickelt. Der Patient muss sich der Angst machenden Situation aussetzen (Expositionstherapie), um eine Selbstverstärkung durch Eintreten in einen Teufelskreis zu verhindern, (wie den des mit den Fingern schnippenden Irren, der davon überzeugt ist, dass er durch sein Verhalten die Angst machenden Löwen tatsächlich fernhält - es seien ja keine da). Diese Technik, die damit beginnt, dass man sich Angstauslöser in Gedanken lebhaft vorstellen und dann auf die anschwellende innere Angstreaktion fokussieren soll, wird auch Reaktionsprovokation, Konfrontationstraining, Implosivtherapie, Flooding in sensu bzw. in vivo etc. genannt. Historisches Beispiel: Der deutsche Politiker, Naturforscher und Theaterdirektor (nebenbei auch Schriftsteller) Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) erkletterte das Strassburger Münster als Jusstudent intuitiv an einer ausgesetzten Stelle, um seine Höhenangst loszuwerden.
* Aversionstherapie: Verknüpfung des unerwünschten Verhaltens mit unangenehmen Begleiterscheinungen (negative Verstärkung, z. B. Elektroschocks oder ekelerregende Substanzen beim Abgewöhnen des Rauchens). Da einige Techniken fragwürdige ethische Implikationen mit sich führen, wird die Aversionsverursachung manchmal, wenn dies möglich ist, von der Realität in die Vorstellung verlagert.
* Reinforcement (Verstärkung): Verknüpfung erwünschten Verhaltens mit positiven Konsequenzen (z. B. Token-Economy = Münzökonomie, die aber auch mit Punkten funktionieren kann, die später eingelöst werden können. Auch Selbstbehauptungstrainings oder Selbstkontrolle durch Biofeedback arbeitet mit Verstärkung. - Zu Belohnungen vgl. o1 und o2)
* Modellernen: nach Bandura (s. o.) Nachahmungslernen anhand eines dem Patienten dargebotenen Vorbilds (z. B. bei Entziehungskuren ein bereits fortgeschrittener Klient)
* Entspannungstraining: wird meist mit einer der Therapien kombiniert, funktioniert physisch wie psychisch und wird manchmal durch Virtual Reality-Brillen unterstützt. Angewendet werden z. T. fernöstliche Techniken wie z. B. Meditation (durch Entleeren entsteht Enstase statt Ekstase; beeinflusste seit den 1960er-Jahren manche psychotherapeutischen Schulen), Yoga (= asiatische Meditation: „Anjochen“ der Gedanken, Anspannen der Sinne zur höheren Vergeistigung; vorzugsweise im Lotossitz) oder T'ai Chi Chuan (= chinesisches, aus dem Taoismus - Tao = Weg - stammendes Schattenboxen, das in langsamer Bewegung und Gegenbewegung die Harmoniesymbole Yin und Yang versinnbildlicht).
Die Progressive Muskelrelaxation besteht in einem von Edmund Jacobsson (1888-1983) entwickelten Training, bei dem willkürliches Anspannen der Muskel mit deren Entspannen wechselt. 2004 ergab eine Metastudie von Anthony Francis Jorm (*1951), dass PME (progressive Muskelentspannung) bei gewissen Angstzuständen (s. o.) dieselbe Wirkung wie Anxiolytica oder Psychotherapie habe (Link).
Jedes Entspannungstraining (Vorteil: billig und ohne Nebenwirkungen) geht vom Gesetz der reziproken Inhibition (Hemmung) aus, nach dem Entspannung und Angst unvereinbar sind. (Deshalb kann auch Essen, da man sich dazu entspannen muss, Angst überspielen, was in manchen Fällen zu Adipositas führt.) Neurobiologisch ist die Aktivierung des Parasympathikus über seine wichtigste Nervenbahn, den Vagus, entscheidend. (Normalerweise wird er durch Entspannung aktiviert, hier wird umgekehrt durch seine Aktivierung Entspannung erzeugt.)
Vgl. Österreichische Gesellschaft für VT, Deutscher Fachverband für VT, Deutsche Gesellschaft für VT
-
Humanistische und kommunikationsorientierte Therapieformen:
Diese „dritte Kraft“ (Bezeichnung von Abraham Maslow,
1908-1970; s. u.)
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und betont in ihrem Menschenbild den schöpferischen und auf
Selbstverwirklichung ausgerichteten Aspekt der Persönlichkeit des intentional
agierenden und in sozialen Zusammenhängen lebenden Klienten, dessen vielfältige
eigene Ressourcen genützt werden sollen. (Ressourcen sind - nach einem
Interview mit Michael Musalek;
s. o. - definierbar als
unmittelbar verfügbare, in bestimmten Aufgabenstellungen angewendete und
bezüglich des Nutzwertes beurteilbare Potentiale und Kompetenzen, die zu
Kraftquellen werden können, als materielle, soziale und personale Charakteristika
eines Menschen, die genutzt werden, um sich in Richtung persönlicher Ziele
bewegen zu können, zur Bedürfnisbefriedigung beitragen und das Wohlbefinden
steigern bzw. Potentiale der Person selbst und ihrer sozialen Umwelt, deren
Einsatz lebenserhaltende bzw. lebensverbessernde Effekte produziert.) Eine
ressourcen- statt defizitorientierte Therapie
soll bei der Identifizierung von Lebenszielen und Lebenssinn helfen. Wolfgang Metzger
(1899-1979) beschrieb 1962 die dieser Richtung zugrunde liegenden
Arbeitsprinzipien:
| ° | Nicht-Beliebigkeit der Form (man kann nur entfalten, was an Möglichkeiten angelegt ist) |
| ° | Gestaltung aus inneren Kräften (die in den Klienten selbst ihren Ursprung haben) |
| ° | Nicht-Beliebigkeit der Arbeitszeiten (sondern Ausnutzen der fruchtbaren Augenblicke der Zugänglichkeit) |
| ° | Nicht-Beliebigkeit der Arbeitsgeschwindigkeit (Prozesse haben ihr eigentümliches Ablauftempo) |
| ° | Duldung von Umwegen |
| ° | Berücksichtigung der Wechselseitigkeit des Geschehens |
Charlotte Bühler, 1893-1974, entwickelte als Grundlage der humanistischen Psychologie in den USA (die Familie musste nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aus Wien emigrieren) die
4 Grundtendenzen des menschlichen Lebens:
| ° | Bedürfnisbefriedigung: Streben nach Wohlbefinden und persönlicher Zufriedenheit |
| ° | Selbstbeschränkende Anpassung: Streben nach Sicherheit und Konfliktvermeidung |
| ° | Schöpferische Expansion: Streben nach Potentialverwirklichung, Kreativität und Selbstentfaltung |
| ° | Aufrechterhaltung der inneren Ordnung: Streben nach Ausgeglichenheit und Stabilität |
Kritik: Einerseits wird dieser Strömung Scheu vor empirisch-wissenschaftlicher Fundierung sowie ihre Vielfalt und damit innere Widersprüchlichkeit vorgeworfen, andererseits darauf hingewiesen, dass das, was in entspannten Sitzungen gut funktioniere, oft nicht ins Leben übertragen werden könne.
Einzelne Schulen:
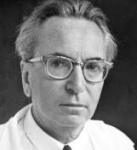 Abb. 4/17:
Viktor E. Frankl
Abb. 4/17:
Viktor E. Frankl
* Logotherapie: vor dem Auftreten der eigentlichen humanistischen Psychologie vom österreichischen Psychologen und Arzt Viktor E. Frankl (geb. 26. 3. 1905 in Wien, gest. 2. 9. 1997 in Wien) begründet. Er war wie Freud, mit dem er schon als Schüler korrespondierte, jüdischer Herkunft und arbeitete später als Mitarbeiter von Adler und Reich, begann seine Tätigkeit also ursprünglich in der psychodynamischen Tradition. Frankl gründete als 23jähriger Medizinstudent mit großem Erfolg eine Jugendberatungsstelle für Depression und Suizid und überlebte ab 1943 (er hatte ein Visum abgelehnt, um seine Eltern nicht zurückzulassen) durch Willensstärke und innere „Distanzierung“ von seinem Leid Auschwitz und andere KZs, während fast seine ganze Familie und seine erste Frau (diese am Befreiungstag) starben. (Vgl.: Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, später unter dem dem Buchenwaldlied von Friedrich Löhner-Beda = Bedřich Löwy, 1883-1942, entlehnten Übertitel ...trotzdem Ja zum Leben sagen - auf Englisch Man's search for meaning - veröffentlicht; geschrieben in neun Tagen im Jahr 1945 auf einer Schreibmaschine des SPÖ-Abgeordneten und späteren Parteivorsitzenden und Vizekanzlers Bruno Pittermann, 1905-1983.) Nach dem Krieg wurde Frankl Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Wien, ab 1970 am eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Logotherapie in San Diego / Kalifornien und anderen, v. a. amerikanischen Universitäten. Er unternahm zahlreiche, oft überbuchte Vortragsreisen, erhielt Ehrenbürgerschaften (z. B. Austin) und -doktorate und war weithin populär, was sich z. B. in der Verbreitung seiner Bücher, v. a. Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, Der Wille zum Sinn, Das Leiden am sinnlosen Leben, Theorie und Therapie der Neurosen etc., die in alle bedeutenden Sprachen der Welt übersetzt wurden, und der Gründung zahlreicher Frankl-Institute niederschlug.
| ° | Daseinsanalysen gibt es seit Ludwig Binswanger (1881-1966, der unter dem Einfluss von Freud, Edmund Husserl, 1859-1938 und Martin Heidegger, 1889-1976, die Liebesfähigkeit im Zentrum sieht). Die Logotherapie und Existenzanalyse von Frankl (= „dritte Richtung der Wiener Psychotherapie“ neben Freud und Adler), die Freiheit und Verantwortlichsein bewusst macht und damit eine bestimmte zugrundeliegende Anthropologie berücksichtigt, konstatiert „existentielle Frustration trotz herrschendem Wohlstand“ als Leiden unserer Zeit und strebt Heilung durch Sinnfindung an. Es gelte, eine Aufgabe im Leben zu finden. (Vgl. Nietzsche-Zitat: „Wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie.“) Neben unbewussten Trieben, Begierden, Wünschen, Phantasien usw. gebe es auch eine unbewusste Geistigkeit mit mehreren Anteilen (ethisches Unbewusstes, ästhetisches Unbewusstes). Das im dreidimensional (als biologisch-physiologisches, psychologisch-soziologisches und - Selbsttranszendenz ermöglichend - geistig-noetisches Wesen) angelegten Menschen auftretende Bedürfnis nach Sinn werde durch Abhandenkommen einer Wert- und Weltanschauung nicht erfüllt. Dies führe zu Neurosen (zu sturer Selbst-Zentriertheit). Nicht ein (vorher)bestimmter Sinn ist gemeint, sondern ein zu suchender/findender. (Für Frankl selbst z. B. bestand er darin, anderen zu einem Sinn zu verhelfen). |
| ° |
Techniken: von Frankl
entwickelte Techniken (sie rekurrieren auf die dritte der eben
erwähnten Dimensionen) sind: + Dereflexion: Symptome sollen ignoriert werden („Man darf sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen“ - Trotzmacht des Geistes), der Patient soll in der Mitwelt handeln, nicht über sich nachgrübeln. + Paradoxe Intention des Patienten (zur Paradoxen Intervention des Therapeuten vgl. u.): Eine im Bereich der Vorstellung angesiedelte Technik, die eine Distanzierung von der Neurose ermöglicht. Das Gefühl der Unterworfenheit weicht dem des Beherrschens des Symptoms. Ein eingespielter Circulus diaboli bzw. vitiosus wird durch diese ungewöhnliche Maßnahme durchbrochen, neue Möglichkeiten, mit einer Therapie anzusetzen, öffnen sich. (Beispiel: Bei Prüfungsangst soll man damit unvereinbare Gedanken der Vorfreude auf die bestandene Prüfung produzieren.) + Einstellungsmodulation: zielt auf eine Veränderung der Sichtweise ab. Die Klienten sollen das Positive auch an schwierigen Situationen zu erkennen imstande sein (tragischer Optimismus). Grundlage dafür ist, sich selbst zu verändern und nicht auf eine Veränderung der Umstände zu hoffen, ähnlich dem Aristoteles (384-322 v. Chr.) zugeschriebenen Aphorismus: Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. (Der US-amerikanische Vertreter einer existentiellen Psychotherapie und Mitbegründer der American Association for Humanistic Psychology Rollo May, 1909-1994, empfiehlt, negative Gefühle zu akzeptieren statt zu unterdrücken, um ein Persönlichkeitswachstum zu ermöglichen.) + Sokratischer Dialog: Wie Sokrates (Σωκράτης, 469-399 v. Chr.; s. o.) hilft der Arzt dem Patienten nach der Hebammen-Methode (Maieutik), die Erkenntnisse selbst zu vollziehen und Sinnstiftung zu betreiben. Sinn könne nicht - von außen - gegeben, er müsse - von den Klienten - gefunden werden. Diese sollen sich dabei nicht mit ihren Erwartungen an das Leben, sondern mit den Erwartungen des Lebens an sie beschäftigen. |
| ° | „3 Hauptstraßen“ zum Sinn: + Schöpferische Werte (Freude über das durch eigene Arbeit Geschaffene) + Erlebniswerte (statt Konsum) + Einstellungswerte (Man kann sich nicht frei von negativen Gefühlen machen, ist aber durch die Trotzmacht des Geistes frei, zu ihnen Stellung zu nehmen: Selbst in der ausweglosesten Situation entscheidet man noch selbst über die Einstellung gegenüber dieser Situation und kann sie hinnehmen, gegen sie rebellieren, mit ihr hadern etc.; verwandt mit der existentialistischen Einstellung, sich über das Schicksal zu erheben, indem man es verachtet.) |
Vgl. Videoportrait (die ersten 28 min). Seite über Viktor Frankl, Seite des Frankl-Zentrums Wien, des Instituts für Logotherapie und des Viktor Frankl-Institut Wien, Logotherapie-Institut Salzburg und Logotherapie-Institut Tirol
* Gesprächstherapie: Die „dritte Kraft“ der Humanistischen Psychologie wurde vom US-Amerikaner Carl R. Rogers (1902-1987) mitbegründet (zusammen mit Charlotte Bühler, 1893-1974, die Bedürfnisbefriedigung, selbstbeschränkende Anpassung, schöpferische Expansion und Aufrechterhaltung der inneren Ordnung als die 4 Grundtendenzen des menschlichen Lebens betrachtete und anderen). Abraham A. Maslow (s. u.) Virginia Satir (s. u.) und Rollo May (s. o.) waren mit Rogers Mitbegründer der American Association for Humanistic Psychology. Rogers studierte zunächst Landwirtschaft und Theologie, dann Psychologie. er war Professor an mehreren USA-Universitäten (zuletzt La Jolla, Kalifornien) und hatte in Europa (v. a. durch die Arbeiten von Annemarie und Richard Tausch - s. o.) großen Einfluss (schülerzentriertes Lernen, Entstehen von, s. a. u., Encounter-Gruppen). Seine client centered therapy (personenzentriert, nicht krankheits- oder störungszentriert) leugnet ein homöostatisches Menschenbild; sie geht von der Fähigkeit, psychisch zu wachsen, aus. (Für den Begriff „Selbstverwirklichung“ - s. u. - verwendet er den Begriff Aktualisierungstendenz.) Ziel ist das als Prozess verstandene gute Leben, das nicht an der Vergangenheit und an dem ausgerichtet ist, was man sein soll, sondern an dem, der/die man ist.
Ein wichtiger Begriff ist das Selbstkonzept (mit Berücksichtigung eventueller Differenzen zwischen Selbstbild und Fremdbild). Der Therapeut verhält sich aktiv zuhörend (nicht nur „einohrig“, sofort nach einer Antwort suchend oder im Kopf schon die nächste Frage formulierend), gibt aber kein Ziel vor. Er bleibt er selbst (aufrichtig, echt, ohne Fassade) und soll Wertschätzung (bedingungsloses Akzeptieren; Ernstnehmen, wenn auch nicht immer Zustimmung zu den Aussagen des Klienten), Wärme und einfühlendes Verstehen (Empathie) vermitteln. Er interpretiert nicht, sondern arbeitet maieutisch. Der Klient sieht sich durch die spiegelbildliche Rückgabe seiner Äußerungen zu einer Korrektur und zu einem Ausgleich zwischen dem Ideal-Bild und dem Real-Bild seines Selbst veranlasst und entwickelt dadurch ein positives Selbstkonzept. Rogers' setzt also (vgl. seine Videoerklärung) auf
3 Grundbegriffe:
| ° | Empathie (Einfühlungsvermögen ohne zu urteilen) |
| ° | Akzeptanz (ermöglicht erst eine nutzbringende Beziehung zum Therapeuten) |
| ° | Kongruenz (zielt auf die Authentizität des Therapeuten ab. Erfahrungen, Bewusstsein und Sprache müssen fassadenfrei mit dem Verhalten übereinstimmen.) |
Zu Rogers' Prinzipien der Erziehung s. o. - Vgl. Video Interview mit C. Rogers, Seite über Rogers, über Gesprächstherapie und die Homepage der entsprechenden Österreichischen Gesellschaft
Eine bekannt gewordene Weiterentwicklung der Theorien von Rogers stellt das Konzept der gewaltfreien Kommunikation (Ausrichtung auf Bedürfnisse, die hinter allem stünden) von Marshall B. Rosenberg (1934-2015) dar. Um statt konfliktreicher Kommunikation empathische Kommunikation möglich werden zu lassen, empfiehlt er
4 Schritte:
| ° | Übermitteln nicht wertender Beobachtung („Wenn ...) |
| ° | Darstellen von damit verbundenen Gefühlen (..., dann fühle ich mich ...) |
| ° | Offenlegung der dahinter stehenden Bedürfnisse (..., weil ich ... brauche.) |
| ° | Äußern von auf konkrete Handlungen bezogene Bitten (Deshalb möchte ich gerne ... .“) |
Damit können die letzten beiden der von Friedrich Glasl, *1941, diagnostizierten Eskalationsstufen eines Konflikts - Win-win-Situation, in der noch beide gut aussteigen können / Win-lose-Situation, in der nur mehr eine/r gut aussteigen kann / Lose-lose-Situation, in der niemand mehr gut aussteigen kann - vermieden werden. - Zu Konflikten s. u.
* Gestalttherapie: Begründet von Fritz (Frederick) Perls (1893-1970): Ausbildung in Berlin durch Horney und Reich, aber auch bei Max Reinhardt (1873-1943), dem (Mit)begründer der Salzburger Festspiele; Therapeut in Frankfurt; Emigration nach Amsterdam und Südafrika; ab 1946 in den USA von der Chicagoer Schule für Sozialpsychologie und v. a. von Paul Goodman (1911-1972), der krank machende gesellschaftliche Verhältnisse analysierte, beeinflusst; gest. in Vancouver. Ziel dieser Richtung ist ein Leben ohne Fassade. Klienten sollen Eigenverantwortung übernehmen und nicht andere für ihre Schwierigkeiten verantwortlich machen. Sie müssen ihre eigene Wahrheit über die (sich verändernde) Welt entdecken und nach ihren und nicht nach fremden Bedürfnissen leben lernen. (Eine Bezugnahme auf die Gestaltpsychologie, s. o., besteht nicht, wiewohl Analogien existieren.)
Mittelpunkt einer Gruppensitzung, die mit personenzentrierter Arbeit
abwechselt, ist das auf dem „heißen Stuhl“ sitzende Gruppenmitglied und seine
Probleme. Im Hier und Jetzt, dem einzigen Ort, an dem Veränderung stattfinden
könne, soll die Anklammerung an die Vergangenheit überwunden werden (ihr nicht
mehr die Schuld an den Problemen zugeschoben werden), an ihre Stelle trete mit
der Zeit die angestrebte Verantwortlichkeit.
Mit z. T. künstlerischen Mitteln (Zeichnen, Theater etc.) wird versucht, die
Gestalt zu schließen (also die Wahrnehmungen zu sinnvollen Einheiten zu
integrieren). Sie tritt dann in den Hintergrund, Blockaden werden
gelöst (Prinzip der Ganzheitlichkeit). Der Therapeut lässt den Klienten die
vermiedenen und verleugneten Teile seiner selbst spielen, um sie in der Folge zu
reintegrieren.
Vgl. ÖVG,
DVG,
Lexikon der Gestalttherapie
und Seite des Symbolon-Instituts
* Körpertherapie (Bioenergetik): Eine Vorläuferin war die Orgontherapie von Reich (s. o.). Die Bioenergetik (entwickelt von Alexander Lowen, 1910-2008, in New York; ursprünglich Rechtsanwalt, dann Mitarbeiter Reichs) beruht auf dem Gedanken, dass der Körper Ausdruck seelischer Zustände ist. Im Verlauf der Lebensgeschichte entwickeln sich (können sich entwickeln)
5 Charakterstrukturen:
| ° | Sichzusammennehmen (entspricht der schizoiden Persönlichkeit) |
| ° | Ansichhalten (entspricht dem oralen Charakter) |
| ° | Drinnenhalten (entspricht dem masochistischen Typ) |
| ° | Drüberhalten (entspricht psychopathischen Mustern) |
| ° | Zurückhalten (entspricht rigiden Strukturen) |
Aufgabe der Therapie ist es nun, durch Übertreiben der Körperhaltung bis zur Karikatur den Muskelpanzer zu lockern bzw. Verspannungen durch körperliches Agieren zu lösen.
Andere Körpertherapien stellen das Atmen in den Mittelpunkt (Atemtherapie) oder fordern einfach ein Umklammern des Klienten (Holdingtherapie vom Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Nicolaas Tinbergen, 1907-1988, Anwendung bei autistischen Kindern). Die Urschreitherapie von Arthur Janov (1924-2017) soll Spannungslösung bewirken. Die Sexualtherapie von William Howell Masters (1915-2001) und Virginia Eshelman-Johnson (1925-2013) beruht tw. auf paradoxen Interventionen (s. u.).
* Familientherapie: geht von der Annahme aus, dass nicht nur der Kranke, sondern auch das System, in dem er lebt, krank ist und behandelt werden muss (Systemische Familientherapie). Untersucht werden in diesem Konzept, das 1950 von Nathan Ackerman (1908-1971) und Murray Bowen (1913-1990) entwickelt wurde, die Kommunikations- und Interaktionsstile innerhalb der Familie. Dahinter steht die Idee, dass eine Störung nicht ohne den sozialen Kontext, in dem sie entstanden ist, verstanden und in weiterer Folge bewältigt werden kann. Auch transgenerationelle Auswirkungen müssen berücksichtigt werden. (Kinder traumatisierter Eltern - vgl. a. o. - übernehmen z. B. in einer Parentifizierung manchmal die Elternrolle.)
Man unterscheidet:
| ° | Okkupationssysteme (z. B. wenn Eltern ihr Kind als Hoffnungsträger für selbst nicht erreichte Ziele okkupieren) |
| ° | Substitutionssysteme: Nach Horst
Eberhard Richter
(dt. Psychoanalytiker, 1923-2011) substituiert sich jede kranke Familie + als Festung (die paranoide Verteidigung betreibt) + als Sanatorium (das angstneurotische Selbstbemitleidung zeigt) + als Theater (in dem hysterische Verdrängung gespielt wird). |
Therapieverlauf:
| ° | Ausgangspunkt: Ein Symptom (z. B. psychosomatische Beschwerden wie Asthma, psychische Labilität etc.) oder ein für einen Teil der Familie unerträglicher Zustand fällt auf. Es besteht der Verdacht, dass der / die Symptomträger/in nur in Zusammenhang mit der Restfamilie verstanden werden kann. |
| ° | Ansatzpunkte: + Familienkonstellation (Ränge, Rollen und deren Zuweisung, Machtverhältnisse, Sozialdistanz etc.) + Familienatmosphäre (Stimmungen, Begegnungsweisen) + Familienregeln (Art der ausgesprochenen und der unausgesprochenen Regeln, Form des Zustandekommens, Weise des Einhaltens) |
| ° | Methoden: + Familienaufstellungen: Auf einem Systembrett (oder auch in der Realität) werden symbolisch Figuren (oder real Personen) von den Klienten positioniert. Alle für deren Probleme in Vergangenheit oder Gegenwart potentiell Verantwortlichen sollen berücksichtigt werden. Distanz, Winkel und Blickrichtung lassen sich später systemisch interpretieren. (Bekannt geworden sind v. a. die Familienskulptur-Methode von Virginia Satir, 1916-1988, s. u. - und die auf die drei Grundbedürfnisse Ausgleich, Ordnung und Bindung bzw. Zugehörigkeit abzielende Aufstellungsmethode von Bert / Anton Hellinger, 1925-2019.) + Genogramme (entwickelt in den 70er-Jahren von Bowen, popularisiert 1985 von Monica McGoldrick, *1943 und Randy Gerson, *1928?-1995, in Genograms in Family Assessment): Graphische Darstellungen der Generationenverhältnisse im Hinblick auf die jeweilige Beziehungsstärke (im Positiven wie im Negativen) visualisieren - oft im Zusammenhang mit Aufstellungen - nicht nur verwandtschaftliche, sondern darüber hinaus auch inhaltliche Beziehungen zwischen Familienmitgliedern. Berücksichtigt werden Konstellationen, Beziehungen, die medizinische oder therapeutische Vergangenheit der Personen und ähnliche Faktoren. Anne Ancelin Schützenberger (1919-2018), eine Mitarbeiterin Morenos (s. u.), entwickelte die Psychogenealogie, die den Zusammenhang zwischen Traumata und Spannungen im Leben der Vorgeneration(en) und Verhaltensstörungen der Nachfahren aufdecken soll. + Offenlegung von Familienaufträgen: Unausgesprochene und sich oft über Generationen hinziehende Familienaufträge (z. B. wenn sich Kinder verpflichtet fühlen, den Betrieb der Eltern zu übernehmen oder den Beruf des Vaters / der Mutter zu ergreifen etc.) beeinflussen den Lebensweg oft negativ, wenn sie den eigenen Wünschen widersprechen und die innere Kraft (das Selbstbewusstsein) nicht aufgebracht werden kann, rechtzeitig eigene Pläne zu entwickeln und deren Realisierung einzufordern. + Systemische Fragen: Dazu zählen zirkuläre Fragen, die auf den vermuteten Standpunkt Dritter abzielen und Zusammenhänge und Wechselwirkungen sichtbar machen, Skalierungsfragen, die eine objektive Messbarkeit subjektiver Zustände oder Empfindungen unterstellen, hypothetische Fragen wie z. B. die bekannt gewordene sog. Wunderfrage vom in Wien verstorbenen Steve de Shazer (1940-2005): „Woran würden Sie und Ihre Umgebung - ohne Absprache - merken, dass Ihre Probleme gelöst seien, wenn dies wie durch ein Wunder über Nacht geschähe?“, paradoxe Fragen, die durch ihre Widersprüchlichkeit und Überzeichnung verblüffen sollen, und lösungs- bzw. ressourcenorientierte Fragen, die das Gespräch konstruktiv zu gestalten imstande sind. + Gesprächs- und Gruppentherapie: wird in den verschiedensten Formen eingesetzt. + Spieltherapie: wird bei Kindern nicht nur therapeutisch, sondern auch als diagnostisches Mittel verwendet. |
Vgl. Seite der DGSF, folgende Arbeitsblätter und ÖAS-Seite. Zu Satirs Conjoint-Therapie s. u. Zur Paartherapie (als Sonderfall der Familientherapie) vgl. auch Eheberatung nach Loriot (eig. Bernhard-Viktor „Vicco“ Christoph-Carl von Bülow, 1923-2011: „Kommunikationsgestörte interessieren mich am allermeisten. Alles, was ich als komisch empfinde, entsteht aus der zerbröselten Kommunikation, aus dem Aneinander-Vorbeireden.“ - S. a. o.)
* Gruppentherapie: Weniger eine bestimmte inhaltliche Richtung, sondern eher eine Organisationsform, die von mehreren Schulen aufgrund ihrer Vorteile (billiger, interaktiver, Mitsprachemöglichkeit, auch gegenseitige positive Beeinflussung) adoptiert wird.
| ° |
Psychodrama von
Jakov
Levy Moreno (1889-1974; aus
Bukarest stammender Österreicher, der mit Adler
zusammenarbeitete und 1925 in die USA ging): Älteste Form der
Gruppentherapie. Durch dramatische Darstellung der lebensbestimmenden
Konflikte (z. B. mit den Eltern und dem Umfeld: die Gruppenmitglieder übernehmen -
ähnlich einer Familienaufstellung;
s. o. - deren Rollen)
soll in einem Konzept der Kreativität und Spontaneität eine Bewusstmachung und eine Affektabfuhr erfolgen,
die das Potential für adäquate Lösungsansätze freisetzt (Einfluss des Wiener
Stegreiftheaters). Der Ablauf gliedert sich in: + Erwärmungsphase (Schaffung eines angstfreien Klimas) + Handlungsphase (Arbeit am Problem) + Integrationsphase (Reflexion) Vgl. ÖAGG (Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik - Psychodrama Austria) |
| ° | Encounter-Gruppen: Im Anschluss an die T-Groups / (Sensitivity)trainigsgruppen) von Kurt Lewin entstandene Begegnungsgruppen. Als Bekanntengruppen, Fremdgruppen oder Betriebsgruppen sollen sie dem Einzelnen bei der Persönlichkeitsstärkung oder als Selbsterfahrungsgruppen beim Kennenlernen seiner selbst helfen. |
| Bekannt geworden sind v. a. die Balint-Gruppen (nach dem 1939 nach England emigrierten, analytisch orientierten Ungarn Michael Balint, 1896-1970, Teil der „Budapester Schule“, Begründer der Fokaltherapie, einer Kurztherapie, die einen thematischen Schwerpunkt = Fokus hat), in denen 8 bis 12 Angehörige der gleichen Berufsgruppe unter professioneller Leitung (Supervision - s. o. - durch einen Ausbildungspsychologen) ihren Berufsalltag (ihre Beziehungen zu allen Menschen, denen sie im Beruf begegnen) bzw. andere Probleme besprechen. | |
| ° | Selbsthilfegruppen: Sie beruhen als zunächst nicht institutionalisierte, selbst organisierte Einheiten darauf, dass alle ihre Mitglieder - mit Ausnahme eines eventuell begleitenden Therapeuten - gleiche oder ähnliche Probleme haben und sich aneinander aufrichten können. Man findet Kolleg/innen vor, die weiter als man selbst sind und daher als Vorbild dienen können, aber auch solche, die noch am Beginn stehen und dadurch den Weg, den man selbst zurückgelegt hat, deutlich werden lassen. (Beispiel: Anonyme Alkoholiker, eine 1935 vom Börsenmakler William Griffith Wilson, 1895-1971, und dem Arzt Robert Holbrook Smith, 1879-1950, gegründete Basisgruppe, in der nach einem 12-Punkte-Programm versucht wird, die unheilbare Alkoholerkrankung abzustoppen.) |
 Abb. 4/18: Paul
Watzlawick
Abb. 4/18: Paul
Watzlawick
* Konstruktivismus: Diese Richtung sieht psychische Schwierigkeiten darin begründet, dass jeder Mensch in einer anderen, von ihm „konstruierten“, Wirklichkeit lebt. Die Kommunikation mit anderen kann dadurch gestört sein. Eine besondere Rolle kommt den Erwartungseffekten (self fulfilling prophecies, s. o.) zu: Voraussagen (gerade im Bereich zwischenmenschlicher Kommunikation) treten nur deshalb ein, weil sie gemacht wurden (analog dem sagenhaften Vorbild des König Οἰδίπους / Ödipus, der niemals seinen Vater ermordet bzw. mit seiner Mutter Kinder gezeugt hätte, wenn dies seinen Eltern nicht vorausgesagt worden wäre und sie es deshalb dadurch zu verhindern versucht hätten, dass sie ihn als Baby aussetzten, sodass er sie später nicht als seine Eltern identifizieren konnte und so unschuldig schuldig wurde).
Das bedeutet:
| ° | ...dass es wichtiger ist, was für wirklich gehalten wird, als ob etwas „wirklich“ wirklich ist. |
| ° | ...dass wir auf unsere Interpretation von Wirklichkeit reagieren und nicht auf die „Wirklichkeit“. |
| ° | ...dass wir unsere eigene Wirklichkeit schaffen (was manchmal dazu führt, dass wir sogar dann in Daten Muster erkennen, wenn gar keine vorhanden sind: Clustering-Illusion; vgl. a. die Apophänie, die Schizophrene Regelmäßigkeiten und Beziehungen in bedeutungslosen Einzelheiten sehen lässt). |
1955 veröffentlichte George Alexander Kelly, 1905-1967, Die Psychologie der persönlichen Konstrukte. Nach seiner Personal Construct Theory formen kognitive Prozesse ein individuelles Weltbild, das umso eher selbstverstärkend gefestigt wird, desto mehr die erlebte Wirklichkeit dem Bild der persönlichen „Brille“ entspricht. Als wichtigste Vertreter der in der Folge entstandenen, dem systemischen Ansatz verpflichteten Richtung des Konstruktivismus gelten der Ethnologe Gregory Bateson (1904-1980), Don D. Jackson (1920-1968), John H. Weakland (1919-1995) und Paul Watzlawick (geb. 1921 in Villach; Studium der Philosophie und Sprachen bis 1949; Analytikerausbildung bis 1954; Professor für Psychotherapie in El Salvador 1957-1960; ab 1960 mit einigen der obgenannten und Janet H. Beavin, 1940-2022, Forschungsbeauftragter am Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien; ab 1967 auch an der Stanford University, Abteilung Psychiatrie; Buchveröffentlichungen: Menschliche Kommunikation, Lösungen, Die Möglichkeit des Andersseins, Wie wirklich ist die Wirklichkeit?, Anleitung zum Unglücklichsein, Gebrauchsanweisung für Amerika u. a. - sie wurden zum Teil sehr populär; gestorben 2007 in Palo Alto). Watzlawick und andere stellten die Fünf pragmatischen Axiome der Kommunikation auf. (Dazu s. o.; vgl. a. die Paul Watzlawick Website, Video-Vortrag 1 Wenn die Lösung das Problem ist, Vortrag 2 Wie wirklich ist die Wirklichkeit? und Paul Watzlawick Ehrenring.)
Die auf Grundlage der Fünf pragmatische Axiome der Kommunikation (s. o.) entstehenden Probleme sollen auf folgende Weise bearbeitet werden:
| ° | 1. Problem definieren, zwischen echten und Pseudoproblemen unterscheiden |
| ° | 2. Bisherige Lösungsversuche untersuchen und überprüfen, ob die Probleme nicht durch Fehllösungen entstanden sind |
| ° | 3. Ziele bzw. Lösungen definieren, utopische und vage Lösungen unberücksichtigt lassen |
| ° | 4. Konkrete Planungen durchführen |
Die zugrunde liegenden Werte sollten Toleranz, Fairness und Vertrauen sein. Besonderes Augenmerk richtet der Konstruktivismus auf die durch unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen bedingten dysfunktionalen Kommunikationsverhältnisse, da seiner Ansicht nach psychische Erkrankungen auf solche zurückgeführt werden können. Folgendes Phänomen - das man wie die self fulfilling prophecy (s. o.) unbewusst zum eigenen Nachteil letztlich selbst erzeugt - wurde, v. a. in Schizophrenie und Familie von Bateson, dem Ehemann von M. Mead (1901-1978), für den „Ethos“ der soziale Stil einer Gesellschaft ist, untersucht.
Double-Bind (Beziehungsfalle): Dieses System beschreibt die Wirkungen von Paradoxien (= logisch unvereinbaren, in sich widersprüchlichen Inhalten nach dem Modell: „Alle Kreter lügen“, sagte ein Kreter; z. B. „Entspanne dich doch!“) in dysfunktionalen Kommunikations- bzw. Interaktionsmustern, die das Potential zu Traumatisierung und Selbstwertverwirrung haben. Der/die Angesprochene kann sich dabei nur falsch verhalten, da er zwei entgegengesetzte Verbindlichkeiten (binds) auf einmal verspürt und sich daher in einer ausweglosen Situation befindet. Dies kann in einer familienkommunikativen Zirkularität auch dazu führen, dass die Antwort wieder Doppelbotschaften enthält. (Der Begriff „Double bind“ wurde in den 50er-Jahren des 20. Jhdts. von Bateson geprägt und zu einer Schizophrenietheorie - s. o. - weiterentwickelt.) Für psychiatrisch relevante Double-Bind-Situationen gibt es
3 Voraussetzungen:
| ° | eine enge (als wichtig empfundene) Beziehung der Interaktionspartner (andernfalls können Aussagen anderer Personen nicht toxisch werden, da sie zu wenig Stellenwert haben) |
| ° | eine Mitteilung, die etwas aussagt und gleichzeitig über ihre eigene Aussage etwas aussagt, so, dass beide Aussagen unvereinbar sind (durch Befolgung missachtet bzw. auch durch Missachtung nicht wirklich befolgt werden, z. B. die Aufforderung: „Sei spontan!“, der nicht nachgekommen werden kann; vgl. Seite der HfH) |
| ° | Die paradoxe Mitteilung ist, obwohl logisch sinnlos, pragmatische Realität. Ihr Empfänger kann der Situation nicht durch Metakommunikation (diese zielführende und sinnvolle Möglichkeit steht nur bei einem gewissen Abstraktionsniveau und der Möglichkeit, sich emotional zu distanzieren offen), Ironisierung oder Flucht entkommen und läuft Gefahr, für richtige Wahrnehmungen bestraft und als verrückt bezeichnet zu werden. (Beispiel aus dem Partnerschaftsbereich: „Du könntest ruhig etwas zärtlicher zu mir sein“ sagt A zu B. Kommt B dieser Aufforderung nach, muss er/sie sich vorwerfen lassen, nicht von sich aus gehandelt zu haben, ignoriert er/sie den Wunsch, wird auch dies nicht goutiert werden.) |
In dieses System kann sich der Therapeut wissentlich miteinbeziehen, indem er z. B. einem Klienten, der nicht nein sagen kann, die Symptomvorschreibung erteilt, nein sagen zu müssen. Befolgt dieser die Anweisung nicht, hat er zum Therapeuten nein gesagt, ansonsten ist die Vorschreibung erst recht geglückt. Diese Technik wird Paradoxe Intervention genannt und bewirkt, dass die an sich unwillkürlich auftretenden Schwierigkeiten bewusst vollzogen werden können, z. B. wird dem Schlafgestörten Schlafentzug verordnet. (In Ergänzung dazu vgl. o. Paradoxe Intention)
Gefangenendilemma: Der Konstruktivismus versteht sich als systemorientiert. Nicht die historische Frage: „Warum besteht, woher kommt eine Neurose?“ sondern die systematische: „Wie funktioniert das krankmachende System (bzw. Kommunikation überhaupt), das die Neurose am Leben hält?“ steht im Mittelpunkt. Im Rückgriff auf die Spieltheorie (s. u.) wird als Sinnbild für konstruktivistische Erkenntnisse das in vielen Variationen spielbare Prisenor's Dilemma (s. zu. B. hier; Spielmöglichkeit unter diesem Link) verwendet.
Ex.: Zwei Gruppen (oder Einzelpersonen) treten - zum Beispiel auf Grundlage des unten stehenden Schemas - gegeneinander an. Sowohl A (waagrecht) wie auch B (senkrecht) wählen ohne Absprachemöglichkeit (in einer Spielvariante, die die Vertrauensbasis womöglich noch nachhaltiger zu erschüttern imstande ist, ev. auch mit) eine der beiden Spalten. Die Anzahl der gewonnen Punkte (A blau, B rot) hängt von der gleichzeitig erfolgenden Wahl der jeweils anderen Partei ab (analog der bekannten Geschichte von den beiden Gefangenen, die, je nachdem, wie sie selbst und der jeweils andere die Richterfrage: „Schuldig: ja oder nein?“ beantwortet haben, frei gehen / befristet ins Gefängnis müssen / lebenslänglich eingesperrt werden oder geköpft werden). Gespielt werden einige (oder auch nur eine oder sehr viele) Runden, solange, bis der Spielleiter unvorhergesehenerweise abbricht. (Man möge sich vorstellen, dass jeder Pluspunkt auszuzahlende 1000 €, jeder Minuspunkt in die Bank, die durch den Spielleiter vertreten wird, einzuzahlende 1000 € bedeuten.)
|
Mögliches |
|
||
| b1 | b2 | ||
A |
a1 |
+5 |
+8 |
|
a2 |
-5 |
-3 |
|
Abb. 4/19: Graphik - Gefangenendilemma
Das Spiel ist (wie das Leben) ein kein Nullsummen-Spiel (eines, bei dem der Verlust der Partei A - wie z. B. im Fußball - automatisch denselben Gewinn für Partei B bedeutet), sondern ein Common Goods Game (Spiel gemeinschaftlicher Investitionen) und steht u. a. metaphorisch für die Spannung zwischen Gemeinwohl und Eigennutz. Es zeigt die Tatsache auf, dass es in menschlichen Beziehungen unmöglich ist, auf Kosten des/der jeweiligen anderen zu gewinnen. Oft fühlen sich Probanden als Sieger, wenn sie am Ende des Spiels weniger Minus auf dem „Konto“ haben als die andere Partei (so, als ob es bei 50 000 € Schulden ein Trost wäre, dass andere 100 000 € Schulden haben). Elemente jeder menschlichen Kommunikation sind das Aufeinanderangewiesensein, die Notwendigkeit zu vertrauen und die Tatsache, dass eine „logische“ Lösungsfindung, die nach dem Maximum strebt, mit einem optimalen Ergebnis inkompatibel ist. Ein kurzfristiger Maximalgewinn (8) würde langfristig - auch die Gegenpartei würde wohl irgendwann die zweite Spalte wählen, was beiderseits zu minus 3 führen würde - rasch wieder verschwinden.
Das Gefangenendilemma wurde im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften populär, da es altruistische Kooperation versus
egoistische Gewinnmaximierung zum Thema macht.
Jede weitere Runde wird - in welcher Weise auch immer - von der vorangegangenen
beeinflusst. In einer vor vielen Jahren international am Computer durchgeführten (iterierten) Spielserie
gewann der ehemalige IHS-Direktor Anatol
Rapoport, 1911-2007, mit einer
simplen Tit for tat-Strategie („Wie du mir, so ich dir“;
Reziprozitätsnorm): Das
von ihm verfasste Programm spielte immer auf Vertrauen, also Spalte 1. Nur wenn
der Gegner Spalte 2 gewählt hatte, wählte auch das Programm genau einmal Spalte 2.
Diese Gefangenendilemmastrategie steht modellhaft für eine klare, freundliche
Interaktionsweise, die aber - nicht nachtragend - Vergeltung übt, sobald sie
provoziert wird. (Nach Rapoport
können soziale Interessenskonflikte durch fight - gewalttätige
Auseinandersetzung, game - geregelte Auseinandersetzung oder debate
- Überzeugungsversuche geregelt werden. Zu Konflikten
s. a. u.)
Vgl. auch The Prisoners' Dilemma
(Videodiskussion)
oder Dutzende andere Seiten
* NLP (Neuro-Linguistisches
Programmieren): NLP (z. B. von Bateson
propagiert) wird definiert als die Wissenschaft von den Strukturen subjektiver
Erfahrungen. Werden Sinneseindrücke zu individuellen Wahrnehmungen verdichtet,
entstehen personspezifische interne Repräsentationen, die visuell,
auditiv, kinästhetisch, gustatorisch und/oder olfaktorisch orientiert sein
können. NLP will Verfahrensweisen zur Verbesserung (und eventuell zur
Manipulation oder Steuerung) der Kommunikation mit sich selbst und mit anderen
Menschen zur Verfügung stellen. Manchmal wird dies als „Pseudowissenschaft“, „New Age-Psychotherapie“, Geschäftemacherei und Manipulationsinstrument
kritisiert.
Vgl.
nlp.at,
nlp.de u. v.
Als wichtigste Annahmen gelten nach einer Zusammenfassung von Thies Stahl (*1950):
| ° | Menschen reagieren auf ihre subjektive Abbildung der Wirklichkeit und nicht auf die äußere Realität. |
| ° | Geist und Körper sind Teile des gleichen kybernetischen Systems und beeinflussen sich wechselseitig. |
| ° | Viele Verhaltensmöglichkeiten sind wichtig, weil ein System immer von dem Element kontrolliert wird, das am flexibelsten ist. |
| ° | Ein Mensch funktioniert immer perfekt und trifft stets die beste Wahl auf der Grundlage der für ihn verfügbaren Informationen. |
| ° | Jedem Verhalten liegt eine positive Absicht zugrunde, und es gibt zumindest einen Kontext, in dem es nützlich ist. |
| ° | Das Ergebnis von Kommunikation ist das Feedback, das der einzelne bekommt; Fehler oder Versagen gibt es nicht. |
| ° | Kann ein Mensch lernen, etwas Bestimmtes zu tun, können es grundsätzlich alle Menschen. |
| ° | Menschen verfügen über alle Ressourcen, die sie brauchen, um eine von ihnen angestrebte Veränderung zu erreichen. |
Weitere Annahmen wären:
| ° | Wir leben sowohl in der Welt der Sprache und Symbole wie auch in der realen Welt der Erfahrungen. „Die Landkarte ist nicht das Gebiet“. (Zitat vom polnisch-US-amerikanischen Autor und Ingenieur Alfred Wladyslaw Augustyn Korzybski, später Alfred Habdank Skarbek Korzybski, 1879-1950, der u. a. Berne - s. o. - und Bateson - s. o. - unterrichtete) |
| ° | Der positive Wert eines Menschen bleibt konstant, sein jeweiliges Verhalten kann aber unangemessen sein. |
| ° | Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anders. |
| ° | In einem ansonsten gleich bleibenden System hat das Element mit den größtmöglichen Verhaltensmöglichkeiten die Kontrolle. |
| ° | Widerstand beim Klienten bedeutet mangelnde Flexibilität des Therapeuten. |
| ° | Der Sinn jeder Kommunikation ist nicht die Absicht, sondern die Reaktion, die sie beim Gegenüber auslöst. |
NLP verwendet verschiedene Verfahrensweisen:
Unter (oft durch Mirroring - Spiegeln - unterstütztem) Rapport (der Begriff stammt ursprünglich aus dem Bereich der Hypnose) wird dabei der anzustrebende problemlose Kommunikationsfluss, das Erzeugen einer vertrauensvollen Übereinstimmung, verstanden.
Um Reaktion anderer bewusst zu steuern, wird vor allem der Priming-Effekt (= Bahnung) eingesetzt. Darunter versteht man die unbewusst bleibende Beeinflussung der Informationsverarbeitung (Reizkognition), dadurch, dass davor ein anderer Reiz vorhandene Gedächtnisinhalte aktiviert (innere Bilder abgerufen) hat. Diese Aktivierung spezieller Assoziationen im Gedächtnis aufgrund von Vorerfahrungen wurde von John A. Bargh (*1955) experimentell untersucht. Dabei wurden Gedächtnisinhalte durch Worte, Gerüche, kinästhetische Erfahrungen (Triggerreize, Anker) etc. aktiviert, die Bewertungen, die ja als rational gesteuert gelten, drehen können (vgl. die im Bereich der Politik tätigen Spin-Doktoren). Zum Beispiel wurde in einem Ex. die Aussage „Ein Vertreter klopfte, aber Donald ließ ihn nicht herein.“) umso eher als feindselig bewertetet, je stärker die Vpn. davor mit subliminal emotional feindselig gefärbten Begriffen (wie „Beleidigung“, „unfreundlich“) beeinflusst wurden. Andere Beispiele für beeinflussende Reize: Harte/weiche Sessel für Verhandlungspartner, heiße/kalte Getränke während Beziehungsstreitigkeiten etc. Bargh u. a. entwickelten in diesem Zusammenhang 1996 das folgende, so genannte
| Vpn. sollten gemäß der Cover story einen sprachlichen Test durchführen, indem sie mit Vokabeln wie Florida (in den USA ein sprichwörtliches Pensionistenparadies), vergesslich, Glatze, grau oder Falte Sätze bilden. Das eigentliche Ex. folgte jedoch erst danach: Ohne dass dies den Vpn. mitgeteilt wurde, maß man die Gehgeschwindigkeit dieser Gruppe im Vergleich zu einer Kg., die keine oder andere (mit Jugendlichkeit konnotierte) Wörter als Material zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Allein das Lesen der seniorenbezogenen Vokabel beeinflusste das Verhalten der Probanden, ohne dass diese davon etwas bemerkten: sie gingen - womöglich einander unbewusst verstärkend - signifikant langsamer zum Lift als die Kg. |
Dieses Phänomen wird Florida-Effekt oder ideomotorischer Effekt genannt. Zugrunde liegt die „assoziative Aktivierung“, die unkontrolliert in System 1 - s. o. - abläuft. - Vgl. dazu folgenden FAZ-Artikel
Weitere mit NLP in Zusammenhang stehende und z. B. in Reden verwendete Techniken sind u. a. Framing (s. o., z. B. wirkt die Aussage eines Arztes „90% überleben diesen Krebs“ beruhigender als die Aussage „10% sterben an diesem Krebs.“) bzw. Refraiming, Pacing (= nach Richard Bandler, *1950, und John Grinder, *1940, die als NLP-Erfinder angesehen werden, „sich in der Körperhaltung, dem Sprachverhalten, der Gestik und/oder dem Atemrhythmus dem Gesprächspartner anzupassen. Dadurch entsteht auf einer unbewussten Ebene ein intensiver und zuverlässiger Kontakt. Dieser Kontakt ist unabhängig von inhaltlichen Übereinstimmungen und daher besonders gut geeignet, auch in schwierigen und kontroversen Situation eine stabile und positive Beziehung zu gewährleisten.“ ), Leading (= das durch Herstellung von Rapport, Framing und Pacing vorbereitete „Führen“, Beeinflussen oder Manipulieren der angesprochenen Personen), das Milton-Modell (beschreibt, wie Verallgemeinerungen, Tilgungen und Verzerrungen sprachlich so eingesetzt werden können, dass die Angesprochenen aus ihrer Erfahrungswelt assoziativ Bedeutungen hinzufügen können; benannt nach dem Hypnosetherapeuten Milton Erickson, 1901-1980), Ankern (= bewusst herbeigeführtes Verbinden bestimmter Reize mit bestimmten Reaktionen; Anker können in jedem Sinnesbereich installiert werden. Ein spezifischer Reiz wird - wiedererinnerbar - dann gesetzt, wenn ein bestimmter Zustand erlebt wird; zum Ankereffekt s. a. o.)
Tversky und Kahneman (s. a. o.) teilten schon 1974 ein Ex. mit, das den Ankereffekt bewies: Die Vpn. der Gruppe A sollten innerhalb von 5 sec. das Produkt aus 1x2x3x4x5x6x7x8=? schätzen, die der Gruppe B erhielten dieselbe Aufgabe, aber verkehrt herum angeschrieben (8x7x6x5x4x3x2x1=?). Im Durchschnitt tippte Gruppe A auf 512, Gruppe B auf 2250 (beides keine sehr exakten Schätzungen). Erklärung: Die jeweils erste Multiplikation ergibt unterschiedlich hohe Werte (2 vs. 56) und beeinflusst den folgenden Gedankengang. Dieser Effekt wird im Marketing tagtäglich ausgenutzt. (Ein zunächst erwähnter hochpreisiger Artikel lässt z. B. alle danach präsentierten Produkte billig erscheinen.)
_________________________________________________
Es existieren zahllose weitere - seriöse und unseriöse oder zumindest unwissenschaftliche Therapieformen (die es immer schon gab: z. B glaubte der zu seiner Zeit weithin einflussreiche Franz Anton Mesmer, 1734-1815, dessen Theorien in die berühmten Portraitplastiken des Franz Xaver Messerschmidt, 1736-1783, einflossen, Krankheiten durch „animalischen Magnetismus“ und Berührungen heilen zu können), zum Beispiel: Beschäftigungs-, Schlaf-, Rebirthing-Therapie, Lachyoga oder die Hypnotherapie von Milton Erickson (1901-1980), die eine höhere Lernfähigkeit durch Rückversetzung in einen kindlichen Zustand mittels Trance erzielen will. (In Abgrenzung zur bewusstseinsmodifizierenden Hypnose entwickelte der Kolumbianer Alfonso Cayedo, 1932-2017, die Bewusstseinsphilosophie Sophrologie, die das „reine Bewusstsein“ herstellen will, um alles Erlebte integrieren zu können.). Auch die Logopädie bei tonischem (Blockade und Herausplatzen einzelner Wörter) oder klonischem (Repetieren von Wörtern oder Satzteilen) Stottern (vgl. Speech and language disorders), die Lichttherapie (s. o.) u. v. a. m. enthalten psychotherapeutische Elemente.
|
|
Copyright © 1999-2026 Thomas Knob. All rights reserved. - Die Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten wird keine Verantwortung übernommen.